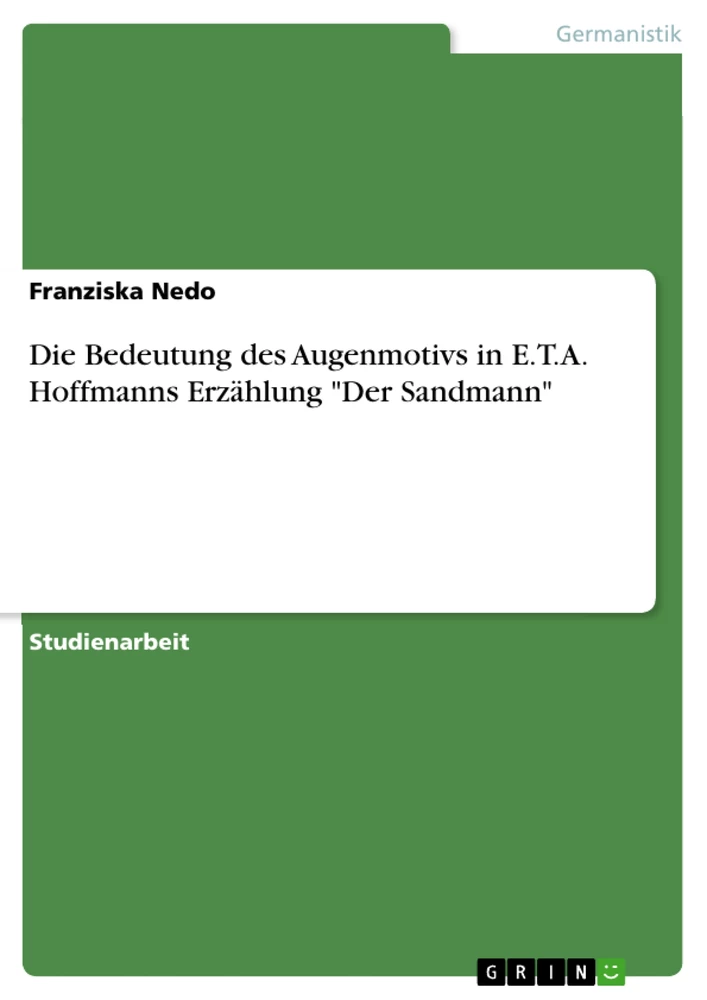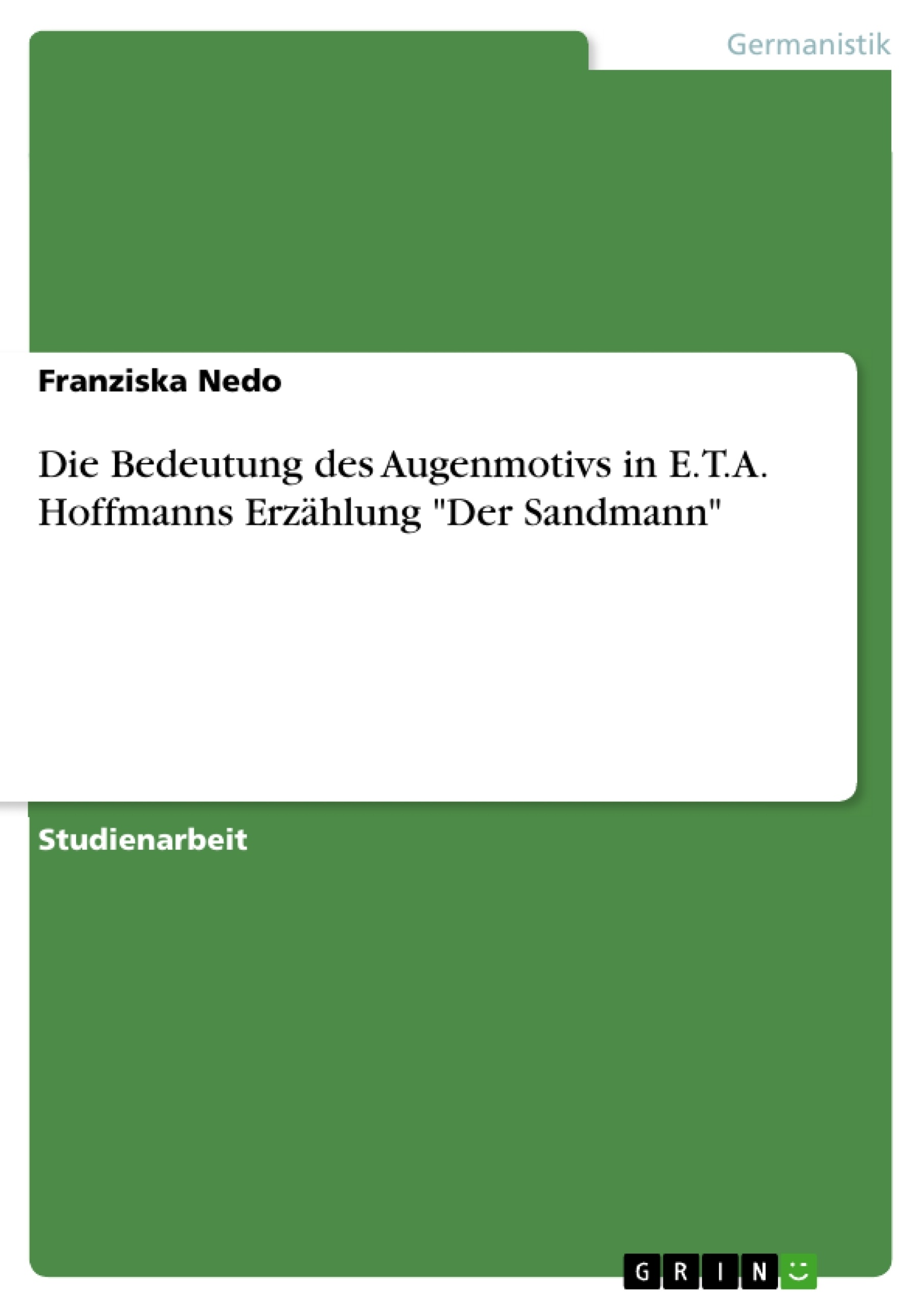Fast alle Forschungsbeiträge zur Interpretation des „Sandmanns“ von E.T.A. Hoffmann beschäftigen sich mit der Augen- und Automatenproblematik. So gilt das Augen- neben dem Puppenmotiv als das zentrale Leitmotiv überhaupt in der Erzählung. Man staunt, mit welcher Präzision Hoffmann das Problem von Wirklichkeit und Wahnsinn symbolisch mit dem Motiv der Augen konkretisiert.
Ziel dieser Arbeit ist es demnach, zu untersuchen, welche Bedeutung die Augen in Hoffmanns Werk „Der Sandmann“ tragen und welche Funktion sie in diesem Zusammenhang übernehmen. Dabei wird zuerst die Beschreibung der Augen der Figuren in der Erzählung in Beziehung zu ihrem Charakter gesetzt und gedeutet. Des Weiteren wird die Bedeutung des Augenmotivs im Sandmann-Märchen der Kinderfrau untersucht, da es als Ursprung für Nathanaels Hang zum „Wunderbaren, Abenteuerlichen“ und dem später eintretenden Wahnsinn Nathanaels zu werten ist. Daran anknüpfend erfolgt die Betrachtung des Augenmotivs im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn, indem die Bedeutung des Augenmotivs in der Laborszene, in Nathanaels Dichtung, bei der Begegnung mit Olimpia und ihrer Zerstörung sowie in der Schlussszene ausführlich betrachtet und interpretiert wird. Eine ab-schließende Schlussbetrachtung fasst die grundlegenden Erkenntnisse zur Bedeutung und Funktion des Augenmotivs in Hoffmanns „Sandmann“ zusammen.
Die Erzählung „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoffmann wurde erstmals 1816 veröffentlicht und wird häufig auch als Schauerroman bezeichnet. Die erste Niederschrift der Erzählung stammt aus dem Jahr 1815, während der Erstdruck des „Sandmanns“ in der 1816 er-schienen Sammlung unter dem Namen „Nachtstücke“ erfolgte. Die Erstfassung unterscheidet sich gegenüber der endgültigen Fassung von 1816 vor allem darin, dass eine weitere gewaltsame Geschichte zwischen Coppelius und Nathanaels Schwester erzählt und dass das Ende ein wenig ausführlicher gestaltet wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Beschreibung der Augen der Figuren und ihre Bedeutung
- 2.1 Nathanael
- 2.2 Clara
- 2.3 Olimpia
- 2.4 Coppelius bzw. Coppola
- 2.5 Spalanzani
- 2.6 Die Beziehung zwischen den Namen der Figuren und dem Augenmotiv
- 3. Die Bedeutung des Augenmotivs im Sandmann-Märchen
- 4. Die Bedeutung des Augenmotivs im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn
- 4.1 Das Augenmotiv in der Laborszene
- 4.2 Das Augenmotiv in Nathanaels Dichtung
- 4.3 Die Bedeutung des Perspektivs und der Augen bei der Begegnung mit Olimpia
- 4.4 Das Augenmotiv bei der Zerstörung Olimpias
- 4.5 Das Augenmotiv in der Schlussszene
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Augenmotivs in E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“. Das Ziel ist es, die Funktion und Bedeutung der Augen in der Erzählung zu untersuchen und zu interpretieren, indem die Augen der Figuren in Beziehung zu deren Charakteren und dem Verlauf der Geschichte gesetzt werden.
- Die Beschreibung der Augen der Figuren und ihre Bedeutung für den Charakter
- Die Rolle des Augenmotivs im Sandmann-Märchen der Kinderfrau als Ursprung für Nathanaels Wahnsinn
- Die Bedeutung des Augenmotivs in Verbindung mit Nathanaels Wahnsinn in verschiedenen Szenen der Erzählung
- Die Funktion des Augenmotivs als Symbol für die Wahrnehmung der Realität und die Grenze zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn
- Die Interpretation des Augenmotivs in Bezug auf das Spannungsfeld zwischen Sehnsucht, Liebe und Angst
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Erzählung „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoffmann vor und gibt einen Überblick über die Rezeption des Werkes. Das Kapitel 2 untersucht die Beschreibung der Augen der Figuren Nathanael, Clara, Olimpia, Coppelius/Coppola und Spalanzani und stellt diese in Beziehung zu deren Charakteren. Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung des Augenmotivs im Sandmann-Märchen der Kinderfrau. Kapitel 4 analysiert die Funktion des Augenmotivs im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn in verschiedenen Szenen der Erzählung, wie zum Beispiel der Laborszene, Nathanaels Dichtung und der Begegnung mit Olimpia.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Augenmotiv, Sandmann, E. T. A. Hoffmann, Nathanael, Clara, Olimpia, Wahnsinn, Wirklichkeit, Traum, Sehnsucht, Liebe, Angst, Wahrnehmung, Perspektiv, Automatenproblematik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Augenmotiv in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“?
Das Augenmotiv ist das zentrale Leitmotiv und symbolisiert die Grenze zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn sowie die verzerrte Wahrnehmung des Protagonisten Nathanael.
Wie hängen die Charaktere mit ihren Augenbeschreibungen zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie Hoffmann durch die Beschreibung der Augen (z.B. bei Clara oder Olimpia) den Charakter und die Funktion der Figuren in der Erzählung konkretisiert.
Was ist der Ursprung von Nathanaels Wahnsinn?
Das Sandmann-Märchen der Kinderfrau, in dem der Sandmann Kindern die Augen raubt, gilt als traumatisches Schlüsselerlebnis für Nathanaels späteren Zustand.
Welche Rolle spielt Olimpia in der Augenproblematik?
Olimpia, eine leblose Puppe, wird von Nathanael durch ein Perspektiv (Fernrohr) als lebendig wahrgenommen, was die Automatenproblematik und seinen Realitätsverlust verdeutlicht.
Wann wurde „Der Sandmann“ erstmals veröffentlicht?
Die Erzählung wurde 1816 in der Sammlung „Nachtstücke“ veröffentlicht, nachdem sie 1815 niedergeschrieben wurde.
- Citar trabajo
- Franziska Nedo (Autor), 2015, Die Bedeutung des Augenmotivs in E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311770