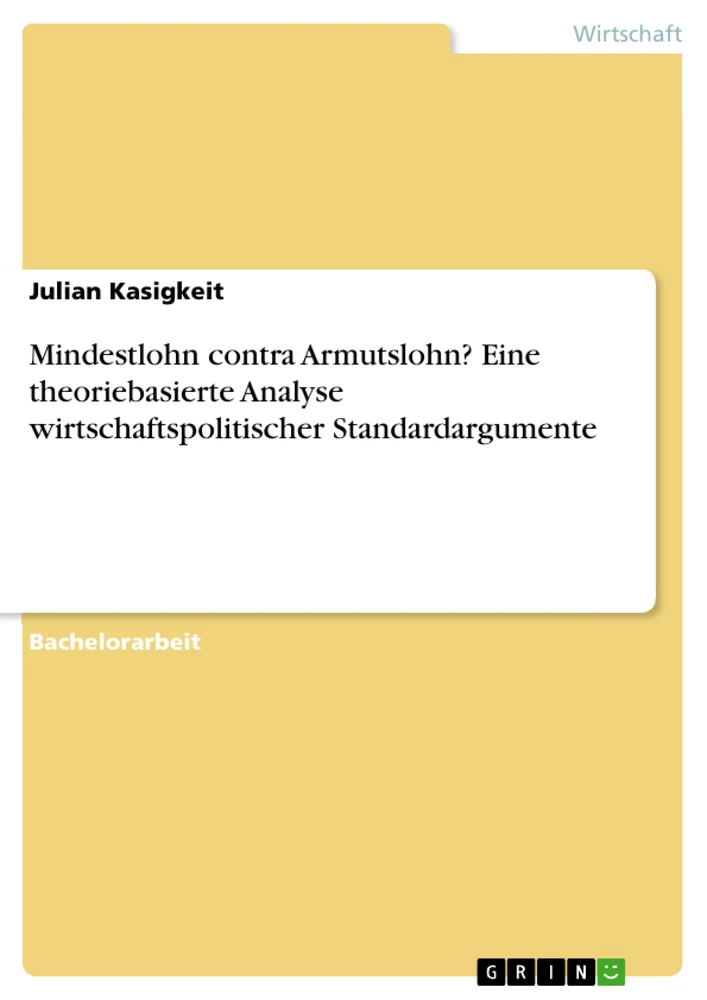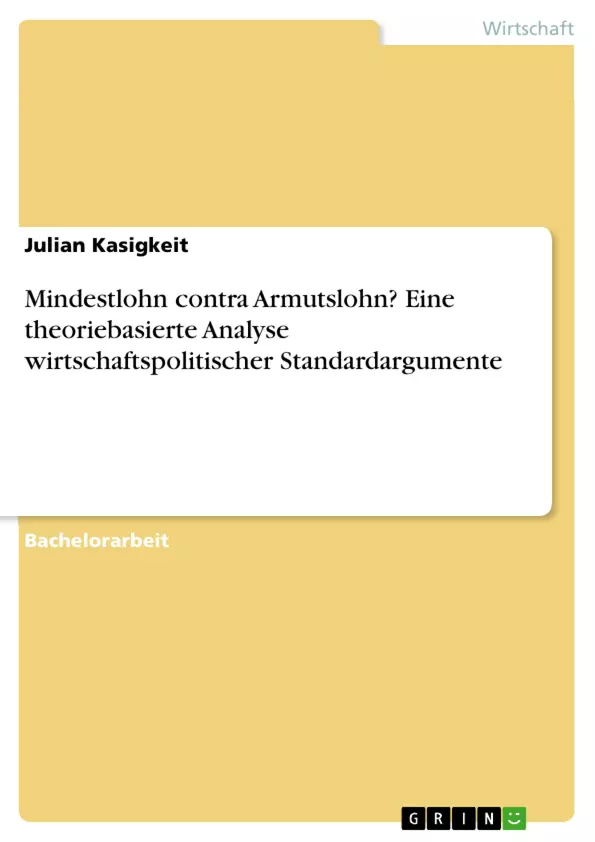Frankreich hat einen Mindestlohn, Großbritannien ebenso und die USA haben ihn bereits seit 1938. Auch in Deutschland ist eine große Mehrheit der Bevölkerung für einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn, wie eine Umfrage der Infratest Dimap im Auftrag des DGB zeigt (Infratest Dimap, 2013). Alarmierende Entwicklungen in der Einkommensverteilung zwischen Arm und Reich kratzen an der Glaubwürdigkeit des Sozialstaates, während der Niedriglohnsektor wächst (Schäfer, 2012).
Der Niedriglohnsektor in Deutschland hat sich im Vergleich zu den anderen 28 Mitgliedsstaaten zum siebtgrößten der EU entwickelt (Hans-Böckler-Stiftung, 2013b). So ist es nicht überraschend, wenn die Einführung eines Mindestlohns auch hierzulande als ernst zu nehmende Alternative zur Bekämpfung von Prekär- und Armutslöhnen kontrovers diskutiert wurde.
CDU und Arbeitgeberverbände stehen der Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns ablehnend gegenüber, es wird mit negativen Beschäftigungseffekten auf dem Arbeitsmarkt gerechnet. Die SPD und die Mehrheit der Gewerkschaften setzen sich hingegen für staatlich festgelegte Mindestlöhne ein und argumentieren mit wachsenden Einkommensungleichheiten und der Zunahme von Armut und sozialer Ausgrenzung in unserer Gesellschaft. In der Debatte ist demnach neben einer ökonomischen auch eine moralische Dimension zu berücksichtigen (Schulten, et al., 2006 S. 7).
Auch die Wissenschaft ist uneins über die Effekte, die die Einführung eines Mindestlohns mit sich bringen könnte. Während die Neoklassiker auf Grundlage einer gegenwärtig weit verbreiteten Theorie negative Beschäftigungseffekte prognostizieren, bezweifelt die keynesianische Arbeitsmarkttheorie die Annahme eines vollkommenen Arbeitsmarktes und die daraus gefolgerten theoretischen Konsequenzen. Eindeutige Indizien für oder gegen den Mindestlohn konnten bis dato auch durch keine empirische Studie zu diesem Thema beigetragen werden.
In Anbetracht dieser Situation der Debatte, in der sich die politischen Fronten verhärten und kein einfacher politischer Kompromiss in Aussicht ist, erscheint eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema angebracht. Wirtschaftspolitische Argumente müssen verstanden, verglichen und abgewogen werden, um Entwicklungstendenzen einschätzen zu können und fundierte Handlungsempfehlungen zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mindestlohndebatte
- Ziel dieser Arbeit
- Vorgehen und Methodik
- Theoretische Vorüberlegungen
- Ausgewählte Definition wichtiger Fachbegriffe
- Mindestlohn, Lohnuntergrenze, Kombilohn
- Niedriglohnsektor, Prekärlohn, Armutslohn
- Mindestlohn - eine Diskussion ökonomischer Theorien
- Gegenwärtige Situation in Deutschland
- Theoriebasierte Analyse wirtschaftspolitischer Standardargumente
- Mindestlöhne vernichten Arbeitsplätze
- Der Mindestlohn verschlechtert im speziellen die Arbeitsmarktchancen von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen
- Mindestlöhne verletzen den Grundsatz der Tarifautonomie und schwächen die Tarifpartner
- Mindestlöhne führen nicht zu mehr sozialer Gerechtigkeit
- Sonstige Argumente
- Alternative Instrumente sind wirksamer
- Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
- Der Mindestlohn kommt!
- Schlussbemerkung
- Der gesetzliche Mindestlohn als adäquates Mittel gegen Armutslöhne in Deutschland?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die ökonomischen Folgen eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland. Sie analysiert die wirtschaftspolitischen Argumente für und gegen einen Mindestlohn und setzt diese in einen theoretischen Kontext. Der Fokus liegt dabei auf den Folgen für die Beschäftigung, die Einkommensverteilung und die soziale Gerechtigkeit.
- Die ökonomischen Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns
- Die Rolle des Mindestlohns in der Bekämpfung von Armut und Niedriglöhnen
- Die Debatte um die Arbeitsmarktfolgen eines Mindestlohns
- Die Auswirkungen eines Mindestlohns auf die Tarifautonomie
- Alternative Instrumente der Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Mindestlohns ein und beleuchtet die aktuelle Debatte in Deutschland. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit sowie die angewandte Methodik. Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen des Mindestlohns. Es werden wichtige Fachbegriffe definiert und verschiedene ökonomische Theorien zur Wirkung des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt diskutiert. Kapitel drei gibt einen Überblick über die gegenwärtige Situation des Niedriglohnsektors in Deutschland. Die folgenden Kapitel widmen sich einer detaillierten Analyse der wirtschaftspolitischen Standardargumente gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Es werden die Behauptungen beleuchtet, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze vernichten, die Arbeitsmarktchancen von Geringqualifizierten verschlechtern, die Tarifautonomie schwächen, keine soziale Gerechtigkeit schaffen und dass alternative Instrumente wirksamer sind.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Einkommensverteilung, soziale Gerechtigkeit, Tarifautonomie, Arbeitslosigkeit, Armutsbekämpfung, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der Mindestlohn in Deutschland eingeführt?
Ziel war die Bekämpfung von Armutslöhnen, die Verringerung der Einkommensungleichheit und der Schutz der Arbeitnehmer im wachsenden Niedriglohnsektor.
Welche Argumente führen Kritiker gegen den Mindestlohn an?
Kritiker, oft aus der Neoklassik, befürchten negative Beschäftigungseffekte, den Verlust von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte und eine Verletzung der Tarifautonomie.
Was sagt die keynesianische Theorie zum Mindestlohn?
Die keynesianische Sicht betont die Stärkung der Kaufkraft und bezweifelt, dass ein vollkommener Arbeitsmarkt existiert, weshalb Mindestlöhne positiv wirken können.
Führt der Mindestlohn zu mehr sozialer Gerechtigkeit?
Befürworter sehen darin ein Instrument gegen soziale Ausgrenzung, während Gegner bezweifeln, dass er das adäquate Mittel zur Armutsbekämpfung ist.
Welche Rolle spielt der Niedriglohnsektor in Deutschland?
Deutschland entwickelte einen der größten Niedriglohnsektoren in der EU, was die Debatte um staatliche Lohnuntergrenzen massiv befeuerte.
- Arbeit zitieren
- Julian Kasigkeit (Autor:in), 2014, Mindestlohn contra Armutslohn? Eine theoriebasierte Analyse wirtschaftspolitischer Standardargumente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311893