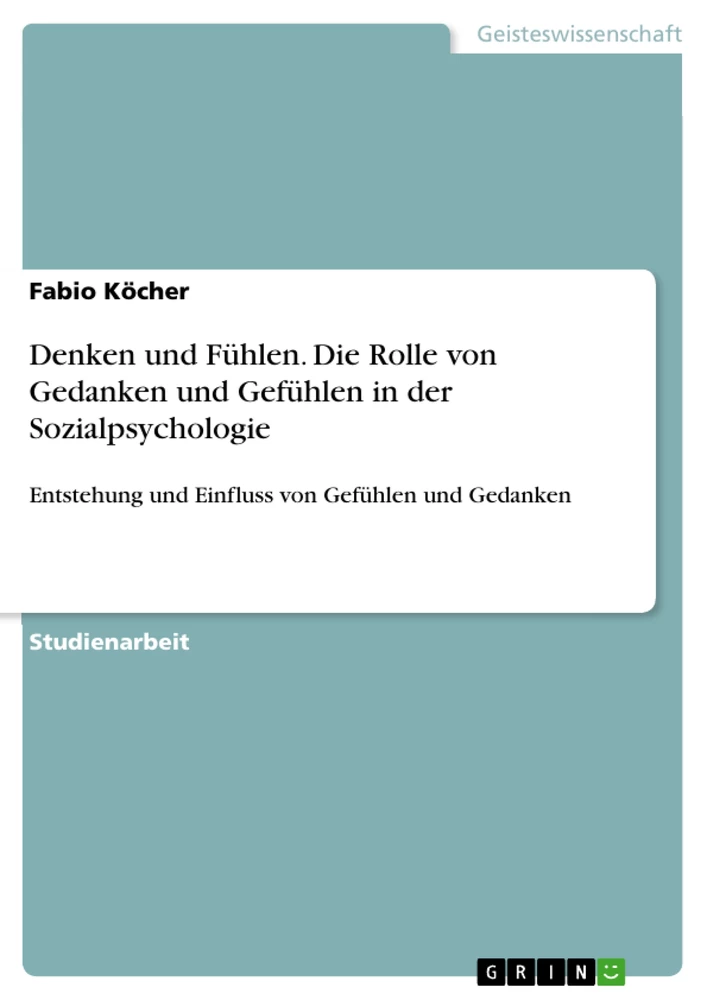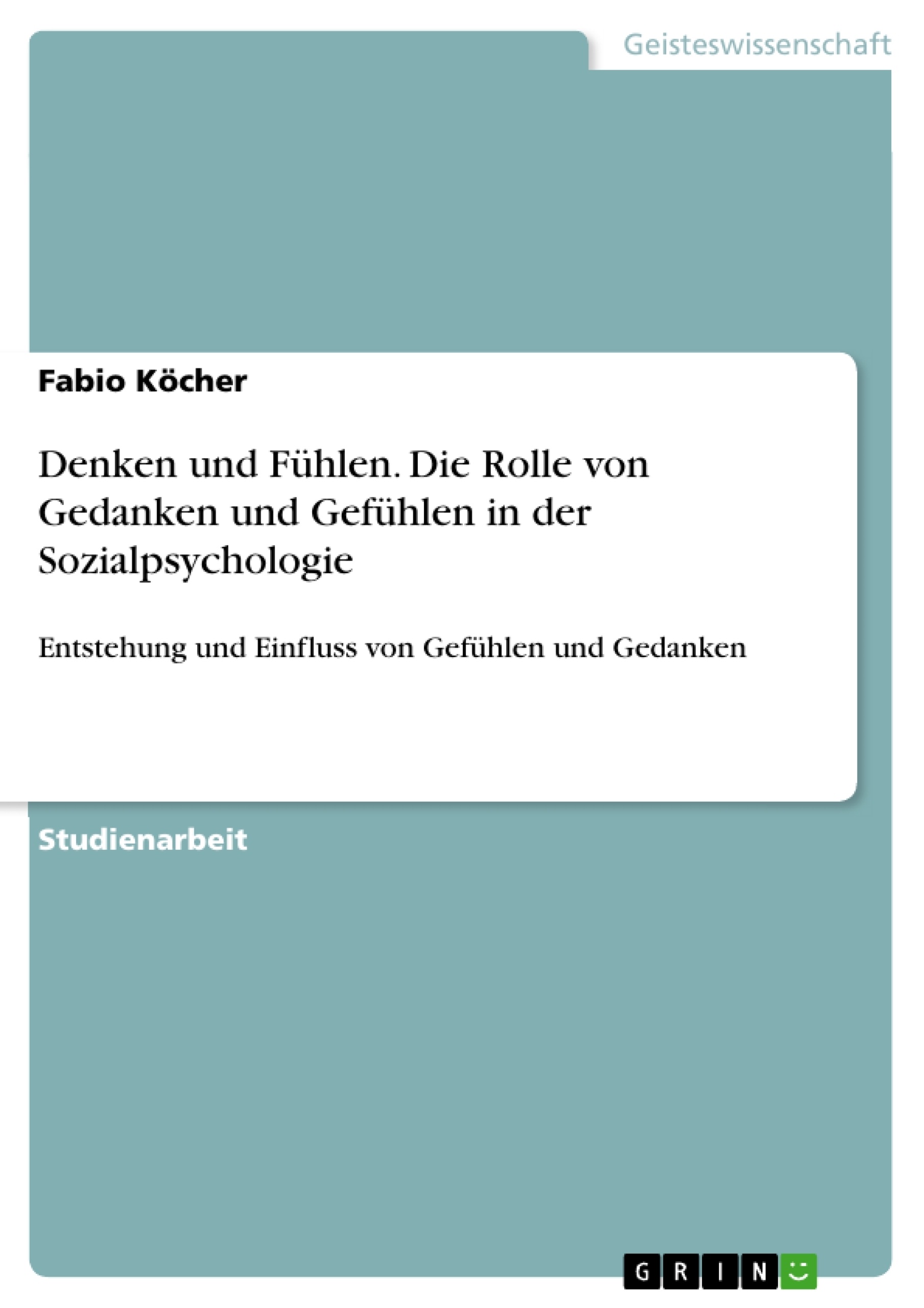Der britische Literaturkritiker John Churton Collins (* 1848 | † 1908) äußerte zu seinen Lebzeiten, dass „die Hälfte aller Fehler dadurch entsteht, dass wir denken sollten, wo wir fühlen, und dass wir fühlen sollten, wo wir denken.“ Mehr als ein Jahrhundert später kann unsere Gesellschaft auf ein umfangreicheres Wissen über die Psyche des Menschen zurückgreifen und sollte uns Aufschluss darüber geben können, was diese intellektuelle Persönlichkeit mit diesem Zitat meinte. Darüber hinaus stellt sich aus dieser Aussage auch die Frage, ob diese Hypothese aus dem 19. Jahrhundert auch heute noch auf Resonanz klingen mag.
Doch auch heutzutage trifft die Psychologie auf seine Grenzen. Bei meiner Recherche, wo der Ursprung der Gedanken eigentlich liegt, bin ich auf keinerlei wissenschaftliche Argumentationen gestoßen. Über die Entstehung von Gefühlen bietet die Wissenschaft Antworten, auf welche auch nachfolgend in dieser Arbeit eingegangen wird. Im Grunde genommen beschäftigt sich diese Arbeit damit, welche Rolle Gedanken und Gefühle haben, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und welchen Einfluss sie auf die Person selbst sowie das Umfeld haben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort
- 1. Der Prozess der Informationsverarbeitung
- 2. Einfluss von Gefühlen auf das Denken
- 2.1. Einfluss der Stimmung auf den Verarbeitungsstil
- 2.2. Einfluss der Gefühle auf Wahrnehmung & Erinnerung
- 2.3. Einfluss der Gefühle auf Urteile
- 3. Entstehung von Gefühlen
- 4. Einfluss von Kognitionen auf Gefühle
- 5. Bedeutung im täglichen Leben
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Denken und Fühlen. Sie untersucht, wie unsere Gedanken und Emotionen die Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Erinnerung und Entscheidungsfindung beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung von Gefühlen und wie diese durch Kognitionen beeinflusst werden. Darüber hinaus wird der Einfluss von Denken und Fühlen auf das tägliche Leben analysiert.
- Der Einfluss von Gefühlen auf den Verarbeitungsstil, die Wahrnehmung, die Erinnerung und Urteile
- Die Entstehung von Gefühlen und deren Kognition
- Die Interaktion von Denken und Fühlen im täglichen Leben
- Die Rolle von Emotionen bei der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung
- Die Auswirkungen von Stimmungsschwankungen auf unsere Denkprozesse
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- 1. Der Prozess der Informationsverarbeitung: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Rolle von Gedanken und Gefühlen bei der Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt. Es werden Beispiele wie das "mit dem falschen Fuß" Aufstehen und die "rosarote Brille" des Verliebten herangezogen, um den Einfluss der Gefühlslage auf die Wahrnehmung und Interpretation von Situationen zu verdeutlichen.
- 2. Einfluss von Gefühlen auf das Denken: Dieses Kapitel untersucht, wie Emotionen unsere Denkprozesse beeinflussen. Es wird zwischen Affekten, Stimmungen und Emotionen unterschieden und die Auswirkungen auf den Verarbeitungsstil, die Wahrnehmung, die Erinnerung und Urteile beleuchtet. Es wird dargestellt, wie unsere Gefühlslage unsere Sichtweise und unsere Entscheidungen prägen kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Denken, Fühlen, Emotionen, Affekte, Stimmungen, Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Erinnerung, Urteile, Entscheidungsfindung, Kognition, Verhalten, Wahrnehmungsstil.
- Quote paper
- Fabio Köcher (Author), 2014, Denken und Fühlen. Die Rolle von Gedanken und Gefühlen in der Sozialpsychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311960