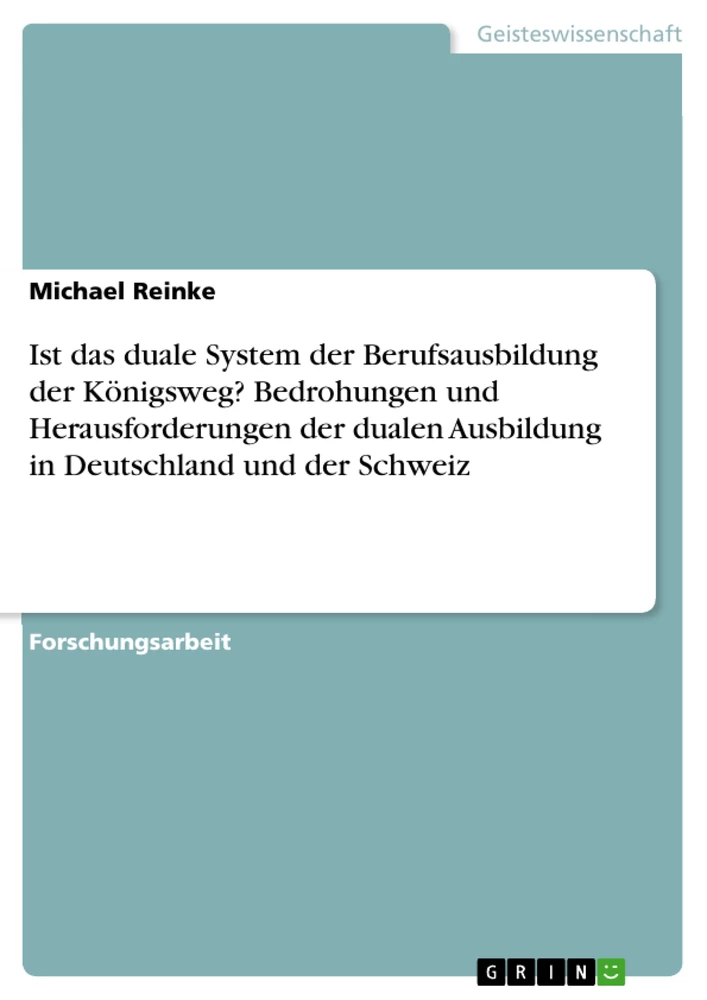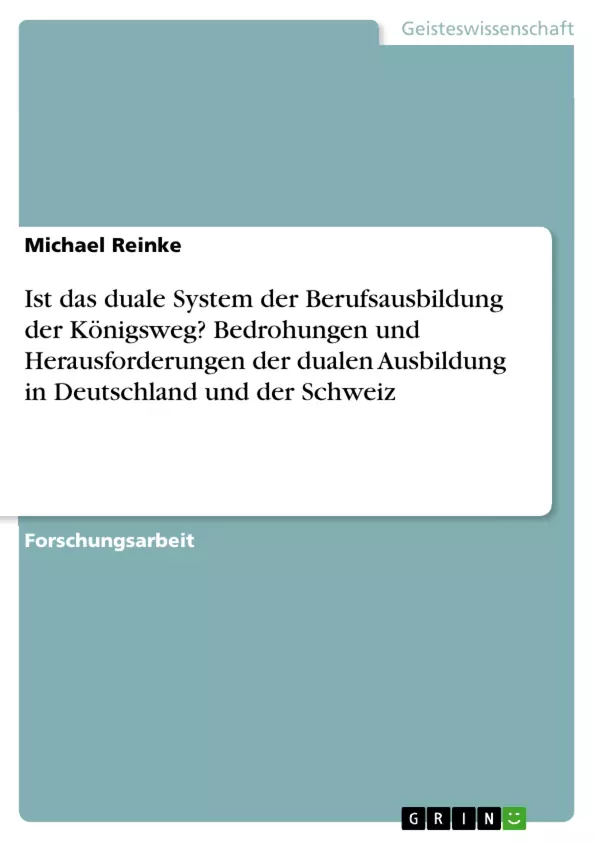In unserer modernen Bildungskultur steht die berufliche Bildung zweifelsohne vor neuen Herausforderungen. Dieser Entwicklung können sich auch das in der internationalen Diskussion hoch angesehene deutsche, sowie schweizerische Pendant der dualen Ausbildung nicht entziehen. Beide Systeme gelten als Referenzmodelle hinsichtlich der Ausbildung von Jugendlichen unterhalb des Hochschulniveaus. Obwohl vielen Heranwachsenden einer Alterskohorte der Übergang in eine betriebliche Ausbildung ermöglicht wird, ist dieses auf einer langen Tradition basierende System immer häufiger Reizpunkt innerdeutscher Debatten.
Nachdem in der Vergangenheit oftmals Fragen zur Aktualität einzelner Ausbildungsgänge im Vordergrund standen, sind es heutzutage eher strukturelle Probleme, wie etwa die Zertifizierung der dualen Berufsausbildung, die im öffentlichen Diskurs stehen. Zudem müssen sowohl Deutschland als auch die Schweiz heute schon mit natürlichen Systemschwächen, wie der starken Konjunktur- bzw. Demografieanfälligkeit und der Unausgeglichenheit zwischen dem Interesse für eine Berufsausbildung und dem Ausbildungsplatzangebot umgehen können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Konkurrenz durch das allgemeinbildende Angebot stetig an Beliebtheit bei den Schulabgängern hinzugewinnt.
Zwar befinden sich die Schweiz und Deutschland neben anderen Ländern an der Spitze in Sachen Berufsbildung, dennoch stehen die dualen Systeme vor einer widersprüchlichen Ausgangslage. In Zukunft wird es spannend sein, wie die hoch gehandelten „Exportschlager“ der beruflichen Bildung, hinsichtlich ihrer internationalen Vergleichbarkeit und Anerkennung von Abschlüssen angepasst werden. Ob der Status als Königsweg der beruflichen Ausbildung weiterhin für das duale System aufrechterhalten werden kann hängt sicherlich auch davon ab, ob sich der Trend zur länderübergreifenden Harmonisierung der Bildungsabschlüsse immer weiter verdichten wird – in diesem Fall wären schulische Systeme naturgemäß im Vorteil.
Der vorliegende Forschungsbericht soll Antworten darauf liefern, inwieweit das Duale System der beruflichen Ausbildung unabhängig von den nachfolgend aufgezeigten Entwicklungen bestehen kann. Immerhin gilt das Duale System der Berufsausbildung in der Schweiz mit dem verwandten deutschen Pendant heutzutage als Königsweg der beruflichen Bildung.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Wissensgesellschaft als Bedrohung für das duale Ausbildungssystem
- 2.1 Reformversuche in Deutschland und der Schweiz
- 2.2 Gelingen die Anpassungen an die veränderten Rahmenbedingungen?
- 3. Herausforderungen für die duale berufliche Bildung der Zukunft
- 3.1 Erosionsgefahr für das duale System: Die allgemeine Akademisierung der Berufe nimmt zu
- 3.2 Erschwerte Beschäftigungschancen im höheren Alter in einer dynamischen Wirtschaft
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Forschungsbericht untersucht die Herausforderungen, denen das duale Ausbildungssystem in der Schweiz und Deutschland in einer von strukturellen Veränderungen geprägten Arbeitswelt gegenübersteht. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das duale System und der Frage, ob dieser Bildungspfad trotz der Herausforderungen seinen Status als "Königsweg" der beruflichen Bildung bewahren kann.
- Die Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das duale Ausbildungssystem
- Reformversuche in Deutschland und der Schweiz
- Die Herausforderungen der Akademisierung von Berufen
- Die Erschwernisse bei der Beschäftigung im höheren Alter
- Die zukünftige Rolle des dualen Systems im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der dualen Berufsausbildung in der Schweiz und Deutschland ein. Es beleuchtet die Bedeutung dieser Systeme im internationalen Vergleich und die aktuellen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen.
- Kapitel 2: Die Wissensgesellschaft als Bedrohung für das duale Ausbildungssystem: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das duale Ausbildungssystem. Es untersucht Reformversuche in Deutschland und der Schweiz und analysiert die Anpassungsfähigkeit des dualen Systems an die veränderten Rahmenbedingungen.
- Kapitel 3: Herausforderungen für die duale berufliche Bildung der Zukunft: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Akademisierung von Berufen und dem erschwerten Zugang zu Beschäftigung im höheren Alter für das duale System ergeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Duale Berufsausbildung, Wissensgesellschaft, Akademisierung, Beschäftigung im höheren Alter, Reformversuche, Schweiz, Deutschland, internationaler Vergleich, Bildungssystem, Königsweg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das duale Ausbildungssystem?
Ein System der Berufsausbildung, das die praktische Ausbildung im Betrieb mit der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule kombiniert.
Warum gilt es als „Königsweg“ der Berufsbildung?
Es sorgt für eine hohe Praxisrelevanz der Ausbildung und trägt in Deutschland und der Schweiz maßgeblich zu einer niedrigen Jugendarbeitslosigkeit bei.
Welche Bedrohungen gibt es für das duale System?
Die zunehmende Akademisierung von Berufen, der Trend zu allgemeinbildenden Schulen und die Anfälligkeit für wirtschaftliche Konjunkturschwankungen gefährden das System.
Wie wirkt sich die Wissensgesellschaft auf die Ausbildung aus?
Berufsbilder verändern sich schneller, was ständige Reformen und Anpassungen der Ausbildungsinhalte an neue technologische Standards erforderlich macht.
Ist das System international vergleichbar?
Die Anerkennung von Abschlüssen im Ausland ist eine Herausforderung, insbesondere im Vergleich zu rein schulischen Ausbildungssystemen anderer Länder.
- Quote paper
- Michael Reinke (Author), 2015, Ist das duale System der Berufsausbildung der Königsweg? Bedrohungen und Herausforderungen der dualen Ausbildung in Deutschland und der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311980