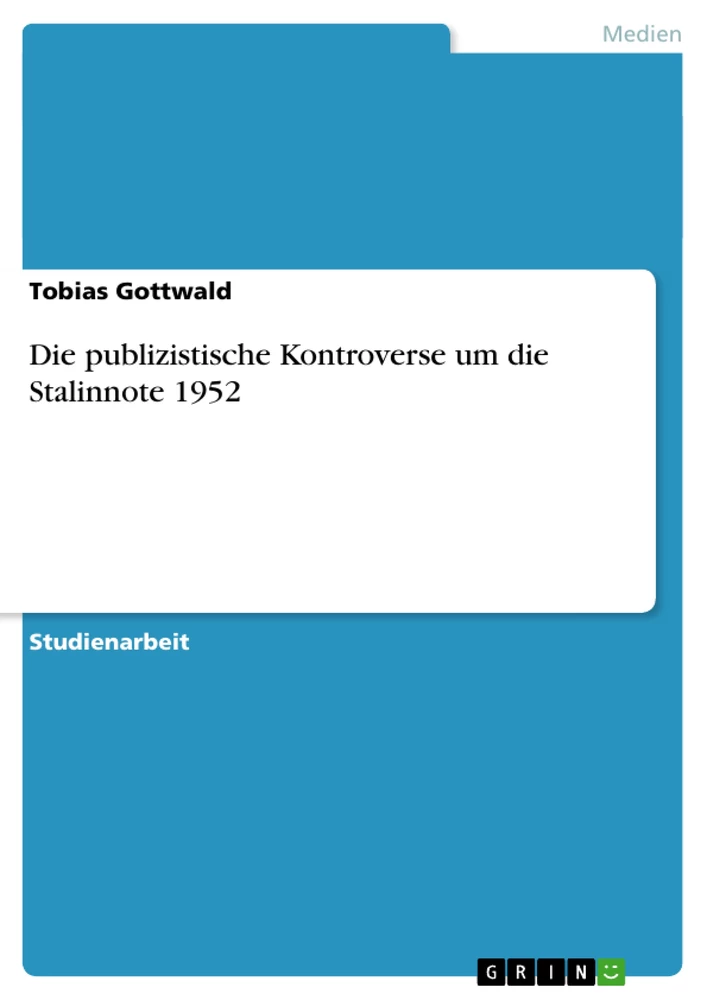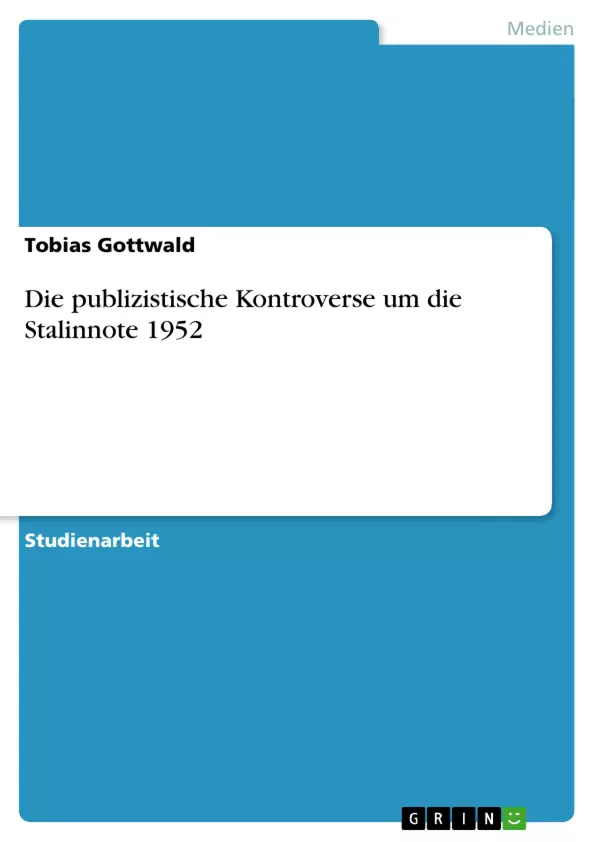Am 10. März 1952 unterbreitete die sowjetische Regierung mittels einer Note den drei westlichen Mächten den Vorschlag, auf einer Viermächtekonferenz über einen Friedensvertrag mit Deutschland zu beraten. Der Note beigefügt war ein Entwurf des Friedensvertrages, der die folgenden politischen Leitsätze enthielt: Deutschland wird die Möglichkeit eröffnet, sich als geeinter, unabhängiger und demokratischer Rechtsstaat zu konstituieren. Der vereinigten Republik werden keinerlei wirtschaftliche Beschränkungen auferlegt, und sie erhält das Recht, nationale Streitkräfte zur Landesverteidigung und eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen. Ferner sichern die Besatzungsmächte zu, erritorium abzuziehen. Dafür soll sich der neue Staat verpflichten, kein Militärbündnis gegen eine der Siegermächte einzugehen und die Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze anzuerkennen. Die westlichen Regierungen und Bonn standen diesen Vorstellungen von Grund auf ablehnend gegenüber. Dennoch entspann sich ein bis zum September des Jahres dauernder Austausch diplomatischer Noten: Vier sowjetische Noten1 und ebenso viele westliche Antwortschreiben2 sollten zur Erörterung und Präzisierung des Kreml- Vorschlages beitragen. Es sollte sich zeigen, daß sich die beiden Blöcke nicht auf Voraussetzungen einigen konnten, unter denen ein Friedensvertrag und die Wiedervereinigung Deutschlands auf einer Konferenz hätten beraten werden können. Der Westen forderte die Abhaltung freier, international kontrollierter Wahlen als conditio sine qua non einer gesamtdeutschen Regierungsbildung. Die Sowjetunion hingegen beharrte im Verlauf des Notenwechsels stets auf der umgekehrten Reihenfolge und ließ zudem unklar, ob sie überhaupt für freie Wahlen eintrete.3 [...] 1 10.03.; 09.04.;24.05.;23.08. 2 25.3.,13.05., 10.07., 23.09. 3 Vgl. Kiefer (1989), S. 56.
Inhaltsverzeichnis
- I1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Zum historischer Kontext der sowjetischen Deutschland-Note vom 10. März 1952.
- 2.2. Friedensofferte oder Danaergeschenk?
- 2.2.1. Zur im Grundsatz positiven Rezeption
- I. Der Spiegel
- II. Sueddeutsche Zeitung
- 2.2.2. Zur im Grundsatz negativen Rezeption
- I. Frankfurter Allgemeine Zeitung
- II. Die ZEIT
- III. Frankfurter Rundschau
- IV. Die Welt
- 2.2.1. Zur im Grundsatz positiven Rezeption
- 3. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die publizistische Kontroverse um die sowjetischen Vorschläge zur Deutschlandpolitik im Jahr 1952, insbesondere die Reaktion der wichtigsten westdeutschen Medien auf die sogenannte „Stalin-Note“ vom 10. März 1952.
- Analyse der Reaktionen der westdeutschen Publizistik auf die sowjetischen Vorschläge.
- Untersuchung der Argumente und Thesen, mit denen die sowjetischen Vorschläge begrüßt oder abgelehnt wurden.
- Bewertung der sowjetischen Vorschläge als Friedensofferte oder als strategisches Manöver.
- Einordnung der sowjetischen Vorschläge in den historischen Kontext der deutschen Teilung und des Kalten Krieges.
- Analyse der journalistischen Kommentierung der strikt ablehnenden Haltung der Bundesregierung unter Konrad Adenauer.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext der sowjetischen Deutschland-Note vom 10. März 1952, insbesondere die Zuspitzung des Ost-West-Konflikts im Zuge des Koreakrieges und die forcierte Westintegration der Bundesrepublik unter Adenauer.
Der Hauptteil widmet sich der Analyse der publizistischen Auseinandersetzung um die sowjetischen Vorschläge. Er untersucht die unterschiedlichen Perspektiven der wichtigsten westdeutschen Medien, sowohl derjenigen, die die Vorschläge grundsätzlich positiv bewerteten (z.B. Der Spiegel, Sueddeutsche Zeitung), als auch derjenigen, die sie ablehnten (z.B. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die ZEIT, Frankfurter Rundschau, Die Welt). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der Argumente und Thesen, die zur Begründung der jeweiligen Positionen herangezogen wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des Kalten Krieges, insbesondere der deutschen Frage und der sowjetischen Deutschlandpolitik. Im Fokus stehen die „Stalin-Note“ vom 10. März 1952, die publizistische Kontroverse um die sowjetischen Vorschläge zur Wiedervereinigung Deutschlands, die Rolle der westdeutschen Medien in der öffentlichen Debatte, die Haltung der Bundesregierung unter Konrad Adenauer und die innenpolitische Debatte um die Außenpolitik der Bundesrepublik. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Friedensvertrag, Deutschlandpolitik, Kalter Krieg, Westintegration, Wiedervereinigung, Adenauer, Stalin-Note, Medienanalyse, Publizistik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Inhalt der Stalinnote vom 10. März 1952?
Stalin schlug einen Friedensvertrag für ein geeintes, neutrales Deutschland mit eigenen Streitkräften vor, unter Anerkennung der Oder-Neiße-Linie.
Wie reagierte die Bundesregierung unter Adenauer auf die Note?
Adenauer lehnte die Note strikt ab, da er die Westintegration der Bundesrepublik priorisierte und den Vorschlag als Störmanöver ansah.
Welche Medien bewerteten die Stalinnote eher positiv?
Der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ gehörten zu den Publikationen, die den Vorschlag als Chance für eine Wiedervereinigung sahen.
Welche Zeitungen standen der Stalinnote skeptisch gegenüber?
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Die ZEIT“, die „Frankfurter Rundschau“ und „Die Welt“ äußerten sich im Grundsatz negativ oder ablehnend.
Was forderte der Westen als Bedingung für Verhandlungen?
Der Westen forderte freie, international kontrollierte Wahlen in ganz Deutschland als absolute Voraussetzung (conditio sine qua non) für eine Regierungsbildung.
- Quote paper
- Tobias Gottwald (Author), 2003, Die publizistische Kontroverse um die Stalinnote 1952, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31232