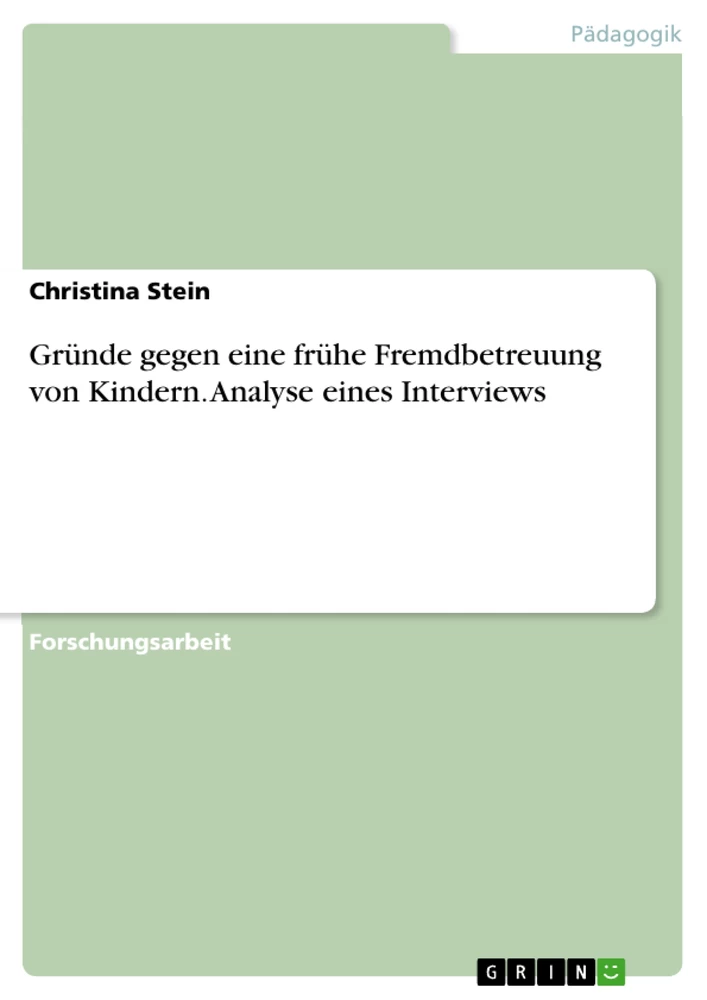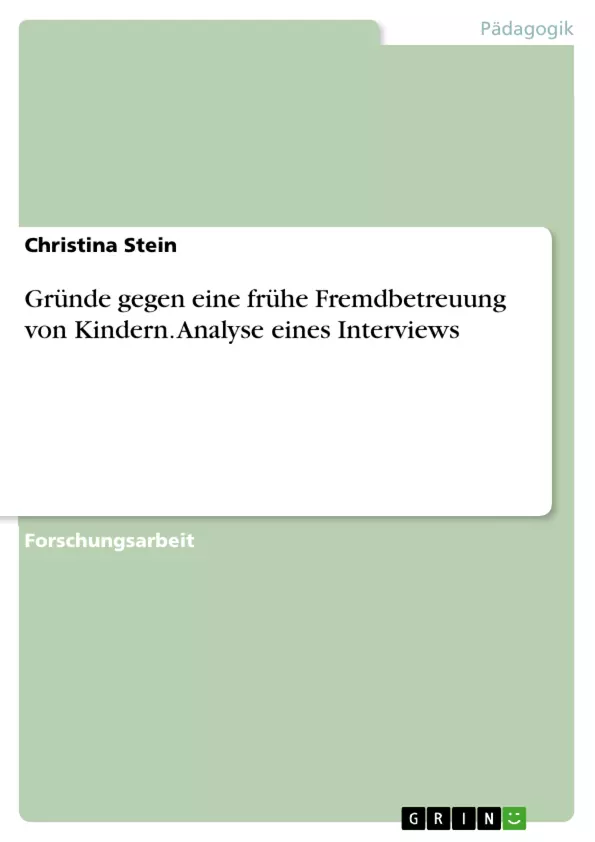Die „frühe Fremdbetreuung“ ist in Deutschland schon immer ein kritisches Thema gewesen. Während ein Kindergartenaufenthalt als erforderlich und wertvoll geachtet wird, gelten Krippen oder Horte für Kinder unter drei Jahren als umstritten. Ob eine außerhäusliche Betreuung der Entwicklung des Kindes schadet, wird auch heute noch kontrovers diskutiert. Da sich auch die Wissenschaftler und Experten nicht immer einig sind, fällt es werdenden Eltern und denen, die es schon sind, umso schwerer, eine Entscheidung für oder gegen eine frühe Fremdbetreuung zu treffen.
Da es im persönlichen Umfeld viele Eltern gibt, die ihr Kleinkind auf keinen Fall in eine Krippe oder in eine Kindertagesstätte abgeben würden, ist die Motivation groß, die Beweggründe dafür in Erfahrung zu bringen. Die empirische Arbeit macht es sich daher zum Ziel – mit Hilfe eines teilstandardisierten narrativen Interviews mit einer Mutter einer einjährigen Tochter – vor allem die Beweggründe und zentralen Motive gegen eine frühe Fremdbetreuung zu erfahren. Die Forschungsfrage für die vorliegende Arbeit lautet somit: Aus welchen Gründen gibt eine Mutter ihre Tochter nicht in die frühe Fremdbetreuung ab?
Im Folgenden soll zunächst der aktuelle Forschungsstand zur Nutzung der Fremdbetreuung dargestellt und auf die erwiesenen Einflüsse der Krippe auf das Kind, eingegangen werden. Der Hauptteil befasst sich einerseits mit dem methodischen Vorgehen des Interviews – der Erhebungsinstrumente, der Fallauswahl und des Auswertungsverfahrens und andererseits mit dem Empirie-Teil. Dieser zeigt, anhand von zentraler Motive, die wichtigsten Ergebnisse unter Einbezug der Theorie auf und nimmt den größten Part dieser Arbeit ein. Abschließend soll der Schlussteil die Forschungsfrage beantworten und einen kurzen Ausblick auf weitere Studien geben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Methodisches Vorgehen
- Was ist qualitative Forschung?
- Selbstreflexion
- Erhebungsinstrumente
- Fallauswahl, Zugang zum Feld und Durchführung
- Auswertungsverfahren
- Grounded Theory
- Das integrative Basisverfahren
- Empirieteil: Darstellung der Ergebnisse anhand zentraler Motive
- Zentrales Motiv: Ungenügender Betreuungsschlüssel
- Zentrales Motiv: Kinder gehören zu ihren Müttern
- Zentrales Motiv: Familiäre Beeinflussung
- Zentrales Motiv: Überforderung für das Kind
- Zentrales Motiv: Alter des Kindes
- Zentrales Motiv: Emotionale Bindung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese empirische Forschungsarbeit setzt sich zum Ziel, die Beweggründe von Müttern zu verstehen, die sich gegen die frühe Fremdbetreuung ihrer Kinder entscheiden. Im Fokus steht dabei die Analyse eines narrativen Interviews mit einer Mutter, deren einjährige Tochter keine außerhäusliche Betreuung erhält.
- Unterschiedliche Auffassungen zur optimalen Betreuung von Kleinkindern
- Einfluss von Betreuungsschlüssel und familiärem Umfeld auf die Entscheidung der Eltern
- Die Bedeutung von Bindung und emotionaler Sicherheit für die Entwicklung von Kleinkindern
- Die Rolle der Familie und der eigenen Erfahrungen mit Fremdbetreuung
- Sichtweisen von Müttern über die Anforderungen und Herausforderungen der frühen Fremdbetreuung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die frühe Fremdbetreuung in Deutschland dar und erläutert den Hintergrund der Forschungsfrage. Der theoretische Teil beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs über den Einfluss von Krippen auf die Entwicklung von Kleinkindern. Der methodische Teil beschreibt die qualitative Forschungsmethode des narrativen Interviews und die angewendeten Auswertungsverfahren. Der Empirieteil analysiert das Interview und identifiziert zentrale Motive, die gegen eine frühe Fremdbetreuung sprechen, wie z.B. einen unzureichenden Betreuungsschlüssel, die Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung, die familiäre Prägung und die altersbedingte Überforderung von Kleinkindern in der Krippe.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der frühen Fremdbetreuung, der Mutter-Kind-Bindung, des Betreuungsschlüssels, der familiären Beeinflussung, der Überforderung von Kleinkindern und dem Einfluss des Alters auf die Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Thema der frühen Fremdbetreuung in Deutschland umstritten?
Während Kindergärten akzeptiert sind, gibt es kontreverse Diskussionen darüber, ob die Betreuung in Krippen für Kinder unter drei Jahren der Entwicklung schaden könnte.
Was war das Ziel des narrativen Interviews in dieser Studie?
Das Ziel war es, die persönlichen Beweggründe und zentralen Motive einer Mutter zu verstehen, die sich gegen eine frühe außerhäusliche Betreuung ihrer einjährigen Tochter entschieden hat.
Welche zentralen Motive gegen die Fremdbetreuung wurden identifiziert?
Wichtige Gründe sind ein ungenügender Betreuungsschlüssel, die Überzeugung, dass Kinder zu ihren Müttern gehören, familiäre Prägung, Angst vor Überforderung des Kindes und die Bedeutung der emotionalen Bindung.
Welche Rolle spielt der Betreuungsschlüssel bei der Entscheidung?
Ein unzureichender Betreuungsschlüssel wird als wesentlicher Faktor angesehen, der gegen eine qualitativ hochwertige Betreuung in einer Krippe spricht.
Welche Forschungsmethodik wurde in der Arbeit angewandt?
Es wurde ein qualitativer Ansatz mit einem teilstandardisierten narrativen Interview gewählt, ausgewertet nach Methoden der Grounded Theory und dem integrativen Basisverfahren.
Wie beeinflusst das Alter des Kindes die Einstellung der Eltern?
Viele Eltern empfinden Kinder unter drei Jahren als noch zu jung für die Gruppendynamik einer Krippe und fürchten eine emotionale Überlastung.
- Quote paper
- Christina Stein (Author), 2015, Gründe gegen eine frühe Fremdbetreuung von Kindern. Analyse eines Interviews, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312436