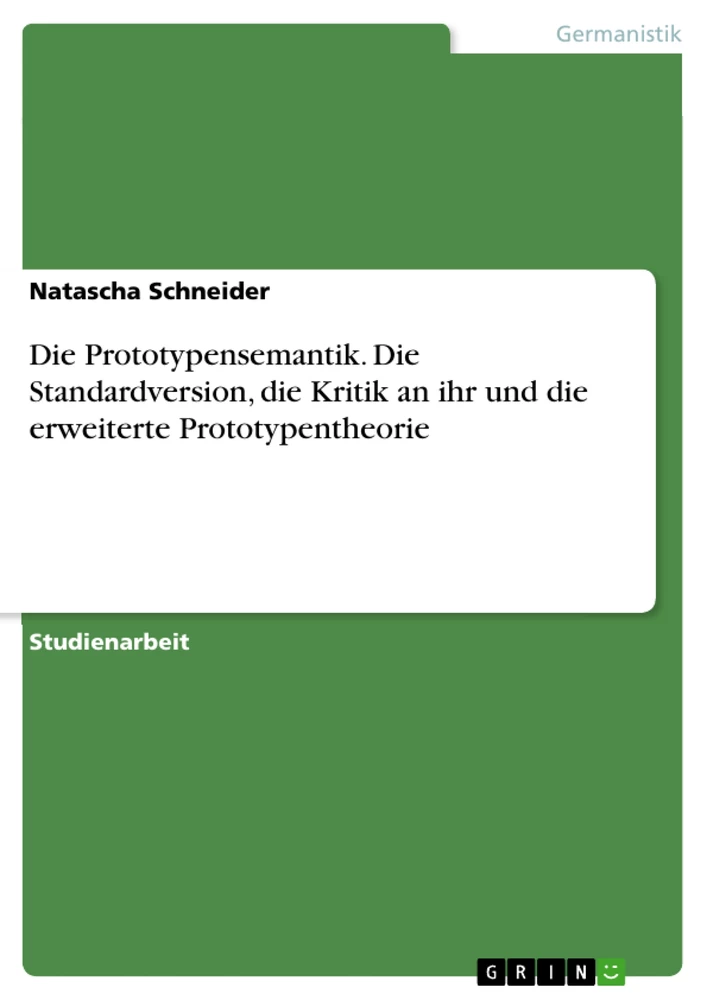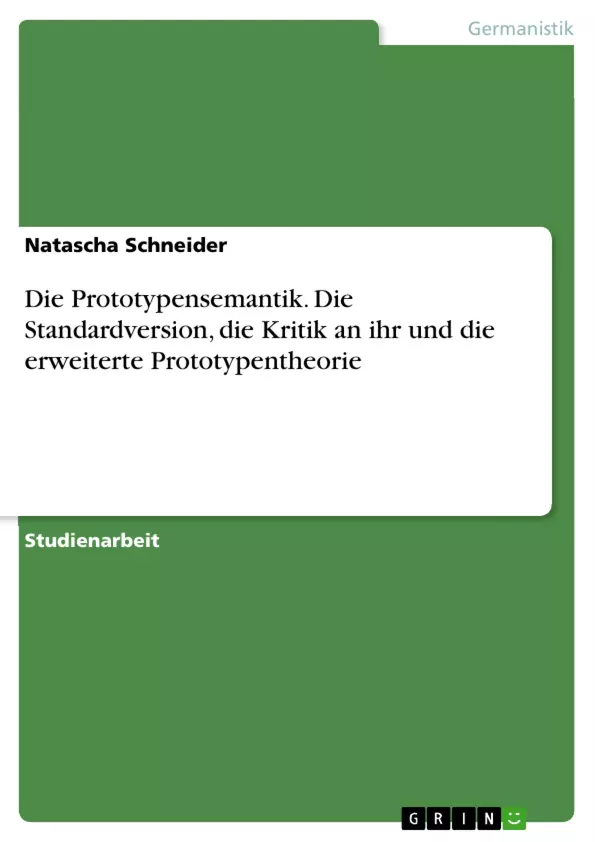In dieser Arbeit möchte ich zunächst die charakteristischen Merkmale der Standardversion der Prototypentheorie darstellen. Hierbei wird zwischen der horizontalen und der vertikalen Ebene unterschieden. Die horizontale Ebene umfasst die innere Struktur der Kategorien, während sich die vertikale Ebene mit der interkategoriellen Strukturierung befasst. Im Anschluss daran möchte ich die Schwächen der Prototypentheorie herausarbeiten. Folglich werde ich dann die erweiterte Prototypentheorie vorstellen. Abschließend möchte ich die wesentlichen Ergebnisse der Prototypentheorie kurz zusammenfassen.
Menschen haben die Fähigkeit, Dinge aus ihrer Umwelt in verschiedene Kategorien einzuordnen. Dies geschieht bei allen Handlungen, die wir ausüben. Ohne die Kategorisierungsfähigkeit müsste unser Gehirn jede Information, die wir erhalten, neu wahrnehmen. Das würde zu einer Unstrukturiertheit führen. »Es ist schwer vorstellbar, wie unser Verhalten in unserer Umgebung sowohl in psychischer als auch in sozialer und intellektueller Hinsicht aussähe ohne die Existenz von Kategorien, wenn also jede irgendwie wahrgenommene Entität einzigartig bliebe.«
Interessant ist in diesem Zusammenhang zu erfahren, nach welchen Kriterien der Kategorisierungsprozess erfolgt, beziehungsweise nach welchen Prinzipien verschiedene Entitäten zusammen mit anderen einer Kategorie zugeordnet werden.
Bei der Annäherung an diese Fragen, spielt die Entwicklung der Prototypentheorie eine entscheidende Rolle. Die Standardversion der Prototypentheorie, die in den 1970er Jahren von Eleanor Rosch und einigen Mitarbeitern entwickelt wurde, versucht anhand empirischer Befunde Aufschluss über die menschliche Kognition zu geben. Ausgangspunkt dieser Theorie bildete das Modell der notwendigen und hinreichenden Bedingungen (NHB-Modell), in dem eine Entität bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um einer Kategorie zugeordnet werden zu können. Das Prinzip der Binarität (Entität erfüllt eine Bedingung, oder erfüllt sie nicht), wie es in diesem traditionellen Modell der Kategorisierung vorgegeben ist, trifft jedoch nicht immer zu. Nicht alle Kategorien weisen scharfe Grenzen auf.
Es zeigt sich also, dass dieses Modell einige Unzulänglichkeiten aufweist, die Eleanor Rosch mittels der Prototypentheorie erklären und entsprechend beheben möchte. Demnach stellt die Prototypentheorie zur Merkmalstheorie eine Ergänzung und keine direkte Alternative dar.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Allgemein
- Die Standardversion der Prototypensemantik
- Der Prototyp
- Graduelle Zugehörigkeit und unscharfe Grenzen
- Heckenausdrücke/Hedges
- Familienähnlichkeit
- Ähnlichkeit zum Prototyp und cue validitiy
- Die interkategorielle hierarchische Struktur
- Kritik an der Standardversion
- Die erweiterte Prototypentheorie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Prototypentheorie, die eine Alternative zum traditionellen Modell der notwendigen und hinreichenden Bedingungen (NHB-Modell) darstellt. Sie untersucht die charakteristischen Merkmale der Standardversion, ihre Schwächen sowie die Entwicklung der erweiterten Prototypentheorie.
- Der Prototypenbegriff und seine Bedeutung für die Kategorisierung
- Graduelle Zugehörigkeit und unscharfe Grenzen von Kategorien
- Das Konzept der Familienähnlichkeit und seine Rolle in der Kategorisierung
- Die hierarchische Struktur von Kategorien und die Bedeutung der Basisebene
- Kritikpunkte an der Standardversion der Prototypentheorie und die Entwicklung der erweiterten Version
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in die Thematik der Kategorisierung und beleuchtet die Notwendigkeit von Kategorien für die menschliche Kognition.
Das zweite Kapitel behandelt die Standardversion der Prototypentheorie. Es werden der Prototypenbegriff, die graduelle Zugehörigkeit, die Familienähnlichkeit sowie die hierarchische Struktur von Kategorien erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Kritik an der Standardversion der Prototypentheorie. Es werden verschiedene Kritikpunkte hinsichtlich der Grenzen von Kategorien, der Familienähnlichkeitskonzeption und der hierarchischen Struktur erörtert.
Das vierte Kapitel präsentiert die erweiterte Prototypentheorie. Es wird deutlich, wie die Familienähnlichkeitskonzeption in der erweiterten Version eine zentrale Rolle spielt und wie diese die Schwächen der Standardversion zu beheben versucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Prototypentheorie, Kategorisierung, Familienähnlichkeit, cue validity, Basisebene, NHB-Modell, graduelle Zugehörigkeit, unscharfe Grenzen, Kritik, erweiterte Prototypentheorie, polysemie.
- Arbeit zitieren
- Natascha Schneider (Autor:in), 2008, Die Prototypensemantik. Die Standardversion, die Kritik an ihr und die erweiterte Prototypentheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312502