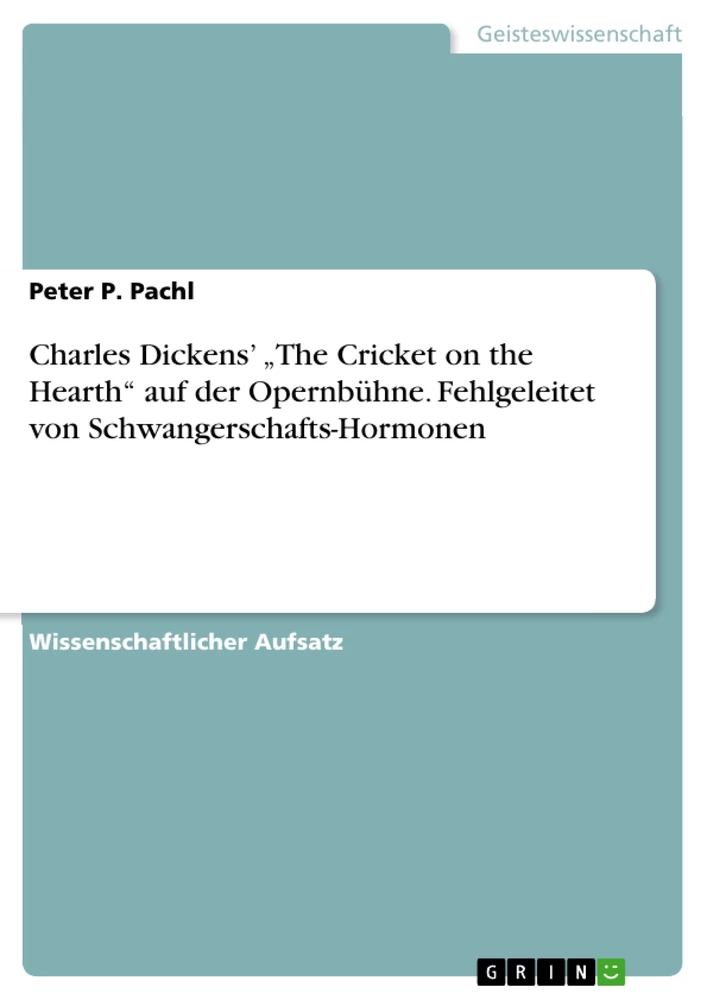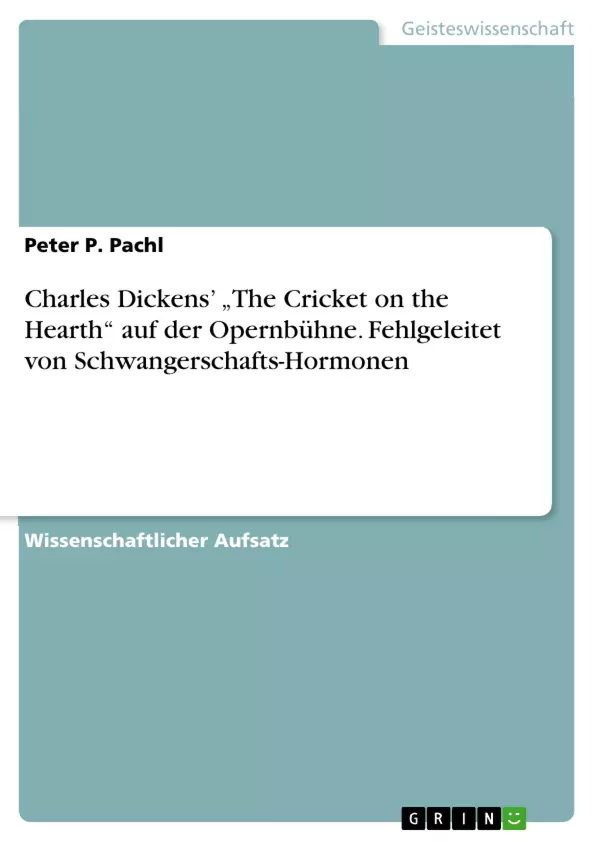Wie Alexander von Zemlinsky (1871 – 1942), war auch der gut eine Generation ältere Komponist Carl Goldmark (1830 – 1915) mit seinen Opernbeiträgen zwar nicht seiner Zeit voraus, aber jeweils auf der Höhe der Zeit.
So erlebte Goldmarks „Königin von Saba“ als Exotik-Beitrag in Konkurrenz zu Meyerbeers „Afrikanerin“ 1876 ihre Uraufführung. 1886, vier Jahre nach der Uraufführung von Wagners „Parsifal“, kam Goldmarks „Merlin“ heraus. Der Blüte der Märchenoper am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, die durch Humperdincks „Hänsel und Gretel“ ausgelöst wurde, folgte Goldmark mit einer Opernversion von Dickens’ „Das Heimchen am Herd“, die 1896 uraufgeführt wurde. Die Strömung des Verismo nahm Goldmark 1897 mit „Der Fremdling“ und 1899 mit „Die Kriegsgefangene“ auf und gipfelte in der Nachfolge von Verdis „Falstaff“ und parallel zu Strauss’ „Salome“ und „Elektra“ mit den Literaturopern „Götz von Berlichingen“ nach Goethe, uraufgeführt 1902, und „Ein Wintermärchen“ nach Shakespeare, uraufgeführt 1908.
Tatsächlich hatte Engelbert Humperdinck als Wagner-Schüler (und Wagner-Lehrer, nämlich der Kompositionslehrer Siegfried Wagners) mit der durchkomponierten Opernfassung seines zuvor als Spiel mit einzelnen Gesangsnummern konzipierten Musik-Märchens „Hänsel und Gretel“ eine Lawine losgetreten.
Folgt man den leider unvollendet gebliebenen Memoiren von Carl Goldmark, welcher darin leider nur noch sehr kurz auf seine zweite Oper zu sprechen kommt, so erfolgte die Empfehlung durch seinen Librettisten ein halbes Jahr nach der Uraufführung von Humperdincks „Hänsel und Gretel“:
„Anfang des Jahres 1894 wurde ich von Dr. A. M. Willner auf das ‚Heimchen am Herde’ von Dickens aufmerksam gemacht; es war, was ich suchte: ein Kreis einfacher, glücklicher Menschen am traulichen Herd, in Liebe verbunden, durch eine kleine, aufregende Handlung vorübergehend gestört, aber bald wieder gelöst, das Ganze vom Zauber des Märchens umflossen.“
In der Tat ist das „Heimchen am Herd“ keine klassische Märchenoper, auch wenn es als solche rezipiert wurde, wozu der Komponist mit seiner Klassifizierung „vom Zauber des Märchens umflossen“ beigetragen hat. Eher handelt es sich bei Goldmarks zweitem Bühnenwerk bereits um eine Literaturoper.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Rezeption
- Charles Dickens
- Die Handlung der Novelle:
- Erstes Zirpen
- Zweites Zirpen
- Drittes Zirpen
- Die Komposition
- Vorbilder
- Auf dem Theater
- Rezeption
- Szenische Rezeption: Vom Heimchen zum Seelchen
- Probleme mit dem Titel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Text befasst sich mit der Oper "Das Heimchen am Herd" von Carl Goldmark und stellt diese in den Kontext der Operngeschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts dar.
- Die Entstehung der Oper im Kontext der Märchenoper
- Die Rezeption der Oper und ihr Erfolg auf den Bühnen der Welt
- Die Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage "The Cricket on the Hearth" von Charles Dickens
- Die musikalische und szenische Gestaltung der Oper
- Die Problematik des Titels und die Metapher "Heimchen am Herd"
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt Carl Goldmark und seine Oper "Das Heimchen am Herd" im Kontext der Entwicklung der Oper im ausgehenden 19. Jahrhundert dar. Es wird die Entstehung der Gattung der Märchenoper sowie die musikalischen Strömungen der Zeit, wie der Verismo, beschrieben.
- Rezeption: Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeption der Oper und ihren Erfolg auf der Bühne. Es wird auf die Inspiration durch Humperdincks "Hänsel und Gretel" eingegangen sowie die Kritik am Werk von Goldmark, insbesondere die antisemitischen Untertöne in der Kritik von Julius Kapp.
- Charles Dickens: Dieser Abschnitt befasst sich mit der literarischen Vorlage von Goldmarks Oper, der Novelle "The Cricket on the Hearth" von Charles Dickens. Die Handlung der Novelle wird knapp zusammengefasst, wobei die drei "Chirps" oder "Zirpen" genannten Kapitel separat betrachtet werden.
- Die Komposition: Hier wird die musikalische Gestaltung der Oper detailliert beschrieben. Es werden die einzelnen Akte, ihre musikalischen Charakteristika und die Rolle der Titelfigur "Heimchen" beleuchtet. Die Analyse der Musik umfasst die verwendeten Tonarten, Tempi und die musikalischen Motive, die die Handlung und die Charaktere unterstützen.
- Vorbilder: In diesem Kapitel werden die musikalischen Vorbilder von Goldmark bei der Komposition seiner Oper betrachtet. Es werden Verbindungen zu Werken von Richard Wagner, Adolphe Adam und anderen Komponisten hergestellt, die Goldmark als Inspiration dienten. Die Einordnung in die musikalische Tradition der Zeit wird deutlich.
- Auf dem Theater: Der Fokus liegt auf der szenischen Umsetzung der Oper. Es werden die Bühnenbildentwürfe, die Kostüme und die musikalischen Aspekte der Uraufführung in Wien 1896 vorgestellt. Die Relevanz der Dekorationen für die Inszenierung und die relativ geringen Ansprüche an das Bühnenbild werden hervorgehoben.
- Rezeption: Der Erfolg von Goldmarks Oper "Das Heimchen am Herd" wird in diesem Abschnitt nochmals beleuchtet. Es werden die Aufführungszahlen und die Einordnung der Oper in die Kategorie der Märchenopern hervorgehoben. Die unterschiedlichen Interpretationen der Oper und die Weiterentwicklung des Begriffs "Heimchen am Herd" werden diskutiert.
- Szenische Rezeption: Vom Heimchen zum Seelchen: In diesem Kapitel wird ein Vergleich zwischen Goldmarks "Heimchen am Herd" und Siegfried Wagners Oper "Der Kobold" gezogen. Es wird die Relevanz der Szenen im 2. Akt von Goldmarks Oper für Wagners "Der Kobold" hinsichtlich der Erotik in beiden Werken betrachtet.
- Probleme mit dem Titel: Der Abschnitt befasst sich mit der Metapher "Heimchen am Herd" und ihrer Relevanz in der gesellschaftlichen Diskussion über die Rolle der Frau. Es wird die Verwendung des Begriffs in der feministischen Debatte der 1960er Jahre und die aktuelle Verwendung in der öffentlichen Diskussion beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: "Märchenoper", "Carl Goldmark", "Das Heimchen am Herd", "Charles Dickens", "The Cricket on the Hearth", "Musiktheater", "Rezeption", "Bühnenbild", "Libretto", "Szenische Gestaltung", "Heimchen am Herd", "Metapher", "Emanzipation".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Carl Goldmarks Oper „Das Heimchen am Herd“?
Die Oper basiert auf einer Novelle von Charles Dickens und erzählt eine Geschichte über Liebe und das häusliche Glück einfacher Menschen, umhüllt vom Zauber eines Märchens.
In welchem musikhistorischen Kontext entstand das Werk?
Das Werk entstand am Ende des 19. Jahrhunderts während der Blütezeit der Märchenoper, ausgelöst durch den Erfolg von Humperdincks „Hänsel und Gretel“.
Ist „Das Heimchen am Herd“ eine reine Märchenoper?
Obwohl sie oft so rezipiert wurde, klassifiziert der Text sie eher als Literaturoper, da sie eine komplexe literarische Vorlage von Dickens verarbeitet.
Was bedeutet die Metapher „Heimchen am Herd“ heute?
Der Begriff wird heute oft kritisch in feministischen Debatten verwendet, um ein veraltetes, auf das Häusliche beschränktes Frauenbild zu beschreiben.
Wie wurde die Oper bei ihrer Uraufführung aufgenommen?
Die Oper wurde 1896 in Wien uraufgeführt und war sehr erfolgreich, wobei sie für ihre stimmungsvolle musikalische Gestaltung und das trauliche Sujet gelobt wurde.
- Citation du texte
- Prof. Dr. Peter P. Pachl (Auteur), 2015, Charles Dickens’ „The Cricket on the Hearth“ auf der Opernbühne. Fehlgeleitet von Schwangerschafts-Hormonen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312630