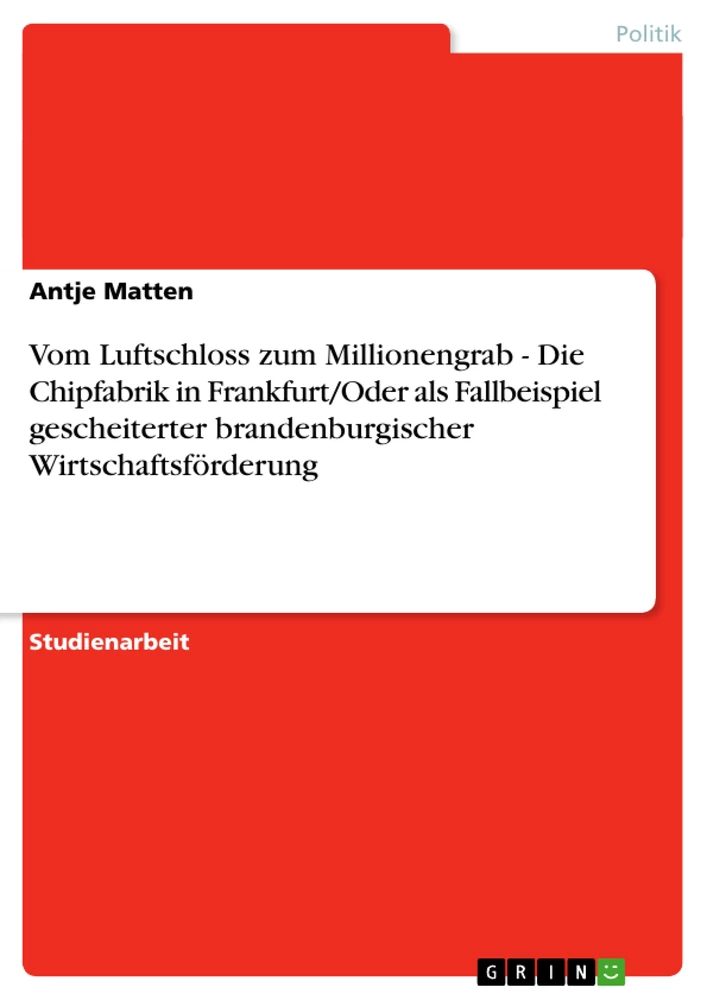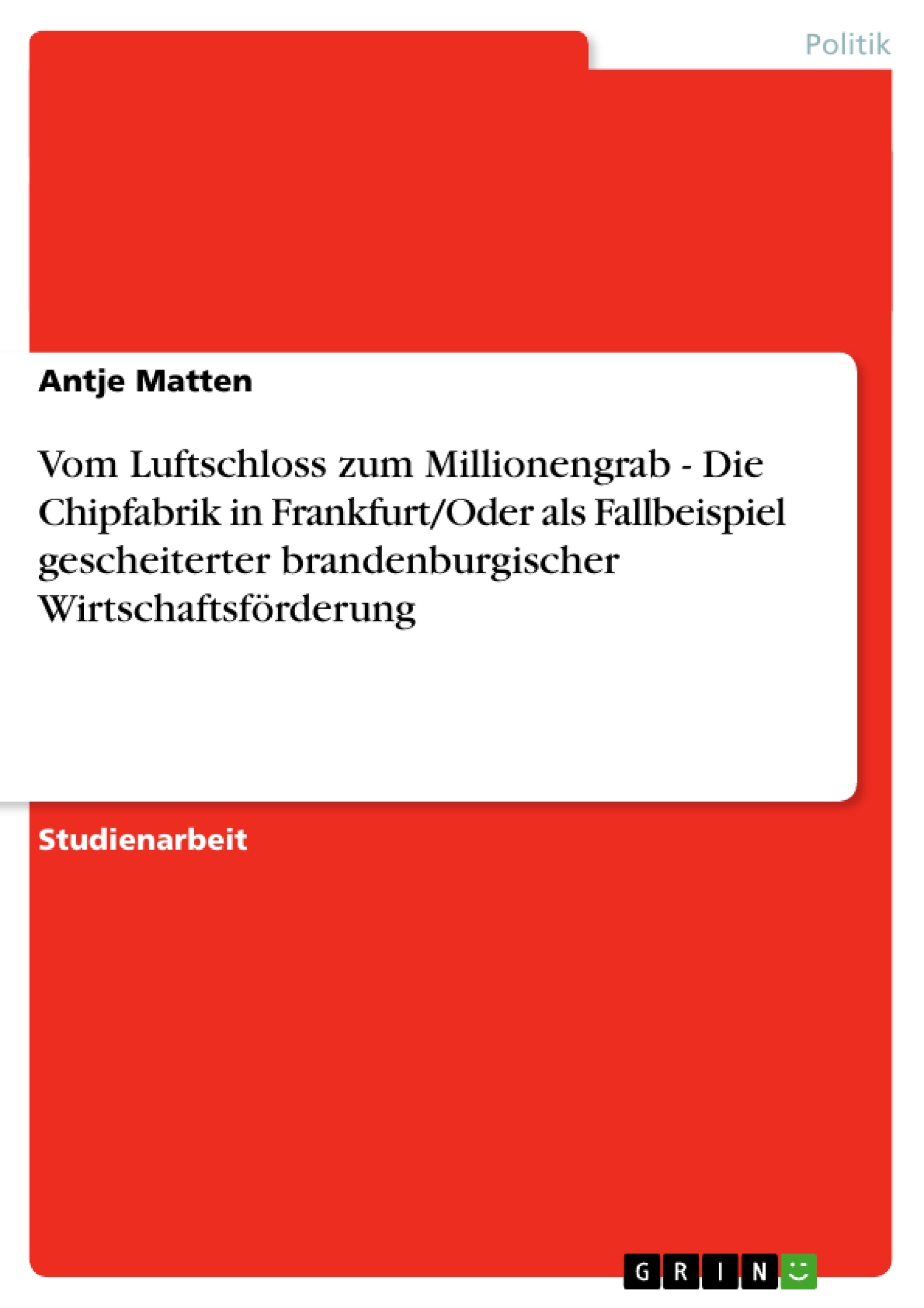Thema der Arbeit ist die gescheiterte Chipfabrik in Frankfurt/Oder, als ein Fallbeispiel für regionale Wirtschaftsförderungspolitik. Ziel der Arbeit ist es die Beteiligten und ihre Ziele vorzustellen und Kritikpunkte am Projektverlauf aufzuzeigen. Den Abschluss der Arbeit bildet die Zusammenfassung der Folgen für die Beteiligten und Schlussfolgerungen bezüglich der brandenburgischen Wirtschaftsförderungspolitik.
Die regelmäßigen Schlagzeilen zur Chipfabrik und die unklaren Informationen seit Projektstart waren Anlass, den Fall zu recherchieren. Gerade das Beispiel eines gescheiterten Wirtschaftsförderungsprojektes kann allgemeine Schwierigkeiten der regionalen brandenburgischen Wirtschaftsförderung aufzeigen.
Die Informationen sind der Fachpresse, Regionalpresse, Presseinformationen und Materialien, die das Büro von Dr. Esther Schröder (MdL) zur Verfügung gestellt hat, zusammen getragen. Das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg, die Stadt Frankfurt/Oder und die Deutsche Bank haben die Möglichkeit einer Stellungnahme abgelehnt.
Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Darstellung des Falls, da längst nicht alle Informationen öffentlich zugänglich sind und der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses noch aussteht. Insbesondere unternehmensinterne Informationen und nicht-öffentliche Informationen der Landesregierung könnten bei späterer Veröffentlichung zu anderen Schlussfolgerungen führen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Projekt Chipfabrik in Frankfurt/Oder
- Die Akteure
- Communicant Semiconductor Technologies AG (CST)
- Das Institut für Halbleiterphysik Frankfurt/Oder (IHP)
- Das Emirat Dubai
- Intel Corporation
- Das Land Brandenburg
- Die Banken
- M+W Zander/Jenoptik AG
- Warum ist das Projekt gescheitert?
- Unübersichtliche finanzielle Verflechtungen
- Kritik am brandenburgischen Wirtschaftsministerium
- Nach dem Scheitern der Chipfabrik
- Communicant Semiconductor Technologies AG
- Der Untersuchungsausschuss
- Folgen für das Land Brandenburg
- Die Stadt Frankfurt/Oder nach der „Fabrikpleite“
- Folgen für das Emirat Dubai?
- Folgen für Intel Corporation?
- Die Zukunft des Instituts für Halbleiterphysik
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das gescheiterte Projekt der Chipfabrik in Frankfurt/Oder als Fallbeispiel für regionale Wirtschaftsförderungspolitik in Brandenburg. Ziel ist die Darstellung der beteiligten Akteure, ihrer Ziele und die Analyse der Kritikpunkte am Projektverlauf. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Folgen für die Beteiligten und Schlussfolgerungen zur brandenburgischen Wirtschaftsförderungspolitik.
- Analyse der finanziellen Struktur und der beteiligten Akteure des Projekts.
- Bewertung der Rolle des Landes Brandenburg und des Wirtschaftsministeriums.
- Untersuchung der Gründe für das Scheitern des Projekts.
- Auswertung der Folgen des Scheiterns für die beteiligten Parteien.
- Ableitung von Schlussfolgerungen für zukünftige Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert das Scheitern der Chipfabrik in Frankfurt/Oder als Fallbeispiel für die Herausforderungen regionaler Wirtschaftsförderung. Sie untersucht die beteiligten Akteure, deren Ziele und die Kritikpunkte am Projektverlauf. Die Arbeit basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und betont die Grenzen der Analyse aufgrund von Informationsmangel.
Das Projekt Chipfabrik in Frankfurt/Oder: Communicant Semiconductor Technologies (CST) plante die Herstellung hochleistungsfähiger Halbleiterchips. Die 1,3 Milliarden Euro Investition sollte durch Eigenkapital, Fördermittel und Kredite finanziert werden, mit Beteiligungen von Dubai, Brandenburg, Intel und einem Bankenkonsortium. Das Projekt sollte ca. 2000 Arbeitsplätze schaffen und nutzte die vorhandene Expertise in Frankfurt/Oder im Bereich Mikroelektronik. Die Arbeit hebt die potentiellen Vorteile des Standortes Brandenburg hervor, wie qualifiziertes Personal und Förderbedingungen.
Die Akteure: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Akteure des Projekts vor: Communicant Semiconductor Technologies AG (CST) mit wechselnden Führungskräften und deren jeweilige Hintergründe und Motivationen; das Institut für Halbleiterphysik Frankfurt/Oder (IHP) mit seinen Patenten auf Silizium-Germanium-Kohlenstoff-Technologie; das Emirat Dubai als Investor; Intel Corporation als Partner; das Land Brandenburg als Förderer; die beteiligten Banken und M+W Zander/Jenoptik AG. Die Interaktionen und Beziehungen zwischen diesen Akteuren werden beleuchtet.
Warum ist das Projekt gescheitert?: Dieses Kapitel fokussiert auf die Ursachen des Scheiterns. Es analysiert unübersichtliche finanzielle Verflechtungen und übt Kritik am brandenburgischen Wirtschaftsministerium. Die mangelnde Transparenz und die unzureichende Planung werden als wesentliche Faktoren des Misserfolgs identifiziert. Die Rolle der einzelnen Akteure und deren Beitrag zum Scheitern werden detailliert untersucht.
Nach dem Scheitern der Chipfabrik: Das Kapitel beschreibt die Folgen des Scheiterns für alle beteiligten Parteien. Es behandelt das Schicksal der CST, die Arbeit des Untersuchungsausschusses, die Auswirkungen auf Brandenburg und Frankfurt/Oder, sowie die potenziellen Konsequenzen für Dubai und Intel. Die langfristigen Auswirkungen auf das IHP werden ebenfalls beleuchtet. Die Kapitel bieten einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Folgen des Projekt-Zusammenbruchs.
Schlüsselwörter
Chipfabrik, Frankfurt/Oder, Wirtschaftsförderung, Brandenburg, Communicant Semiconductor Technologies AG, Institut für Halbleiterphysik (IHP), Emirat Dubai, Intel, Finanzierungsmodelle, Projektmanagement, regionale Entwicklung, Wirtschaftspolitik, Scheitern, Untersuchungsausschuss.
FAQ: Das gescheiterte Projekt der Chipfabrik in Frankfurt/Oder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das gescheiterte Projekt einer Chipfabrik in Frankfurt/Oder. Sie dient als Fallstudie zur regionalen Wirtschaftsförderungspolitik in Brandenburg und untersucht die beteiligten Akteure, deren Ziele und die Gründe für das Scheitern des Projekts.
Welche Akteure waren an dem Projekt beteiligt?
Zu den wichtigsten Akteuren gehörten die Communicant Semiconductor Technologies AG (CST), das Institut für Halbleiterphysik Frankfurt/Oder (IHP), das Emirat Dubai, Intel Corporation, das Land Brandenburg, beteiligte Banken und M+W Zander/Jenoptik AG. Die Arbeit beleuchtet die Interaktionen und Beziehungen zwischen diesen Akteuren.
Was war das Ziel des Chipfabrik-Projekts?
Communicant Semiconductor Technologies (CST) plante die Herstellung von hochleistungsfähigen Halbleiterchips. Die Investition von 1,3 Milliarden Euro sollte durch Eigenkapital, Fördermittel und Kredite finanziert werden, mit dem Ziel, ca. 2000 Arbeitsplätze zu schaffen und die Expertise in Frankfurt/Oder im Bereich Mikroelektronik zu nutzen.
Warum ist das Chipfabrik-Projekt gescheitert?
Das Scheitern wird auf unübersichtliche finanzielle Verflechtungen und Kritik am brandenburgischen Wirtschaftsministerium zurückgeführt. Mangelnde Transparenz und unzureichende Planung werden als wesentliche Faktoren identifiziert. Die Arbeit analysiert detailliert die Rolle der einzelnen Akteure und deren Beitrag zum Misserfolg.
Welche Folgen hatte das Scheitern des Projekts?
Das Kapitel "Nach dem Scheitern der Chipfabrik" beschreibt die Folgen für alle Beteiligten: das Schicksal der CST, die Arbeit des Untersuchungsausschusses, die Auswirkungen auf Brandenburg und Frankfurt/Oder sowie potenzielle Konsequenzen für Dubai und Intel. Die langfristigen Auswirkungen auf das IHP werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur brandenburgischen Wirtschaftsförderungspolitik und analysiert die Lehren aus dem Scheitern des Projekts für zukünftige Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Die Arbeit betont die Grenzen der Analyse aufgrund von Informationsmangel.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die finanzielle Struktur und die beteiligten Akteure, bewertet die Rolle Brandenburgs und des Wirtschaftsministeriums, untersucht die Gründe für das Scheitern, wertet die Folgen des Scheiterns aus und leitet Schlussfolgerungen für zukünftige Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Chipfabrik, Frankfurt/Oder, Wirtschaftsförderung, Brandenburg, Communicant Semiconductor Technologies AG, Institut für Halbleiterphysik (IHP), Emirat Dubai, Intel, Finanzierungsmodelle, Projektmanagement, regionale Entwicklung, Wirtschaftspolitik, Scheitern, Untersuchungsausschuss.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Aufgrund von Informationsmangel sind die Grenzen der Analyse jedoch eingeschränkt.
- Citation du texte
- Antje Matten (Auteur), 2004, Vom Luftschloss zum Millionengrab - Die Chipfabrik in Frankfurt/Oder als Fallbeispiel gescheiterter brandenburgischer Wirtschaftsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31309