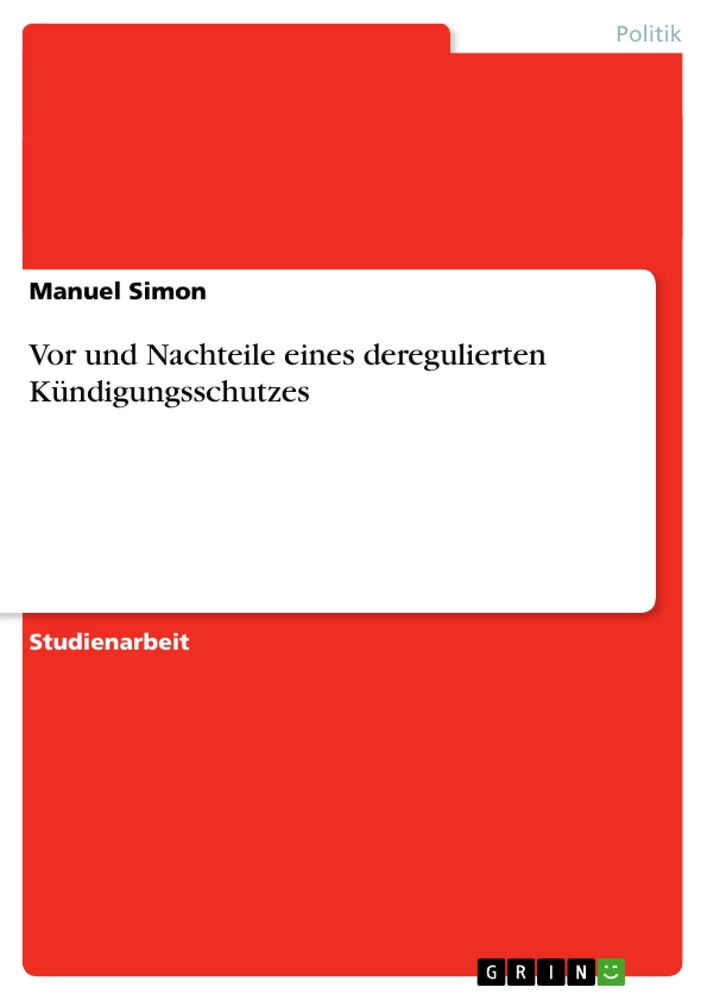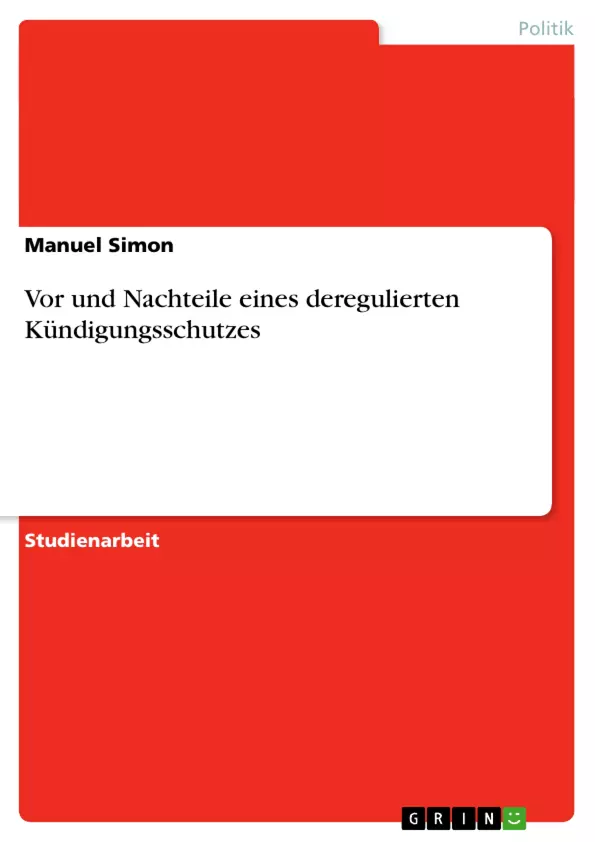Die aktuelle Diskussion über die Deregulierung des gesetzlichen Kündigungsschutzes, ist nur ein Aspekt der Diskussion über die seit Jahren anhaltende Krise am Arbeitsmarkt. Neben den Gestaltungsmöglichkeiten der aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik sind es vor allem die rechtspolitischen Instrumente die angeführt werden, wenn es um mehr Beschäftigung geht.
Dabei kann man sich zum Teil nicht dem Eindruck erwehren, dass die Frage um den Kündigungsschutz im Zeichen einer politischen Instrumentalisierung steht. Die Verfestigung und Ausweitung der Arbeitslosigkeit, trifft mittlerweile auch die bei Wahlen entscheidenden Bevölkerungsschichten im mittleren bis oberen Lohnbereich. Dadurch nimmt der Druck auf die Politik zu, mit aktiven Maßnahmen in den für die Parteien riskanten Kampf gegen die Arbeitslosigkeit einzutreten. Des weiteren werden die oft verwendeten Argumente in einem extrem verkürzten Zusammenhang wiedergegeben, wodurch sich der Eindruck von symbolischer Politik verfestigt. Die Frage nach mehr oder weniger Kündigungsschutz, ist eine die nicht nur in Deutschland diskutiert wird. Andere Länder sind bereits unterschiedliche Wege bei der Realisierung eines deregulierten Kündigungsschutzes gegangen. Beispielhaft werden in dieser Hausarbeit die Länder USA und Dänemark diskutiert, welche beide über einen schwach ausgeprägten Kündigungsschutz verfügen, sich bei den staatlichen Sozialleistungen hingegen extrem unterscheiden. Einleitend, werden einige Facetten die mit dem Kündigungsschutz zusammenhängen beleuchtet. Dies soll den angestrebten Diskussionsrahmen abstecken.
Bei der Beschreibung des Kündigungsschutzes in den USA wird der Schwerpunkt entsprechend auf die vorhandenen Formen und Wirkungen dieser Konzeption gelegt. Der Schwerpunkt beim Dänemark-Teil wird neben dem Kündigungsschutz auf der aktiven Arbeitsmarktpolitik liegen, welche eine zentrale Stellung bei der Deregulierung des Kündigungsschutzes in Dänemark einnimmt. Eine Gegenüberstellung im eigentlichen Sinn findet nicht statt. Vielmehr wird auf die unterschiedliche Performanz der beiden Konzeptionen Wert gelegt. Zum Schluss dieser Arbeit ist beabsichtigt, eine Antwort auf die dieser Ar-beit zugrunde gelegten Fragestellung zu finden. Schafft ein gelockerter Kündigungsschutz mehr Beschäftigung oder sind es die jeweils länderspezifischen Merkmale, die zu mehr Beschäftigung führen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ursachen und Wirkungen
- 1.1) Folgen des Kündigungsschutzes für die Arbeitgeber
- 1.2) Rechtsunsicherheit durch Kündigungsschutzklagen.
- 1.3) Arbeitsverhältnisse.
- 2. Fallbeispiel USA
- 2.1) Der amerikanische Arbeitsmarkt in Zahlen.
- 2.2) Sozialleistungen
- 2.3) Rechtsdoktrin des „employment-at-will“.
- 2.4) Jobsicherheit in gewerkschaftlich organisierten Unternehmen USA
- 2.5) Beschäftigungssicherheit in nicht gewerkschaftlich organisierten Unternehmen USA
- 3. Fallbeispiel Dänemark
- 3.1) Der dänische Arbeitsmarkt
- 3.2) Arbeitslosenversicherung
- 3.3) Arbeitsrecht.
- 4. Empirischer Sachverhalt zwischen Kündigungsschutz und Beschäftigung
- 4.1) Wirkung auf Niveau und Struktur der Arbeitslosigkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob ein gelockerter Kündigungsschutz zu mehr Beschäftigung führt. Dazu werden die Länder USA und Dänemark als Beispiele für deregulierten Kündigungsschutz herangezogen und analysiert. Es wird untersucht, ob die unterschiedlichen Ansätze in diesen Ländern, kombiniert mit ihren jeweiligen Sozialleistungen, zu unterschiedlichen Beschäftigungsergebnissen führen.
- Auswirkungen des Kündigungsschutzes auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Das Verhältnis von Kündigungsschutz und Arbeitsmarktflexibilität
- Die Rolle der Sozialleistungen in der Deregulierung des Kündigungsschutzes
- Der Vergleich von zwei unterschiedlichen Modellen des Kündigungsschutzes: USA und Dänemark
- Empirische Evidenz zum Zusammenhang zwischen Kündigungsschutz und Beschäftigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des deregulierten Kündigungsschutzes im Kontext der Arbeitsmarktkrise vor und definiert den Rahmen der Untersuchung. Kapitel 1 beleuchtet die Ursachen und Wirkungen des Kündigungsschutzes und diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven von Befürwortern und Kritikern. Das Fallbeispiel USA in Kapitel 2 analysiert die amerikanischen Arbeitsmarktstrukturen, Sozialleistungen und die Rechtsdoktrin des „employment-at-will“. Kapitel 3 betrachtet den dänischen Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenversicherung und das Arbeitsrecht. Kapitel 4 präsentiert empirische Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Kündigungsschutz und Beschäftigung.
Schlüsselwörter
Kündigungsschutz, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktpolitik, Deregulierung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Sozialleistungen, USA, Dänemark, employment-at-will, Arbeitsrecht, Arbeitslosenversicherung, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Führt ein gelockerter Kündigungsschutz zu mehr Beschäftigung?
Die Arbeit untersucht diese Frage kontrovers: Während Befürworter mehr Dynamik erwarten, zeigen Vergleiche, dass oft länderspezifische Faktoren wie Sozialleistungen entscheidender sind.
Was bedeutet „employment-at-will“ in den USA?
Es ist eine Rechtsdoktrin, nach der Arbeitsverhältnisse von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden können, sofern keine Diskriminierung vorliegt.
Wie funktioniert das dänische Modell (Flexicurity)?
Dänemark kombiniert einen schwachen Kündigungsschutz mit sehr hohen staatlichen Sozialleistungen und einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zur schnellen Reintegration.
Welche Folgen hat ein starker Kündigungsschutz für Arbeitgeber?
Er kann zu Rechtsunsicherheit durch Klagen führen und Arbeitgeber dazu veranlassen, bei Neueinstellungen vorsichtiger zu sein, was die Arbeitsmarktflexibilität einschränken kann.
Gibt es einen empirischen Zusammenhang zwischen Kündigungsschutz und Arbeitslosigkeit?
Empirische Daten zeigen keine eindeutige Korrelation; vielmehr beeinflusst der Kündigungsschutz eher die Struktur der Arbeitslosigkeit (z.B. Langzeitarbeitslosigkeit) als das Gesamtniveau.
- Arbeit zitieren
- Manuel Simon (Autor:in), 2004, Vor und Nachteile eines deregulierten Kündigungsschutzes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31336