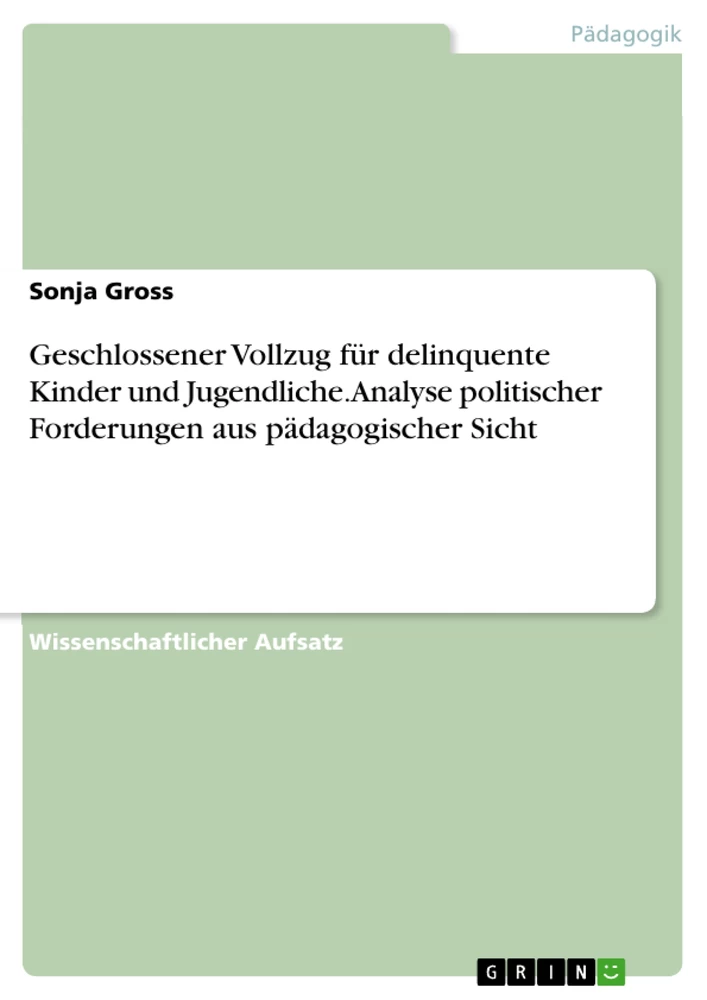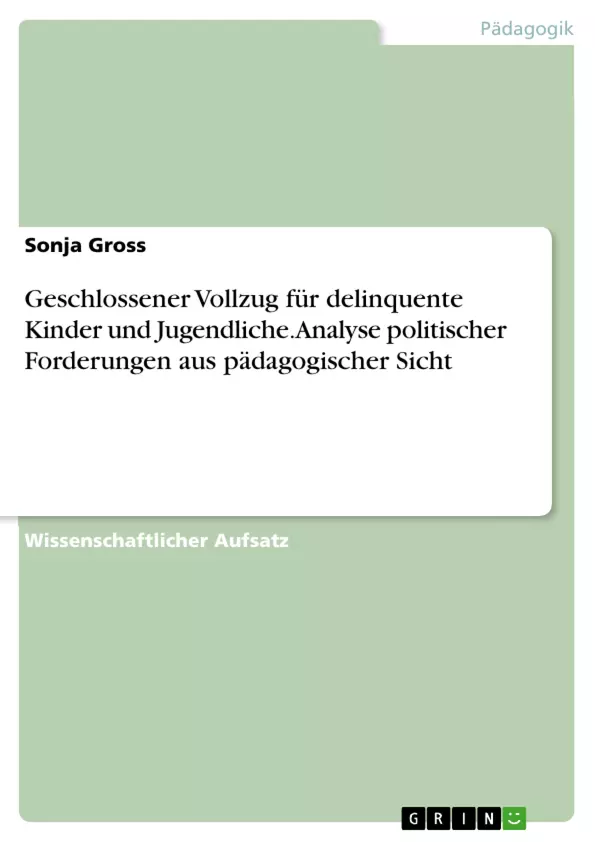Sind die Forderungen nach geschlossener Unterbringung krimineller beziehungsweise delinquenter Jugendlicher gerechtfertigt? Diese Frage wird aus sozialpädagogischer Perspektive diskutiert. Dazu wird die Entstehung der Forderungen und sowohl deren Argumentation als auch die Argumentation der Gegenseite betrachtet. Unterfragen sind somit: Weshalb entstehen diese politischen Forderungen und wie geht die Sozialpädagogik damit um?
„Massive Zunahme der Kinderkriminalität“, so lautet der fettgedruckte Titel eines Artikels der Presse (vgl. diepresse.com, 10.10.2008). Diese Haltung findet auch im medialen Diskurs und in fordernden Stimmen von Politikern seinen Ausdruck: „Lange Jugendstrafen sind selten. Experten fordern Gesetzesänderung, um härtere Strafen verhängen zu können“ (Häuptli, NZZ vom 12. Juli 2009). Diese Schlagzeile der NZZ ist keine Ausnahme. Sie widerspiegelt die weitverbreitete Forderung härterer Bestrafung von kriminellen Kindern und Jugendlichen. Politik und Medien rufen immer wieder auf zur Abkehr von der „Kuschelpädagogik“ (vgl. bspw. Chassot, NZZ 14.11.2010).
Es zeigt sich, dass die vorherrschende Diskussion über eine geschlossene Unterbringung für delinquente bzw. mehrfach auffällige Kinder und Jugendliche stark ideologisiert wird. Das Phänomen Kinderkriminalität wird von verschiedenen Seiten funktionalisiert. Kinderkriminalität und bedrohlich steigende Statistiken werden sowohl von Politikern und politischen Parteien als auch von den Medien immer wieder hervorgeholt, wenn es darum geht neue Wählerschaft auf sich aufmerksam zu machen oder die Leserschaft in Bann zu ziehen, während pädagogische Fachleute dies einhellig ablehnen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Kinder- und Jugendkriminalität
- Definition und Statistik
- Repressive politische Forderungen und Darstellung in den Medien
- Positionierung der Sozialpädagogik
- Diskussion geschlossener Unterbringung
- Ursache abweichenden Verhaltens
- Kritische Betrachtung aus pädagogischer Perspektive
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich kritisch mit politischen Forderungen nach geschlossener Unterbringung krimineller bzw. delinquenter Jugendlicher. Sie analysiert die Entstehung dieser Forderungen, deren Argumente sowie die Position der Sozialpädagogik dazu. Die Arbeit zielt darauf ab, zu beantworten, ob diese Forderungen aus sozialpädagogischer Sicht gerechtfertigt sind.
- Analyse der Entstehung und Argumentation von politischen Forderungen nach härteren Strafen für Kinder und Jugendliche.
- Darstellung der Position der Sozialpädagogik zur Kinder- und Jugendkriminalität und den damit verbundenen Forderungen.
- Diskussion der geschlossenen Unterbringung aus pädagogischer Perspektive, unter Einbezug von Theorien abweichenden Verhaltens.
- Kritik an der Überbewertung von Statistik und der medialen Inszenierung von Kinderkriminalität.
- Betrachtung der Lebenswelt und der Ursachen von abweichendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Im ersten Kapitel wird der Fokus auf die Darstellung und Diskussion von statistischen Zahlen zur Kinder- und Jugendkriminalität gelegt. Die Arbeit stellt verschiedene Positionen dar, darunter die der politischen Forderungen und medialen Schlagzeilen sowie die der Sozialpädagogik. Es wird beleuchtet, wie die verschiedenen Akteure argumentieren und welche Motive hinter ihren Positionen stehen.
Kapitel 2 widmet sich der geschlossenen Unterbringung aus pädagogischer Perspektive. Es werden verschiedene Theorien vorgestellt, die die Entstehung von abweichendem Verhalten erklären. Die Arbeit analysiert die Ursachen für jugendliche Gewaltkarrieren, wie sie von Suterlüty (2003) beschrieben werden, und stellt diese in den Kontext weiterer Befunde, beispielsweise zu Zwillingsstudien und dem Ansatz von Thiersch.
In Kapitel 3 wird die geschlossene Unterbringung aus pädagogischer Perspektive kritisch betrachtet. Die Arbeit zeigt auf, dass delinquente Kinder und Jugendliche vor allem Unterstützung und Bestärkung brauchen, um ein positives Selbstkonzept aufzubauen. Es wird diskutiert, ob geschlossene Heime als optimale Lösung anzusehen sind und welche Probleme sich im Zusammenhang mit der Unterbindung der Verbindung zur Lebenswelt ergeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt zentrale Themenbereiche wie Kinder- und Jugendkriminalität, repressive politische Forderungen, geschlossene Unterbringung, Sozialpädagogik, Theorien abweichenden Verhaltens, Lebensweltorientierung, Etikettierungstheorie, sekundäre Devianz und sozialpolitische Massnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Diskussion um den geschlossenen Vollzug bei Jugendlichen?
Die Arbeit analysiert, ob politische Forderungen nach einer geschlossenen Unterbringung für kriminelle Kinder und Jugendliche aus pädagogischer Sicht gerechtfertigt sind.
Wie positioniert sich die Sozialpädagogik zu diesem Thema?
Pädagogische Fachleute lehnen repressive Forderungen meist ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit von Unterstützung und Lebensweltorientierung.
Welche Rolle spielen Medien und Politik in der Debatte?
Die Arbeit kritisiert, dass das Phänomen Kinderkriminalität oft medial inszeniert und politisch funktionalisiert wird, um Wählerstimmen zu gewinnen.
Was sind laut der Arbeit die Ursachen für delinquentes Verhalten?
Es werden verschiedene Theorien herangezogen, die Ursachen in der Lebenswelt, in Gewaltkarrieren oder sozialen Rahmenbedingungen verorten, statt nur auf Statistiken zu blicken.
Warum wird der Begriff „Kuschelpädagogik“ erwähnt?
Dieser Begriff wird oft von Politikern und Medien genutzt, um eine Abkehr von pädagogischen Ansätzen hin zu härteren Strafen zu fordern.
- Quote paper
- Sonja Gross (Author), 2014, Geschlossener Vollzug für delinquente Kinder und Jugendliche. Analyse politischer Forderungen aus pädagogischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313504