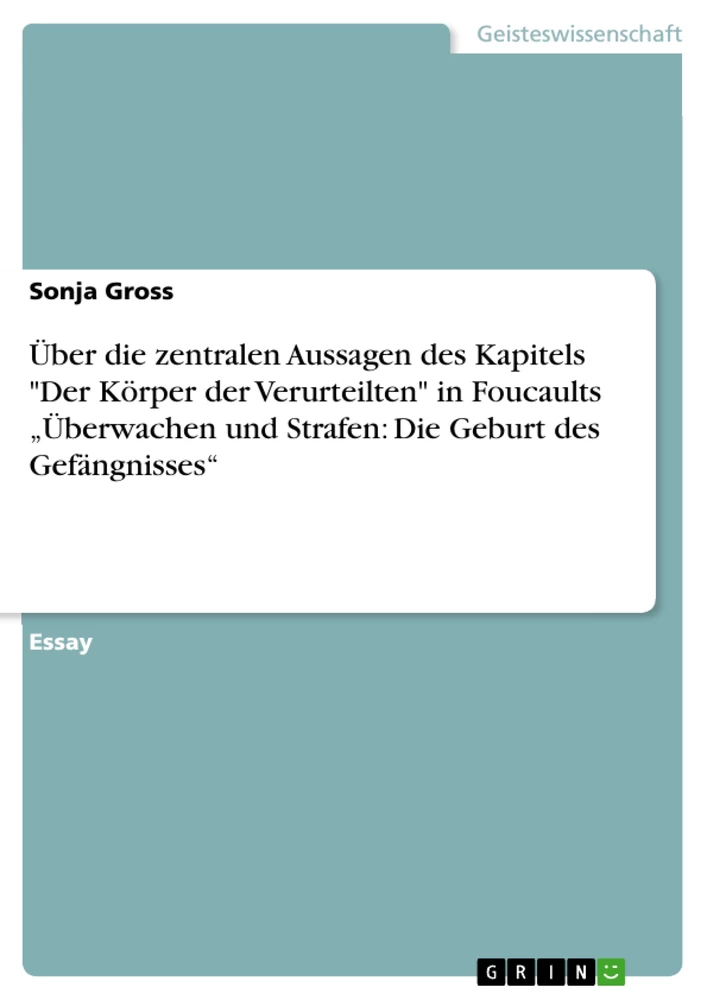Dieser Aufsatz stellt den Text und die zentralen Aussagen von Foucaults „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ in einem ersten Teil vor und diskutiert sie in einem zweiten Teil. Die Arbeit gliedert sich dementsprechend in vier Teile: Einleitung, Thesen, Diskussion und Schlusswort.
„Der Körper der Verurteilten“ ist das erste Kapitel des Werkes Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, welches 1975 von Michel Foucault geschrieben und von Walter Seitter aus dem Französischen übersetzt wurde.
Der französische Philosoph, Soziologe, Historiker und Übersetzer Michel Foucault analysiert in diesem Kapitel, am Beispiel der Transformation der Strafformen zwischen der frühen Neuzeit und der Moderne, wie sich die Machttechniken im letzten Jahrhundert verändert haben. Er beschreibt anschaulich die Hinrichtung Damiens 1757, der vor versammelter Menge auf dem Grève-Platz in Paris gemartert wird. Sein Körper sollte mit glühenden Zangen gezwickt, seine Haut mit geschmolzenem Blei, siedendem Öl und anderen heissen Flüssigkeiten verbrannt, seine Glieder durch vier Pferde abgerissen und der restliche Körper vom Feuer vernichtet werden. Diese Verurteilung wird dem „Haus der jungen Gefangenen in Paris“, einem Gefängnis, das rund 75 Jahre später bestand, gegenübergestellt.
„Das eine Mal eine Leibesmarter, das andere Mal eine Zeitplanung“, so lautet das zusammenfassende Fazit. Der Strafstil hat sich, in Abhängigkeit der gesellschaftlichen Ordnung, innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändert. Der Körper ist nicht länger Hauptzielscheibe der strafenden Repression. Der Akt der Bestrafung wird immer mehr im Geheimen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, durchgeführt, die Marten, die „peinlichen Strafen“ verschwinden zunehmend. Es ist der Eintritt in das „Zeitalter der Strafnüchternheit“.
Diesen beobachteten Sachverhalt analysiert Foucault hinsichtlich der Macht- und Herrschaftsstrukturen. Da seine Annahmen und Thesen sehr verschachtelt und zum Teil auch nur implizit sind, werden seine Hauptthesen, um sie im Anschluss angemessen diskutieren zu können, in den Kapiteln etwas umfänglicher dargestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Thesen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Aufsatz bietet eine Einführung in Michel Foucaults Werk „Überwachen und Strafen - Die Geburt des Gefängnisses“ und diskutiert seine zentralen Aussagen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Transformation von Strafformen in der frühen Neuzeit und der Moderne, insbesondere der Verschiebung von körperlicher zu seelischer Bestrafung.
- Die Veränderung der Strafpraktiken im 18. Jahrhundert
- Der Wandel von öffentlich-körperlichen zu privaten-seelischen Strafmethoden
- Die Rolle von Macht und Wissen in der Konstruktion des Körpers
- Die Beziehung zwischen Körper und Seele in der Bestrafung
- Foucaults Analyse der „Utopie einer schamhaften Justiz“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt Foucaults Werk „Überwachen und Strafen“ vor und beschreibt die Transformation der Strafformen vom öffentlichen Martern zum Gefängnis als neue Form der Bestrafung. Foucault analysiert die Hinrichtung Damiens als Beispiel für die brutale körperliche Bestrafung der Vergangenheit und vergleicht sie mit dem modernen Gefängnis, welches eine Zeitplanung und „Heilung“ des Verbrechers anstrebt.
Der Abschnitt „Thesen“ beleuchtet Foucaults Hauptargumente. Er argumentiert, dass sich die gesamte Ökonomie der Züchtigung im Laufe des 18. Jahrhunderts grundlegend verändert hat. Das öffentliche Schauspiel der Marter wird durch Strafmethoden ersetzt, die im Geheimen stattfinden und auf „Bessern, Erziehen und Heilen“ des Verbrechers zielen. Foucault beleuchtet die Veränderung des Blickpunktes von der Bestrafung des Körpers zur Bestrafung der Seele.
Schlüsselwörter (Keywords)
Dieser Text befasst sich mit den zentralen Themen der Sozialpädagogik, insbesondere der Macht- und Herrschaftsstrukturen im Kontext von Strafformen. Michel Foucault analysiert die Transformation der Strafpraktiken im 18. Jahrhundert und die Verschiebung von körperlichen zu seelischen Bestrafungsformen. Schlüsselbegriffe sind dabei Macht, Wissen, Körper, Seele, Züchtigung, Strafvollzug, Gefängnis, Utopie, und die „schamhafte Justiz“.
- Quote paper
- Sonja Gross (Author), 2015, Über die zentralen Aussagen des Kapitels "Der Körper der Verurteilten" in Foucaults „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313525