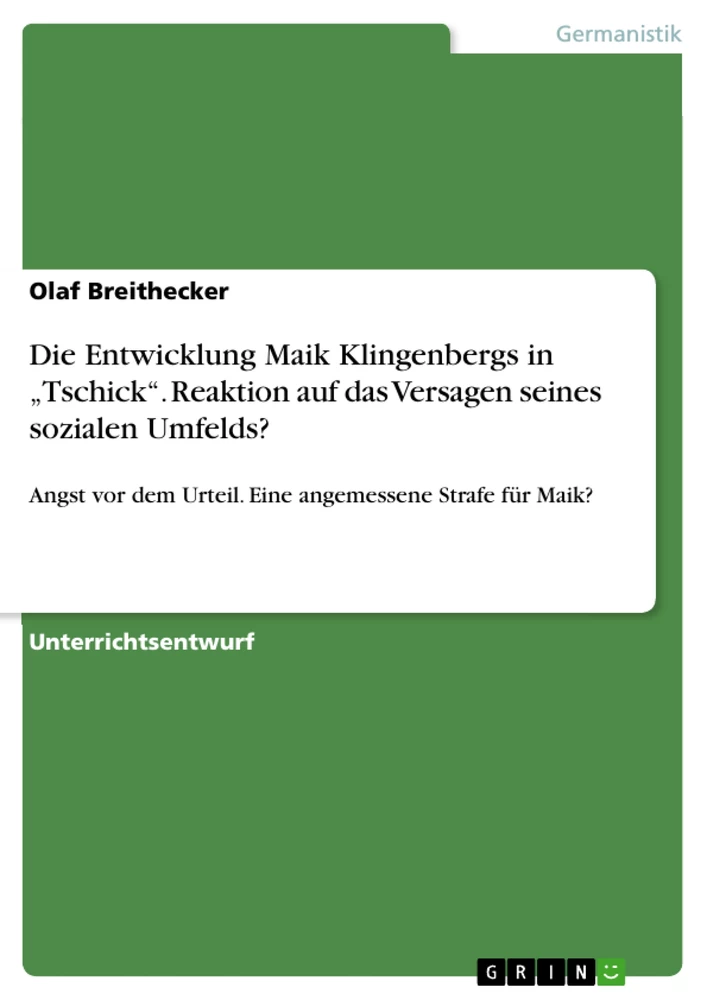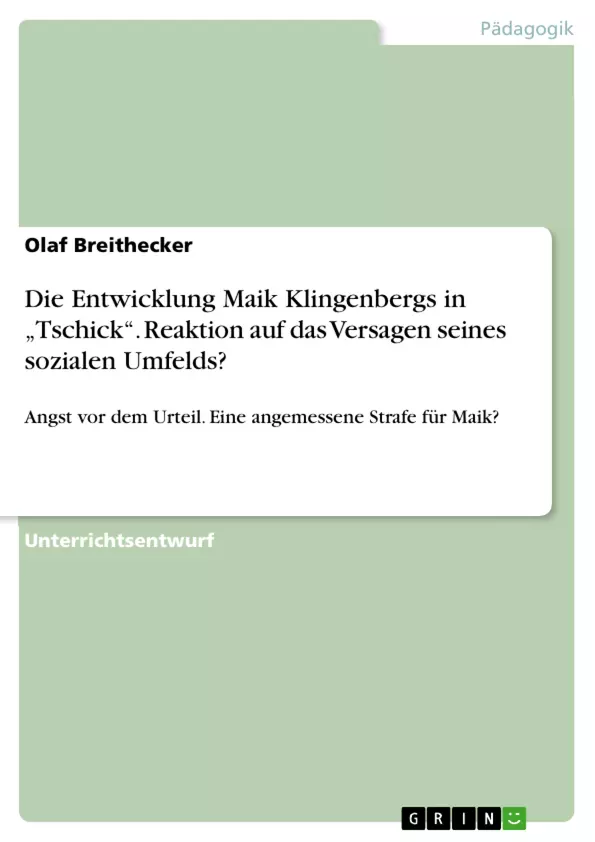Während der Sommerferien stehlen die beiden 14-jährigen Klassenkameraden Maik Klingenberg und Andrej Tschichatschow, den alle nur Tschick nennen, ein altes Auto der Marke Lada und unternehmen eine Reise quer durch Ostdeutschland. Dabei sind sie mehr oder weniger orientierungslos, obwohl ihr Ziel die Walachei ist.
Beide, sowohl Tschick als auch Maik, kommen aus kaputten Familien: Tschick lebt erst seit vier Jahren gemeinsam mit seinem Bruder in Deutschland, seine Eltern werden im gesamten Roman nicht erwähnt. Auf den ersten Blick stammt Maik hingegen aus einer reichen Familie, die in einer Villa mit Pool lebt und Angestellte hat. Doch auch für ihn sind seine Eltern kein Rückhalt: Maiks Mutter ist Alkoholikerin, während sein Vater mit seinem Immobiliengeschäft gescheitert ist und eine jahrelange Affäre mit seiner Sekretärin hat. Maik ist genau wie Tschick ein Außenseiter, der Angst davor hat, sein ganzes Leben lang als „Langweiler“ und „Angsthase“ zu gelten.
In der gezeigten Stunde soll die Verhandlung vor Gericht thematisiert werden. Aus didaktischen Gründen wird hier der Fokus auf den Protagonisten Maik und den Umgang mit Jugenddelinquenz gelegt. Aus diesem Grund wird Tschick nicht an der Gerichtsverhandlung vertreten sein.
Im Verlauf der Gerichtsverhandlung wird deutlich, dass Maik zu seiner Freundschaft zu Tschick steht: Sein Freund ist ihm nun wichtiger als sein kurzfristiger eigener Vorteil, wodurch auf seine Fähigkeit zur Selbstkritik und auf den Zugewinn an innerer Stärke hingewiesen wird. Neben der Entwicklung Maiks soll die Frage nach den Straftaten und der Angemessenheit des Strafmaßes thematisiert werden. Denn obwohl Maik durch die Reise eine positive Entwicklung durchgemacht hat, hat er sich strafbar gemacht und mehrere Mitmenschen durch sein Verhalten geschädigt. Er selbst ist sich schon länger darüber im Klaren, dass er durch mehrere Delikte zu einem „Verbrecher “ geworden ist. Dass das Urteil des Richters sehr milde ausfällt, liegt vor allem an dem Gutachten des Jugendgerichtshelfers, der Maiks familiäres Umfeld als „asozial“ bewertet und somit Maiks Verhalten in einem Zusammenhang mit dem fehlenden Rückhalt durch seine Eltern sieht. Dadurch, dass die Straftaten im Kontext mit möglichen Ursachen betrachtet werden, liegt für die SuS darin eine Chance, sich mit dem Thema Jugenddelinquenz auseinanderzusetzen, wodurch dem Erziehungsauftrag der Institution Schule Rechnung getragen wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Thema der Unterrichtsreihe: Die Entwicklung Maik Klingenbergs in „Tschick“ – Reaktion auf das Versagen seines sozialen Umfelds?
- Wolfgang Herrndorf - ein typischer Jugendbuch-Autor?
- Die ersten vier Kapitel von „Tschick“ – eine Exposition?
- Die Klingenbergs - ein Fall für das Jugendamt?
- Friedemanns Familie als positiver Gegenentwurf zu Maiks Familie
- Isa Schmidt voll „asi“ oder ein Mädchen mit vielen guten Eigenschaften?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Unterrichtsreihe zielt darauf ab, die Entwicklung des Protagonisten Maik Klingenberg im Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf zu untersuchen. Dabei soll untersucht werden, inwieweit Maiks Reaktionen auf das Versagen seines sozialen Umfelds seine Entwicklung prägen.
- Die Darstellung des familiären Umfelds der Protagonisten und deren Einfluss auf ihre Entwicklung
- Die Suche nach Identität und Zugehörigkeit bei Maik Klingenberg
- Die Rolle des Autors Wolfgang Herrndorf und seine Einflussnahme durch seine Biografie
- Die Bedeutung der Freundschaft in Maiks Entwicklung
- Die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Wolfgang Herrndorf - ein typischer Jugendbuch-Autor?: Dieses Kapitel beleuchtet den Autor Wolfgang Herrndorf und seine Biografie. Es werden Stationen seines Lebens und mögliche Einflüsse auf seine Werke beleuchtet, insbesondere auf „Tschick“.
- Die ersten vier Kapitel von „Tschick“ – eine Exposition?: Hier wird die Exposition des Romans „Tschick“ untersucht. Die Schülerinnen und Schüler analysieren die ersten Kapitel und erarbeiten wichtige Stationen im Leben von Maik Klingenberg sowie seine soziale Situation.
- Die Klingenbergs - ein Fall für das Jugendamt?: Dieses Kapitel fokussiert auf Maiks familiäre Situation und untersucht die Probleme in seinem Elternhaus. Die Schülerinnen und Schüler analysieren Maiks Eltern und erkennen, dass er weder in seiner Mutter noch in seinem Vater ein Vorbild oder eine Stütze hat.
- Friedemanns Familie als positiver Gegenentwurf zu Maiks Familie: Dieses Kapitel beleuchtet die Familie von Tschick. Die Schülerinnen und Schüler stellen die Unterschiede zwischen den familiären Situationen von Maik und Tschick heraus und interpretieren Friedemanns Familie als einen positiven Gegenentwurf zu Maiks Familie.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen und Begriffe dieser Unterrichtsreihe sind Jugendroman, soziale Probleme, Familienstrukturen, Freundschaft, Identitätssuche, Wolfgang Herrndorf, „Tschick“, Entwicklung des Protagonisten, soziales Umfeld, Ausgrenzung, Selbstfindung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelt sich Maik Klingenberg im Roman „Tschick“?
Maik wandelt sich vom ängstlichen Außenseiter zu einem selbstbewussteren Jugendlichen, der lernt, zu seiner Identität und seinen Freunden zu stehen.
Welchen Einfluss hat Maiks Familie auf sein Verhalten?
Das Versagen seiner Eltern – eine alkoholabhängige Mutter und ein abwesender, untreuer Vater – lässt Maik ohne emotionalen Rückhalt aufwachsen.
Warum ist die Gerichtsverhandlung im Buch wichtig?
In der Verhandlung zeigt Maik Rückgrat, indem er die Freundschaft zu Tschick über seinen eigenen Vorteil stellt, was seinen inneren Reifeprozess verdeutlicht.
Wie wird Jugenddelinquenz im Roman dargestellt?
Die Straftaten (Autodiebstahl) werden im Kontext des familiären Versagens betrachtet, was die Frage nach Ursachen und angemessener Erziehung aufwirft.
Wer ist Isa Schmidt im Roman?
Isa ist ein Mädchen, das die Jungen auf ihrer Reise treffen. Sie bricht Klischees auf und zeigt Maik eine weitere Facette von Identität und Freundschaft.
- Arbeit zitieren
- Olaf Breithecker (Autor:in), 2014, Die Entwicklung Maik Klingenbergs in „Tschick“. Reaktion auf das Versagen seines sozialen Umfelds?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313538