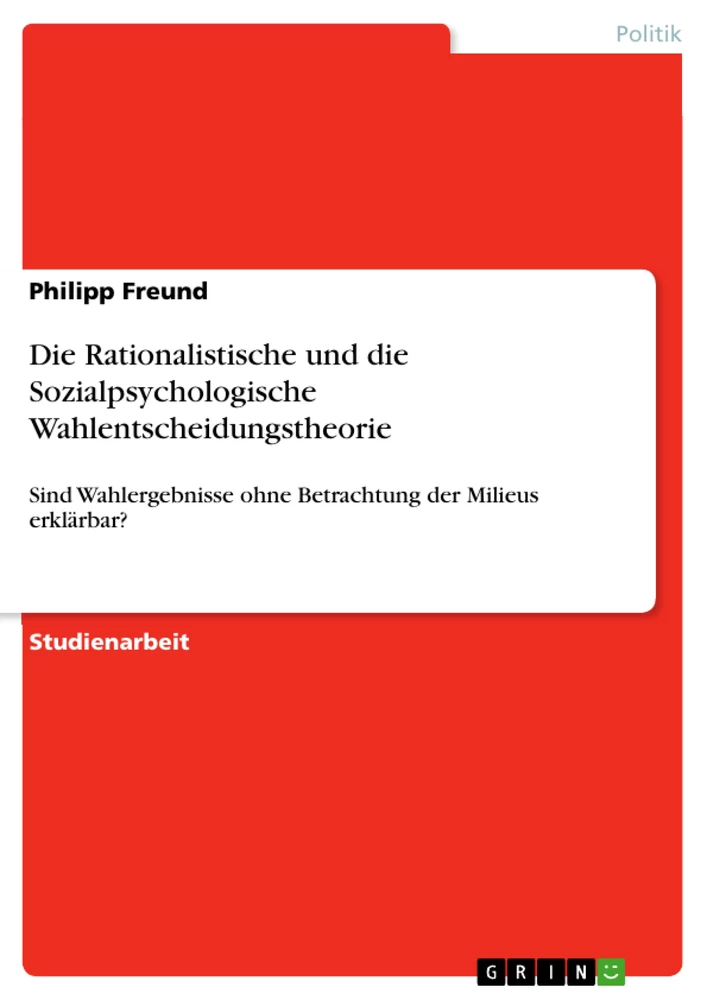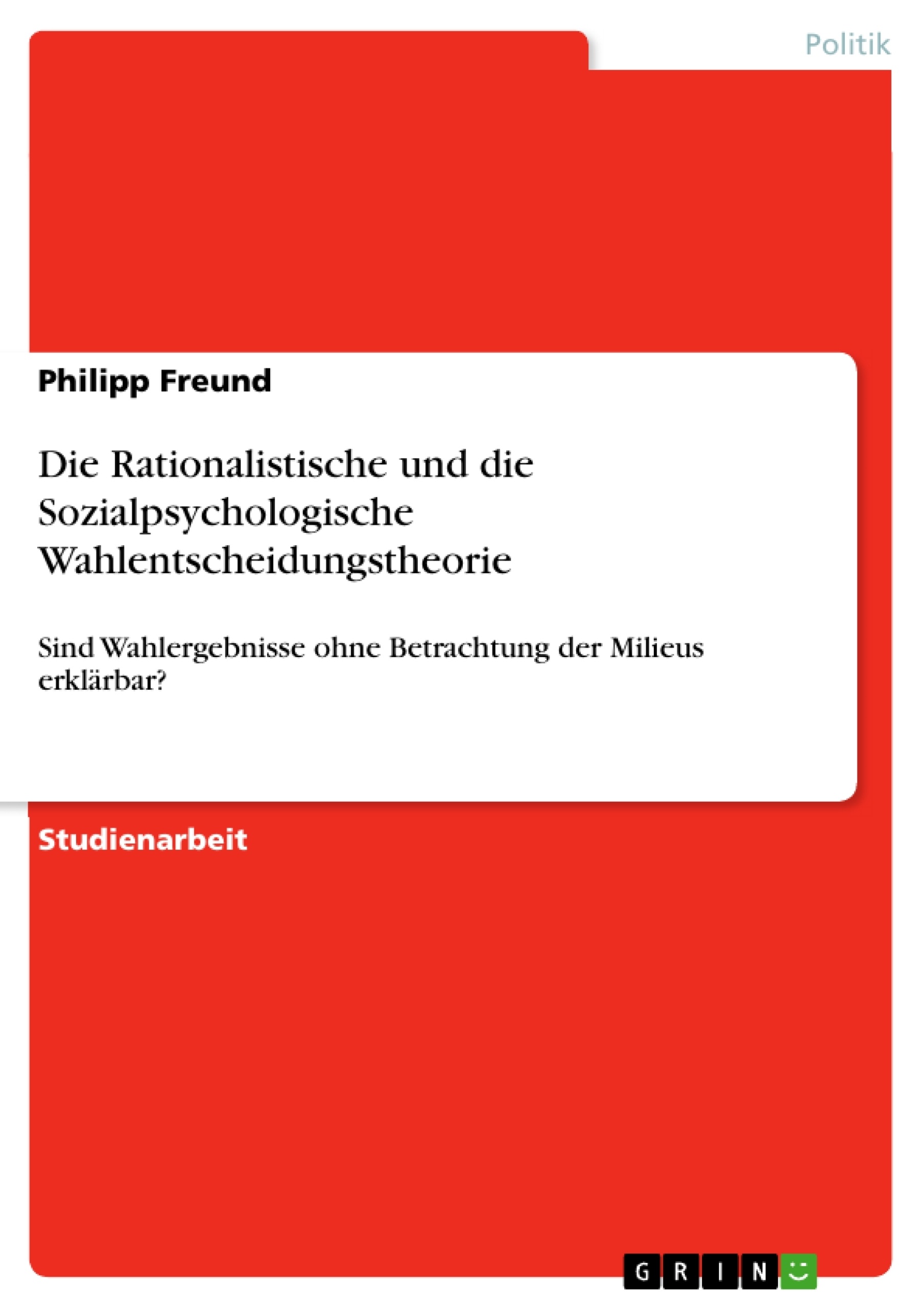Warum wählt ein Bürger eine bestimmte Partei? Und warum wählt Person A Partei 1, Person B jedoch Partei 2? Bei diesen Fragen sind Wahlentscheidungstheorien unumgänglich. Vierecke beschreibt dies treffend mit der Frage: „Wer wählt wen warum?“ (Vierecke et al. 2010: 105). Sie schaffen es eine Vorhersage bei einer Wahl zu treffen, Ergebnisse zu erklären, Probleme in Bezug auf Parteien und deren Wähler zu lösen und sind gemeinhin ein Indikator für einen Wechsel der politischen Stimmung, sofern man sie theoretisch und in einer Längsschnittstudie betrachtet.
Im Falle der vorliegenden Arbeit sollen zwei der drei bekannten Wahlentscheidungstheorien (vgl. Vierecke et al. 2010: 105) analysiert, abgegrenzt und in Bezug auf deren Aussagekraft ohne die Mikrosoziologische Theorie bewertet werden. Die Forschungsfrage der Arbeit, ob eine Erklärung von Wahlergebnissen ohne die Milieutheorie möglich ist, spiegelt eine zentrale Frage der Wahlforschung wider, die unter anderem auch von Manfred Schmidt aufgeworfen wird: „Wie stark sind heutzutage noch die Bindungen von Wählern an bestimmte gesellschaftliche Milieus?“ (Schmidt 2011: 72).
Der Hauptteil der Seminararbeit wird nach der Einleitung mit thematischer Hinführung mit einem analytischen Theoriekapitel beginnen, in welchem sowohl die rationalistische als auch die sozialpsychologische Wahlentscheidungstheorie separat aufgearbeitet und dargestellt werden. Anschließend werden in einem Übersichtskapitel beide Theorien nochmals aufgegriffen, um ihre Aussagekraft ohne die Milieutheorie zu betrachten. Im direkt folgenden Kapitel 4 wird dann die Schlussbetrachtung folgen, in welcher die Vor- und Nachteile der Theorien an den theoretischen Ansätzen der Mikrosoziologischen Theorie abschließend zusammengefasst und so eine Aussage über die Ergebnisse getroffen werden kann.
Zur Beantwortung der Fragestellung wird sowohl die Auswertung der Fachliteratur als auch eine schlussfolgernde Analyse der Theorien angewandt, wobei auch Bezug auf öffentlich zugängliche Wahlforschung genommen wird, welche in Form einer Dokumentenanalyse mit den Erkenntnissen der Literatur zusammenfließen und anschließend theoretisch interpretiert werden soll.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- a. Thema der Arbeit
- b. Aufbau der Arbeit
- c. Methodisches Vorgehen
- d. Forschungsstand
- 2. Wahlentscheidungstheorien
- a. Rationalistische Theorie
- i. Nutzenmaximierende Wahlversprechen
- ii. Negative Kosten.......
- b. Sozialpsychologische Theorie
- i. Kandidatenorientierung.
- ii. Sachfragenorientierung.......
- iii. Parteiidentifikation.....
- 3. Eine Wahlentscheidung ohne Milieus?
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit untersucht die Rationalistische und die Sozialpsychologische Wahlentscheidungstheorie und bewertet deren Aussagekraft ohne die Mikrosoziologische Theorie. Das Ziel ist es, zu erforschen, ob Wahlergebnisse ohne Berücksichtigung der Milieus erklärbar sind.
- Die Relevanz von Wahlentscheidungstheorien zur Erklärung von Wahlverhalten
- Die Kernannahmen der rationalistischen und sozialpsychologischen Wahlentscheidungstheorie
- Die Rolle von Milieus in der Wahlentscheidung
- Die Grenzen und Schwächen der beiden Theorien ohne die Berücksichtigung von Milieus
- Die Bedeutung der empirischen Forschung für die Validierung der Theorien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, beschreibt den Aufbau und das methodische Vorgehen, sowie den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Wahlentscheidungstheorien.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die rationalistische und die sozialpsychologische Wahlentscheidungstheorie ausführlich erläutert. Die rationalistische Theorie basiert auf der Annahme, dass Wähler rational handeln und ihre Entscheidung auf der Maximierung ihres eigenen Nutzens treffen. Die sozialpsychologische Theorie hingegen betrachtet die emotionalen und sozialen Aspekte der Wahlentscheidung, die durch Faktoren wie Kandidatenorientierung, Sachfragenorientierung oder Parteiidentifikation beeinflusst werden.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die Aussagekraft der beiden Theorien ohne die Berücksichtigung von Milieus. Es werden die Stärken und Schwächen der beiden Theorien im Hinblick auf die Erklärung von Wahlergebnissen ohne die Milieutheorie beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Wahlforschung, wie Wahlentscheidungstheorien, Rationalität, Sozialpsychologie, Milieus, Wahlergebnisse und empirische Forschung. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit und die Grenzen der rationalistischen und der sozialpsychologischen Wahlentscheidungstheorie, um die Erklärung von Wahlergebnissen ohne die Berücksichtigung von Milieus zu bewerten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob eine wissenschaftlich fundierte Erklärung von Wahlergebnissen auch ohne die Berücksichtigung der Milieutheorie (Mikrosoziologische Theorie) möglich ist.
Was besagt die Rationalistische Wahlentscheidungstheorie?
Sie geht davon aus, dass Wähler als „Homo Oeconomicus“ handeln, also ihren persönlichen Nutzen maximieren und Kosten minimieren wollen.
Welche Faktoren beeinflussen die Sozialpsychologische Theorie?
Hier stehen emotionale und soziale Bindungen im Fokus, insbesondere die Parteiidentifikation, die Kandidatenorientierung und die Sachfragenorientierung.
Warum sind Wahlentscheidungstheorien für die Politikwissenschaft wichtig?
Sie dienen dazu, Wahlergebnisse vorherzusagen, politische Stimmungswechsel zu erklären und Probleme in der Wählerbindung von Parteien zu identifizieren.
Welche Rolle spielt die Parteiidentifikation?
Sie gilt in der sozialpsychologischen Theorie als langfristige emotionale Bindung an eine Partei, die oft schon in der Sozialisation entsteht.
Wie wird die methodische Untersuchung durchgeführt?
Die Arbeit nutzt eine Kombination aus Fachliteratur-Auswertung, Dokumentenanalyse öffentlich zugänglicher Wahlforschung und theoretischer Interpretation.
- Citar trabajo
- Philipp Freund (Autor), 2015, Die Rationalistische und die Sozialpsychologische Wahlentscheidungstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313568