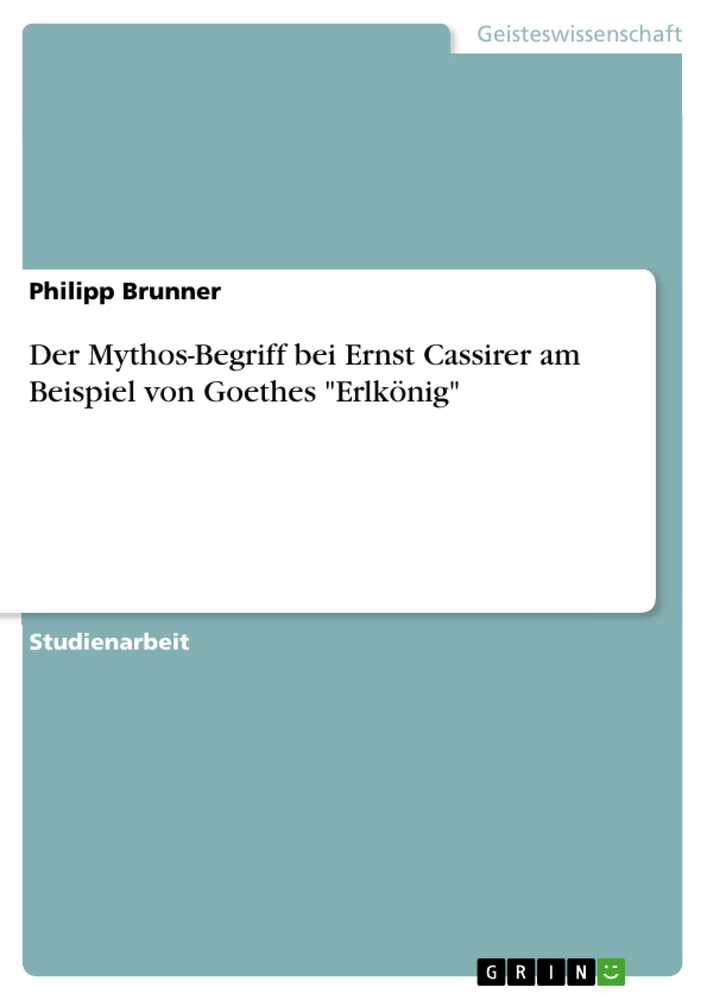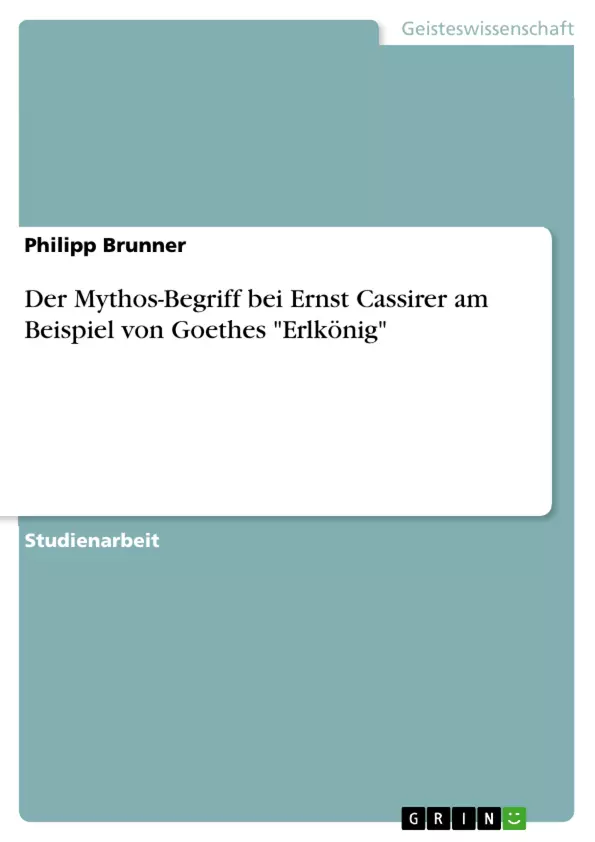Der Mythos ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst, auch wenn sich dessen Existenz ‚nur’ bis zu den Vorsokratikern zurückverfolgen lässt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Mythos ist aber ein Phänomen der Moderne. Viele Disziplinen haben sich mit dem Begriff auseinandergesetzt. Im Besonderen soll in dieser Arbeit der philosophische Zugang im Zentrum stehen.
Ein die Theorien verbindendes Element sei der Aspekt der Fragestellungen. Gemäss Segal sind die grundlegenden Fragen auf Ursprung, Funktion und Thematik gerichtet. Es gibt keine einheitliche Definition zum Begriff ‚Mythos‘. Man könnte jedoch sagen, dass ein ‚Mythos‘ die Form einer ‚Geschichte‘ hat, beziehungsweise eine Geschichte ist. So kommen einem wohl spontan die griechischen und ägyptischen Göttergeschichten, die germanische Mythenvielfalt, oder die christliche Schöpfungsgeschichte in den Sinn. Der Mythos ist aber viel mehr als eine erzählte Geschichte. Die Grenze zur blossen Legende wäre damit viel zu eng gesetzt. Mythen können sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder auf die Zukunft beziehen. Mythen haben Bedeutung und stellen Schicksale dar. Die Akteure in Mythen sind (Halb-)Götter, aber auch andere Wesen mythischer Herkunft, so wie der Faun, der Zwerg, oder der Elfenkönig, und natürlich auch der Mensch, der die Auswirkungen der Geschehnisse der mythischen Welt am eigenen Leib zu spüren bekommt.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Mythos-Theorien gehen stillschweigend alle davon aus, dass der ‚Mythos‘ auch erzählte Geschichte ist. Bevor ich zum Hauptteil übergehe und die philosophische Mythos-Theorie von Ernst Cassirer zu skizzieren versuche, werde ich den strukturalistischen Ansatz von Claude Lévi-Strauss, dann den philosophischen Ansatz von Hans Blumenberg knapp darstellen.
In einem zweiten Teil werde ich eines der berühmtesten Gedichte Goethes vorstellen, die Ballade vom “Erlkönig”. Eine kurze Entstehungsgeschichte der Ballade, sowie eine knappe Zusammenfassung, soll das Gedicht in Erinnerung rufen. Zum anderen soll aber vor allem ein Übergang geschaffen werden, der es mir (hoffentlich) erlaubt, Goethes „Erlkönig“ im Lichte Ernst Cassirers Mythos-Theorie neu zu lesen und zu interpretieren. Eine Abschrift des Gedichtes findet sich im Appendix dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung: Mythos und Mythentheorien
- Der Begriff des Mythos bei Lévi-Strauss und Blumenberg
- Claude Lévi-Strauss
- Hans Blumenberg
- Der Begriff des Mythos bei Ernst Cassirer
- Goethes 'Erlkönig'
- Entstehungsgeschichte, Form und Inhaltsangabe
- Analyse des 'Erlkönig' in Anlehnung an Cassirers Mythos-Begriff
- Konklusion
- Appendix: Goethes “Erlkönig”
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Mythos-Begriff im Werk von Ernst Cassirer, illustriert am Beispiel von Goethes 'Erlkönig'. Das Ziel ist es, Cassirers philosophische Mythos-Theorie zu untersuchen und ihre Anwendung auf ein konkretes literarisches Werk zu demonstrieren. Dazu werden zunächst verschiedene Ansätze zur Mythos-Interpretation, insbesondere die Ansätze von Lévi-Strauss und Blumenberg, kurz vorgestellt, um einen Kontrast zu Cassirers Theorie zu schaffen.
- Der Mythos-Begriff in der Philosophie und seine verschiedene Interpretationen
- Cassirers philosophische Mythos-Theorie und ihre zentralen Elemente
- Analyse von Goethes 'Erlkönig' im Lichte von Cassirers Theorie
- Die Bedeutung des Mythos in der Literatur und Gesellschaft
- Die Aktualität des Mythos-Begriffs in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt den Mythos-Begriff und seine Bedeutung in verschiedenen Disziplinen vor. Es werden unterschiedliche Ansätze zur Mythos-Interpretation beleuchtet, wobei die Schwerpunkte auf Lévi-Strauss' strukturalistischer und Blumenbergs philosophischer Herangehensweise liegen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Goethes 'Erlkönig', indem es auf die Entstehungsgeschichte, Form und Inhaltsangabe des Gedichtes eingeht.
Das dritte Kapitel analysiert Goethes 'Erlkönig' im Lichte von Cassirers Mythos-Theorie, um zu zeigen, wie Cassirers Konzept auf ein konkretes literarisches Werk angewendet werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Mythos, Ernst Cassirer, Claude Lévi-Strauss, Hans Blumenberg, Goethes 'Erlkönig', Literaturanalyse, Philosophie, Mythentheorie, Strukturalismus, Depotenzierung, Symbolismus, Bedeutung, Interpretation, Geschichte, Kultur, Sprache
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Ernst Cassirer den Begriff "Mythos"?
Für Cassirer ist der Mythos eine symbolische Form, durch die der Mensch seine Welt wahrnimmt und deutet, weit über eine bloße Erzählung hinaus.
Wie wird Goethes "Erlkönig" in dieser Arbeit interpretiert?
Das Gedicht wird als Darstellung eines mythischen Erlebens analysiert, wobei die Naturwesen als Akteure einer mythischen Welt auftreten, die den Menschen beeinflussen.
Welche anderen Mythentheorien werden vorgestellt?
Die Arbeit skizziert ergänzend den strukturalistischen Ansatz von Claude Lévi-Strauss und den philosophischen Ansatz von Hans Blumenberg.
Was ist der Unterschied zwischen Mythos und Legende?
Ein Mythos hat eine tiefere Bedeutung für das Weltverständnis und Schicksal, während eine Legende oft enger begrenzt ist.
Warum ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mythen modern?
Obwohl Mythen uralt sind, entwickelte sich ihre systematische Erforschung als Phänomen der Moderne in verschiedenen Disziplinen.
- Citation du texte
- BA Philipp Brunner (Auteur), 2009, Der Mythos-Begriff bei Ernst Cassirer am Beispiel von Goethes "Erlkönig", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313616