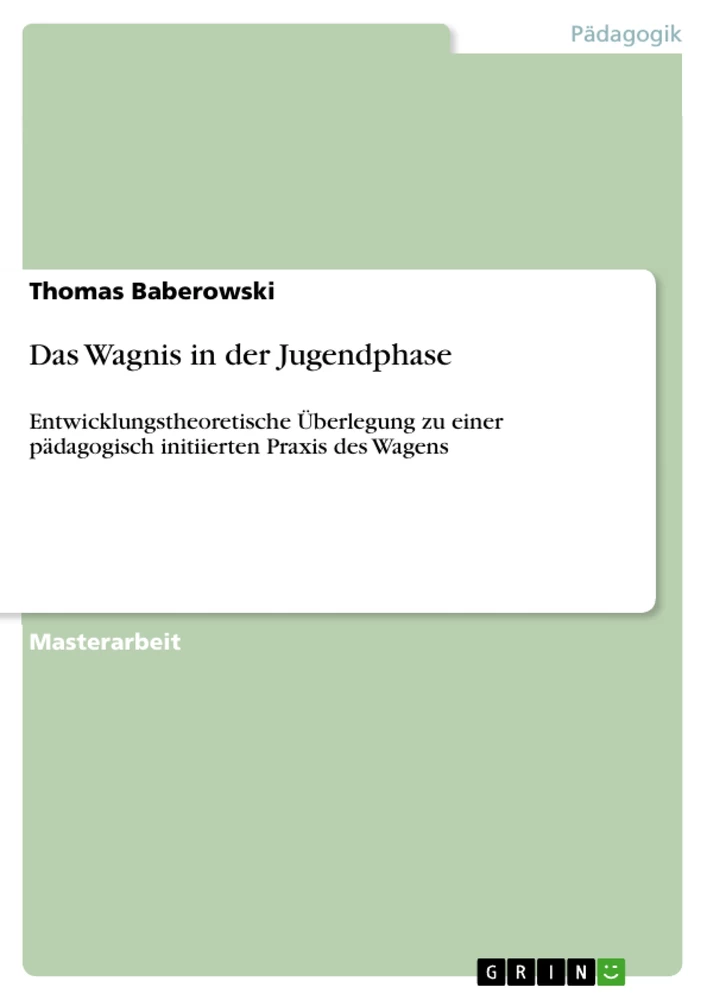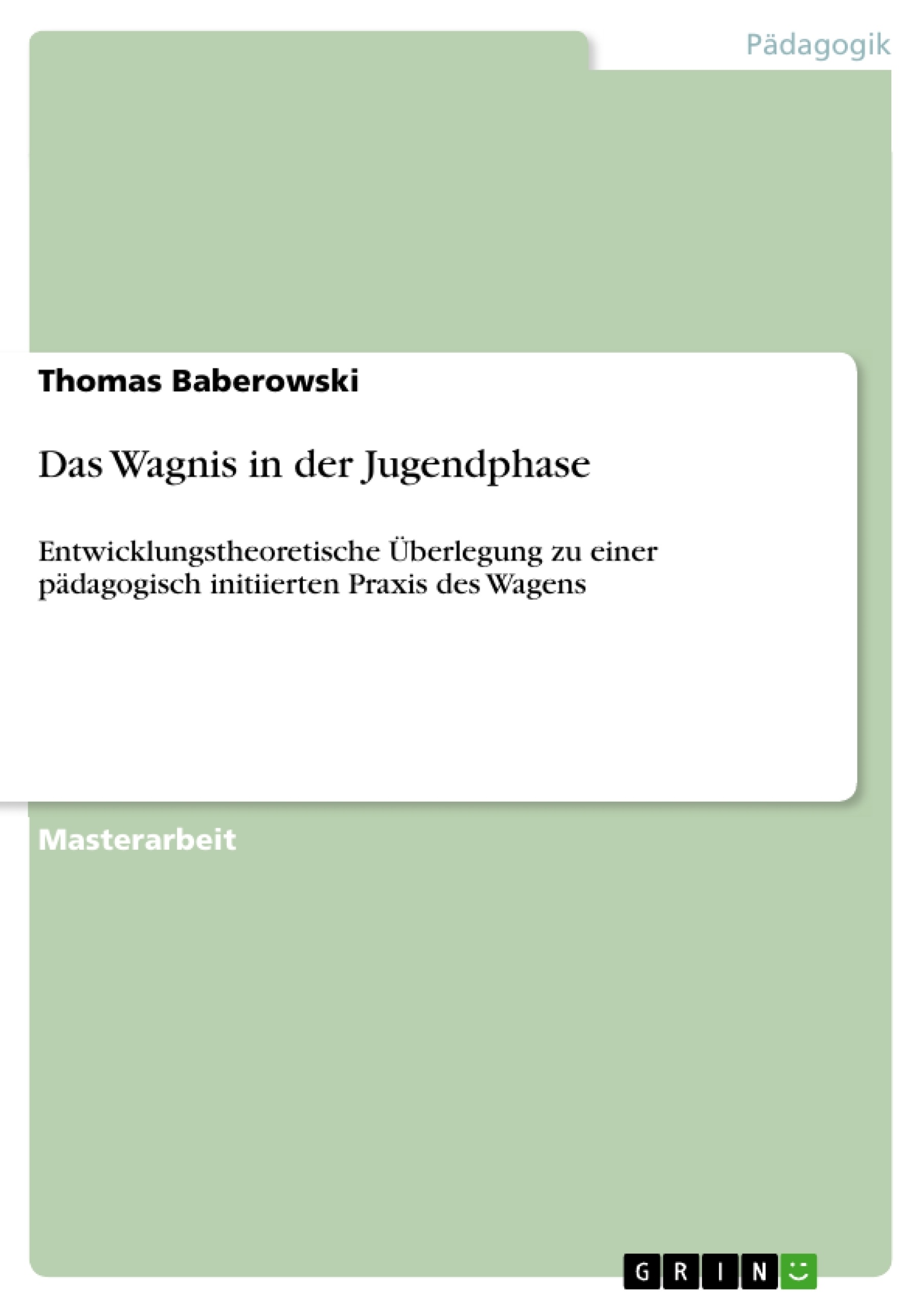Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So lautet ein altes deutsches Sprichwort, welches auch noch in der heutigen Umgangssprache in verschiedensten Zusammenhängen gebraucht wird. In ihm kommt die Haltung zum Ausdruck, dass nur derjenige, der bereit ist einen Einsatz zu riskieren, auch eine Aussicht auf einen Gewinn hat. Was genau mit diesem Gewinn gemeint ist beziehungsweise worauf sich der Nichtgewinn bezieht, bleibt undefiniert.
Der Sportwissenschafter, Psychologe, Philologe und Pädagoge SIEGBERT A.WARWITZ (2001) konkretisiert den Sinngehalt des Sprichworts in seiner Theorie vom „Leben in wachsenden
Ringen“. Ohne Wagnis gibt es keine (Weiter-)Entwicklung, so lautet seine These (ebd., S. 286; 2006, S. 101). Wer sich nicht wagt, der stagniert in seiner Entwicklung (2001, S. 286). Die Argumente für seine These bezieht WARWITZ (2001) überwiegend aus anthropologischen und teleologischen Betrachtungen zum menschlichen Dasein. Obwohl er den
Entwicklungsbegriff explizit verwendet, begründet er seine These ohne entwicklungstheoretische Bezüge. Insofern erscheint es interessant, den Wagnis-Entwicklungs-Zusammenhang aus entwicklungstheoretischer Perspektive zu überprüfen.
Die Neugier für eine Überprüfung dieses Zusammenhangs entspringt einem praxisbezogenen Interesse, wie auch schon der Titel dieser Arbeit vermuten lässt. Das Motiv dieser Arbeit ist
ein praktischer Nutzen, die Anwendung des Wagnisses in einer pädagogischen Praxis mit Jugendlichen. Doch kann die Praxis, zumindest eine professionelle, ohne angemessene
theoretische Begründungen nicht legitimiert werden. Dementsprechend soll das praktische Interesse in dieser Arbeit ein wenig an den Rand gestellt werden. Zwar wurde bereits von
NEUMANN (1999) ein praktischer Ansatz vorgelegt, allerdings bezieht sich dieser ausschließlich auf den (Schul-)Sport. Die Begründungen beschränken sich jedoch überwiegend auf postulierte positive Persönlichkeitswirkungen, die bisher nicht hinreichend nachgewiesen wurden (NEUMANN 1999, S. 156).
Deshalb soll in dieser Arbeit der Versuch unternommen werden das Wagnis entwicklungstheoretisch zu begründen. Das Ziel dieser Arbeit ist, aus entwicklungstheoretischer Perspektive nachzuvollziehen, inwiefern das Wagnis in der Entwicklung
Jugendlicher eine Relevanz besitzt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmung
- 2.1 Begriffsbestimmung in bisherigen Forschungsarbeiten
- 2.1.1 Abenteuer - Wagnis - Risiko im Sport (Schleske)
- 2.1.2 Das Wagnis im Sport (Neumann)
- 2.1.3 Sinnsuche im Wagnis (Warwitz)
- 2.1.4 Schlussfolgerungen für die Bestimmung des Wagnisbegriffs
- 2.2 Etymologie des Wagnisbegriffs
- 2.3 Heutiges Wortverständnis
- 2.4 Abgrenzung zu synonym verwendeten Begriffen
- 2.4.1 Risiko
- 2.4.2 Abenteuer
- 2.5 Determinierung des Wagnisbegriffs
- 2.5.1 Möglichkeit und Unmöglichkeit einer kontextübergreifenden Wagnisdefinition
- 2.5.2 Universelle konstitutive Wagnismerkmale der Grundbedeutung „kühnes Unternehmen“
- 2.5.3 Abschließende Bemerkungen
- 3 Entwicklungstheoretische Überlegungen zum Wagnis in der Jugendphase
- 3.1 Jugend
- 3.2 Entwicklung
- 3.2.1 Paradigmen zur Konzeptualisierung von Entwicklungstheorien
- 3.2.2 Auswahl einer geeigneten Entwicklungstheorie
- 3.3 Das Konzept der Entwicklungsaufgaben
- 3.3.1 Definition und Charakteristik von Entwicklungsaufgaben
- 3.3.2 Vernetzung von Entwicklungsaufgaben
- 3.3.3 Gültigkeit der Entwicklungsaufgaben
- 3.3.4 Kritik am Konzept der Entwicklungsaufgaben
- 3.4 Wagnis und Entwicklung – Erarbeitung einer Fragestellung
- 3.5 Argumentationsrahmen zur Formulierung einer These
- 3.6 Untersuchungsvorgehen
- 4 Strukturmerkmale des Wagnisses im Kontext jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben
- 4.1 Ablösung von den Eltern
- 4.1.1 Deutung der Ablösung als Krise oder Entwicklungsaufgabe
- 4.1.2 Ergebnisdarstellung mit Bezug zum Strukturmodell des Abenteuers
- 4.2 Peer-Group
- 4.2.1 Neue Leute kennenlernen
- 4.2.2 Auswahl von Freunden und Aufrechterhaltung von Freundschaft
- 4.2.3 Jugendliches Risikoverhalten
- 4.2.4 Verortung jugendlichen Risikoverhaltens innerhalb der Entwicklungsaufgabe „Peer“
- 4.2.5 Risikoverhalten als spezifisches Bewältigungsmuster der Entwicklungsaufgabe „Peer“
- 4.2.6 Die Schattenseite jugendlichen Risikoverhaltens und der Bezug zum Wagnis
- 4.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Entwicklungsaufgabe „Peer“
- 4.3 Vorbereitung auf eine berufliche Karriere
- 4.3.1 Strukturelle Entwicklungslinien im Berufs- und Bildungssystem
- 4.3.2 Struktur der Entwicklungsaufgabe Berufsvorbereitung
- 4.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Entwicklungsaufgabe „Beruf“
- 4.4 Untersuchungsfazit
- 5 Das Wagnis und die Pädagogik
- 5.1 Allgemeine Gedanken zur pädagogischen Relevanz des Wagnisses
- 5.2 Wertzuschreibung und Selbstreflexion
- 5.3 Das Abwägen im Kontext psychologischer Risikoforschung
- 6 Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Wagnis in der Jugendphase aus entwicklungstheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Bedeutung des Wagnisses für die Entwicklung junger Menschen zu beleuchten und pädagogische Implikationen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert den Begriff „Wagnis“, grenzt ihn von verwandten Begriffen ab und integriert ihn in relevante Entwicklungstheorien.
- Begriffliche Klärung und Abgrenzung des Begriffs „Wagnis“
- Einbettung des Wagnisses in entwicklungspsychologische Theorien
- Analyse des Wagnisses im Kontext spezifischer Entwicklungsaufgaben der Jugendphase (z.B. Ablösung von den Eltern, Peer-Beziehungen, Berufsvorbereitung)
- Pädagogische Relevanz und Implikationen des Wagnisses
- Zusammenhang zwischen Wagnis, Risiko und Abenteuer
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und skizziert den Forschungsstand und die Forschungsfrage. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und die gewählte Methodik. Die Bedeutung des Wagnisses im Kontext der Jugendphase wird als zentrale Fragestellung eingeführt.
2 Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel widmet sich einer umfassenden Begriffsbestimmung von „Wagnis“. Es analysiert den Begriff in verschiedenen Forschungsarbeiten und beleuchtet seine etymologischen Wurzeln sowie das heutige Sprachverständnis. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung des Begriffs „Wagnis“ von verwandten Begriffen wie „Risiko“ und „Abenteuer“. Das Kapitel mündet in eine kontextualisierte Definition des Wagnisbegriffs, die als Grundlage für die weiteren Kapitel dient. Die unterschiedlichen Definitionen werden kritisch diskutiert und ein umfassender Rahmen für die weitere Verwendung des Begriffs geschaffen.
3 Entwicklungstheoretische Überlegungen zum Wagnis in der Jugendphase: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Kontext der Jugendphase und verschiedenen Entwicklungstheorien. Es werden verschiedene Paradigmen der Entwicklungstheorie vorgestellt und kritisch evaluiert, um ein geeignetes Modell für die Analyse des Wagnisses in der Jugendphase zu finden. Der Fokus liegt auf dem Konzept der Entwicklungsaufgaben und seiner Anwendbarkeit auf die Untersuchung des Wagnisses. Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Entwicklungsaufgaben, um dessen Stärken und Schwächen für die vorliegende Untersuchung zu evaluieren, ist zentral.
4 Strukturmerkmale des Wagnisses im Kontext jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben: Dieses Kapitel untersucht das Wagnis im Kontext wichtiger Entwicklungsaufgaben der Jugendphase. Es analysiert das Wagnis im Zusammenhang mit der Ablösung von den Eltern, der Peer-Group und der Vorbereitung auf eine berufliche Karriere. Für jede Entwicklungsaufgabe werden spezifische Aspekte des Wagnisses beleuchtet, und es wird untersucht, wie Wagnis als Bewältigungsstrategie eingesetzt wird. Die Zusammenhänge werden mit empirischen Daten und theoretischen Modellen untermauert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Wagnisses für die erfolgreiche Bewältigung der jeweiligen Entwicklungsaufgaben.
5 Das Wagnis und die Pädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit der pädagogischen Relevanz des Wagnisses. Es wird diskutiert, wie das Wagnis pädagogisch begleitet und gefördert werden kann. Die Bedeutung von Wertzuschreibung und Selbstreflexion im Zusammenhang mit Wagniserfahrungen wird hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Wagnis und Risiko aus pädagogischer Sicht und skizziert Ansätze für eine pädagogisch initiierte Praxis des Wagnisses.
Schlüsselwörter
Wagnis, Jugendphase, Entwicklungsaufgaben, Entwicklungstheorie, Risiko, Abenteuer, Pädagogik, Selbstreflexion, Ablösung, Peer-Group, Berufsvorbereitung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: "Wagnis in der Jugendphase"
Was ist der zentrale Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutung von "Wagnis" in der Jugendphase aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wagnisbegriffs, seiner Einbettung in relevante Entwicklungstheorien und seinen pädagogischen Implikationen.
Wie wird der Begriff "Wagnis" definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit widmet sich einer umfassenden Begriffsbestimmung von "Wagnis". Sie analysiert den Begriff in verschiedenen Forschungsarbeiten (Schleske, Neumann, Warwitz), beleuchtet seine etymologischen Wurzeln und das heutige Sprachverständnis. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen wie "Risiko" und "Abenteuer". Die Arbeit mündet in eine kontextualisierte Definition, die als Grundlage für die weiteren Analysen dient.
Welche Entwicklungstheorien werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert und evaluiert verschiedene Paradigmen der Entwicklungstheorie, um ein geeignetes Modell für die Analyse des Wagnisses in der Jugendphase zu finden. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Arbeit diskutiert kritisch die Stärken und Schwächen dieses Konzepts.
In welchen Kontexten wird das Wagnis in der Jugendphase untersucht?
Das Wagnis wird im Kontext wichtiger Entwicklungsaufgaben der Jugendphase analysiert, darunter die Ablösung von den Eltern, die Peer-Group und die Vorbereitung auf eine berufliche Karriere. Für jede Entwicklungsaufgabe werden spezifische Aspekte des Wagnisses beleuchtet und untersucht, wie Wagnis als Bewältigungsstrategie eingesetzt wird.
Welche pädagogischen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt die pädagogische Relevanz des Wagnisses. Es wird diskutiert, wie Wagnis pädagogisch begleitet und gefördert werden kann, und die Bedeutung von Wertzuschreibung und Selbstreflexion im Zusammenhang mit Wagniserfahrungen wird hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen Wagnis und Risiko aus pädagogischer Sicht wird beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung, Entwicklungstheoretische Überlegungen zum Wagnis in der Jugendphase, Strukturmerkmale des Wagnisses im Kontext jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben, Das Wagnis und die Pädagogik, Diskussion und Ausblick. Jedes Kapitel wird detailliert in der Zusammenfassung der Kapitel beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Wagnis, Jugendphase, Entwicklungsaufgaben, Entwicklungstheorie, Risiko, Abenteuer, Pädagogik, Selbstreflexion, Ablösung, Peer-Group, Berufsvorbereitung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Bedeutung hat das Wagnis für die Entwicklung junger Menschen in der Jugendphase und welche pädagogischen Implikationen ergeben sich daraus?
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt die gewählte Methodik in der Einleitung. Sie basiert auf einer Literaturrecherche und einer Analyse bestehender Theorien und Modelle. Nähere Angaben zur konkreten Methodik finden sich im Haupttext.
- Arbeit zitieren
- Thomas Baberowski (Autor:in), 2012, Das Wagnis in der Jugendphase, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313703