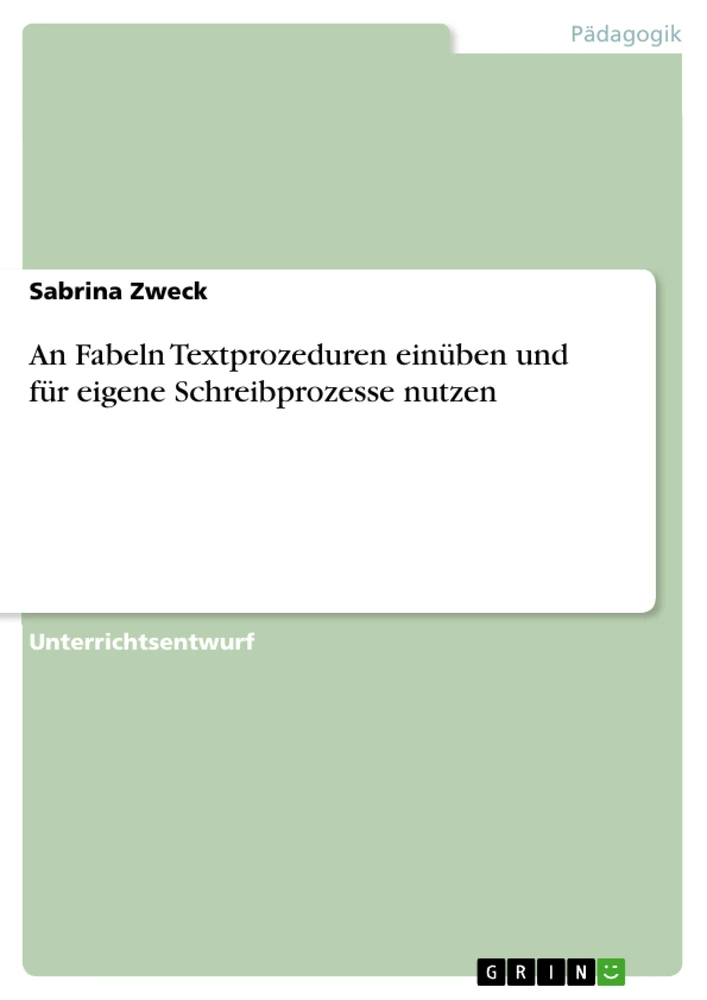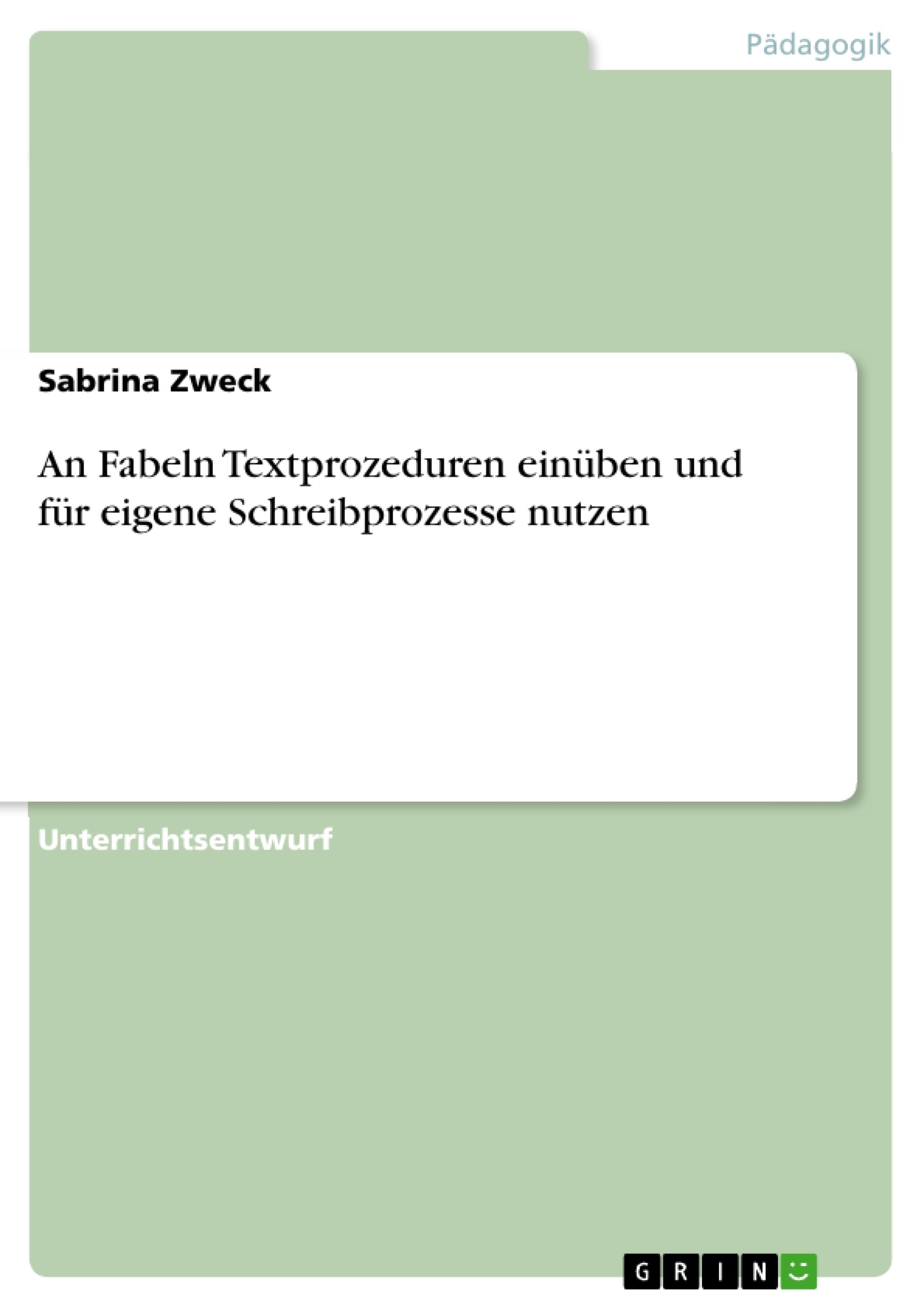Erzählende Texte besitzen schon im Deutschunterricht der Grundschule eine sehr große Bedeutung. Um sich die Strukturen und Textmuster der verschiedenen Gattungen der erzählenden Texte (besonders auch der Fabel) aneignen und schließlich für eigene Schreibprozesse nutzen zu können, sind die Prozesse der Textrezeption, der Textproduktion und der Textreflexion bzw. der Überarbeitung entscheidend. Diese drei Prozesse müssen stets angemessen bei der Erstellung von Lernaufgaben miteinbezogen werden. In der vorliegenden Arbeit soll deshalb zunächst darauf eingegangen werden, in wie weit das Rezipieren, Verfassen und Überarbeiten von erzählenden Texten im LehrplanPLUS eine Rolle spielt, in welche Aspekte sich narrative Kompetenz gliedert und wie diese erworben wird, zudem auf die didaktischen Konsequenzen der genannten Theorien. Daraufhin werden die Gattung der Fabel und deren zentrale Textmuster genauer betrachtet und abschließend ein mögliches Praxisbeispiel für eine Lernaufgabe zu den Charakterzügen von Fabeltieren aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aussagen des LehrplanPLUS zum schriftlichen Erzählen – am Beispiel der Fabel
- Aspekte narrativer Kompetenz
- Kontextualisierung
- Vertextung
- Markierung
- Erwerbsprozesse der schriftlichen Erzählentwicklung
- Interne und externe Ressourcen
- Interaktion
- Modelle
- Instruktion
- Didaktische Konsequenzen
- Die Fabel als schriftliche Erzählung
- Textprozeduren der schriftlichen Erzählung - Fabel
- Beispiel einer Lernaufgabe: Schriftliches Erzählen - Fabel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erwerb narrativer Kompetenz beim Schreiben von Fabeln im Deutschunterricht der Grundschule. Sie analysiert den Bezug zum LehrplanPLUS, die zentralen Aspekte narrativer Kompetenz (Kontextualisierung, Vertextung, Markierung) und deren Erwerbsprozesse. Die Arbeit zeigt didaktische Konsequenzen auf und präsentiert ein Beispiel für eine Lernaufgabe zum Thema Fabeln.
- Der LehrplanPLUS und seine Aussagen zum schriftlichen Erzählen von Fabeln
- Die Komponenten narrativer Kompetenz und deren Entwicklung
- Erwerbsprozesse narrativer Kompetenz (Ressourcen, Interaktion, Modelle, Instruktion)
- Didaktische Konsequenzen für den Unterricht
- Die Fabel als Textgattung und ihre spezifischen Textmuster
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung erzählender Texte, insbesondere Fabeln, im Grundschulunterricht. Sie hebt die Wichtigkeit von Rezeption, Produktion und Reflexion von Texten für den Erwerb narrativer Kompetenz hervor und kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an: die Rolle des LehrplanPLUS, Aspekte narrativer Kompetenz, deren Erwerb und didaktische Konsequenzen, sowie eine exemplarische Lernaufgabe.
Aussagen des LehrplanPLUS zum schriftlichen Erzählen – am Beispiel der Fabel: Dieses Kapitel analysiert den LehrplanPLUS im Hinblick auf das schriftliche Erzählen von Fabeln. Es wird der Kompetenzbereich „Schreiben“ und dessen Verknüpfung mit „Lesen mit Texten und weiteren Medien umgehen“ beleuchtet. Die Bedeutung der Textrezeption, der Aneignung von Textmustern und der Überarbeitung von Texten wird hervorgehoben. Der Lehrplan wird auf verschiedenen Jahrgangsstufen analysiert und die Bedeutung der Textmuster für den Schreibprozess betont.
Aspekte narrativer Kompetenz: Dieses Kapitel beschreibt die drei Aspekte narrativer Kompetenz: Kontextualisierung, Vertextung und Markierung. Kontextualisierung bezieht sich auf die Einbettung des Textes in einen verständlichen Kontext für den Leser, oft durch Einleitung und Schluss. Vertextung beschreibt die Fähigkeit, einen Text kohärent zu organisieren, wobei die Schreibentwicklung von losen Textteilen hin zu einer linearen und schließlich thematisch organisierten Struktur dargestellt wird. Markierung umfasst die Hervorhebung wichtiger Strukturelemente, sowohl inhaltlich als auch sprachlich-formal, mit einem Fokus auf die Entwicklung von impliziter zu expliziter Markierung und der Bedeutung der Affektmarkierung.
Erwerbsprozesse der schriftlichen Erzählentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Prozessen des Erwerbs narrativer Kompetenz. Es betrachtet interne und externe Ressourcen, die Rolle der Interaktion mit anderen Lernenden und der Lehrkraft, die Bedeutung von Modellen und die Wirkung von Instruktion. Es geht detailliert auf die verschiedenen Einflussfaktoren ein, die die Entwicklung der Fähigkeit zum Erzählen von Fabeln unterstützen.
Didaktische Konsequenzen: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den vorherigen Kapiteln und leitet didaktische Konsequenzen für den Unterricht ab. Es wird auf die praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse im Unterricht eingegangen.
Die Fabel als schriftliche Erzählung: Dieses Kapitel analysiert die Fabel als spezifische Textsorte. Es beleuchtet die charakteristischen Merkmale von Fabeln, die typischen Strukturen und sprachlichen Mittel, und die Rolle der Moral. Der Fokus liegt auf den besonderen Aspekten des Schreibprozesses, welche die spezifischen Merkmale der Fabel berücksichtigen müssen.
Textprozeduren der schriftlichen Erzählung - Fabel: Dieses Kapitel beschreibt die Textprozeduren, die beim Schreiben von Fabeln relevant sind. Es geht um den Umgang mit Figuren, Handlung, Sprache und Struktur, welche beim Verfassen einer Fabel beachtet werden müssen. Die spezifischen Textmuster der Fabel werden auf ihre didaktische Relevanz im Unterricht hin untersucht.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Erwerb narrativer Kompetenz beim Schreiben von Fabeln im Deutschunterricht der Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Erwerb narrativer Kompetenz beim Schreiben von Fabeln in der Grundschule. Sie analysiert den Bezug zum LehrplanPLUS, zentrale Aspekte narrativer Kompetenz (Kontextualisierung, Vertextung, Markierung) und deren Erwerbsprozesse. Die Arbeit zeigt didaktische Konsequenzen auf und präsentiert eine exemplarische Lernaufgabe zum Thema Fabeln.
Welche Aspekte narrativer Kompetenz werden behandelt?
Die Arbeit behandelt drei zentrale Aspekte narrativer Kompetenz: Kontextualisierung (Einbettung des Textes in einen verständlichen Kontext), Vertextung (kohärente Organisation des Textes) und Markierung (Hervorhebung wichtiger Strukturelemente). Die Entwicklung dieser Aspekte vom einfachen zum komplexen Schreiben wird detailliert beschrieben.
Wie wird der LehrplanPLUS berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert den LehrplanPLUS im Hinblick auf das schriftliche Erzählen von Fabeln, insbesondere den Kompetenzbereich „Schreiben“ und dessen Verbindung zu „Lesen mit Texten und weiteren Medien umgehen“. Die Bedeutung von Textrezeption, Aneignung von Textmustern und Textüberarbeitung wird im Kontext des Lehrplans beleuchtet.
Welche Erwerbsprozesse narrativer Kompetenz werden untersucht?
Die Arbeit untersucht interne und externe Ressourcen, die Rolle der Interaktion (mit Mitschülern und Lehrkraft), die Bedeutung von Modellen und die Wirkung von Instruktion auf den Erwerb narrativer Kompetenz beim Schreiben von Fabeln.
Welche didaktischen Konsequenzen werden gezogen?
Die Arbeit leitet aus den theoretischen Erkenntnissen didaktische Konsequenzen für den Unterricht ab und zeigt, wie diese Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden können.
Wie wird die Fabel als Textgattung behandelt?
Die Arbeit analysiert die Fabel als spezifische Textsorte, beleuchtet ihre charakteristischen Merkmale (Struktur, Sprache, Moral), und untersucht die besonderen Aspekte des Schreibprozesses, die bei Fabeln zu berücksichtigen sind.
Welche Textprozeduren beim Schreiben von Fabeln werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt relevante Textprozeduren beim Schreiben von Fabeln, wie den Umgang mit Figuren, Handlung, Sprache und Struktur. Die spezifischen Textmuster der Fabel und ihre didaktische Relevanz werden untersucht.
Gibt es ein Beispiel für eine Lernaufgabe?
Ja, die Arbeit präsentiert ein Beispiel für eine Lernaufgabe zum Thema Fabeln, welches die im Text behandelten Aspekte der narrativen Kompetenz und des Schreibprozesses berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Aussagen des LehrplanPLUS, Aspekten narrativer Kompetenz, Erwerbsprozessen, didaktischen Konsequenzen, der Fabel als Textgattung, Textprozeduren und einer exemplarischen Lernaufgabe. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Lehrkräfte der Grundschule, Lehramtsstudierende und alle, die sich für den Erwerb narrativer Kompetenz und den Deutschunterricht interessieren.
- Citar trabajo
- Sabrina Zweck (Autor), 2014, An Fabeln Textprozeduren einüben und für eigene Schreibprozesse nutzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313705