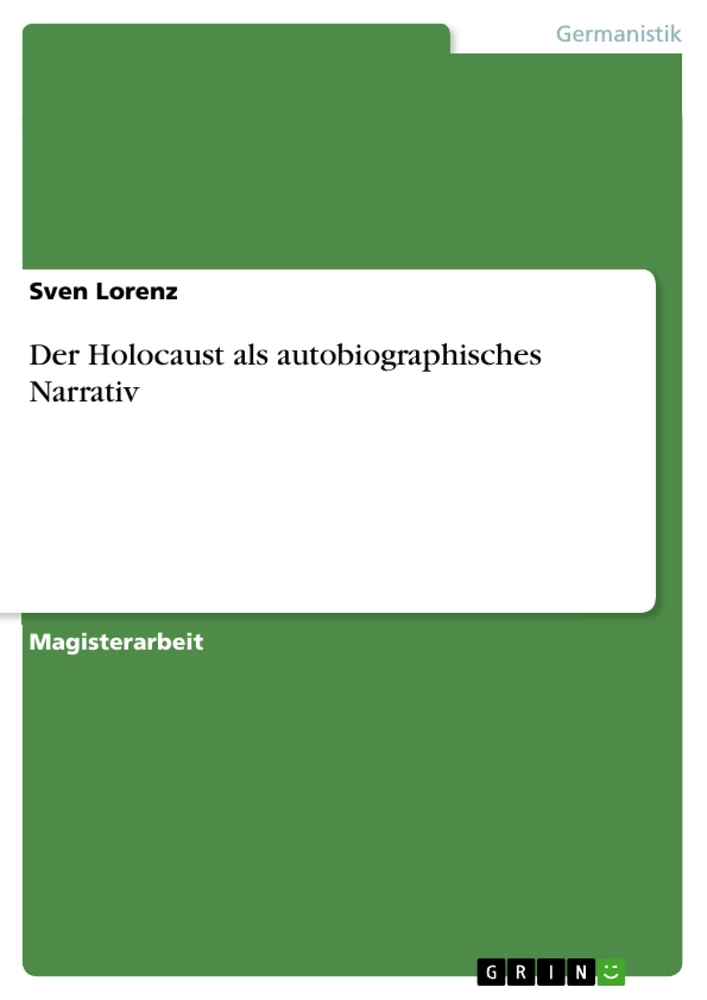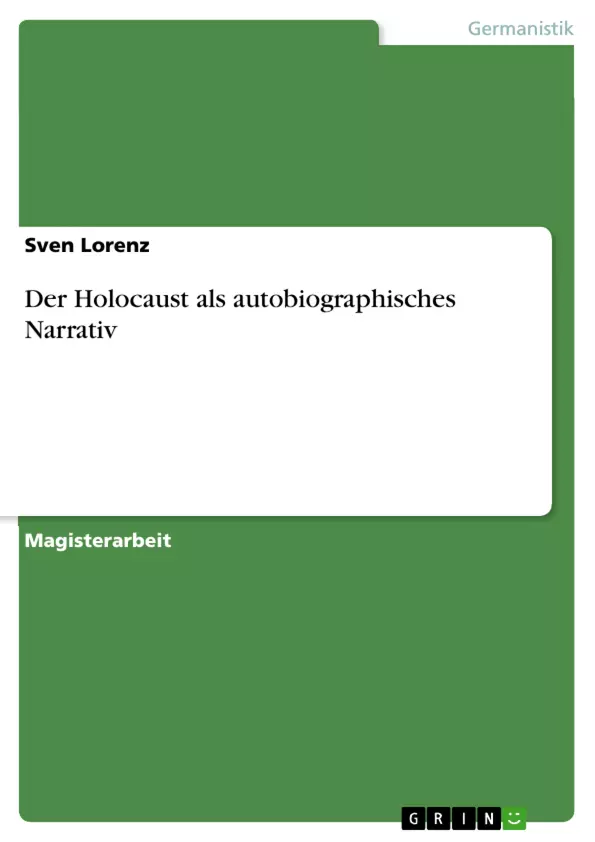In seinem Aufsatz „Wir haben ja im Grunde nichts als die Erinnerung. Ruth Klügers >weiter leben< im Kontext der neueren KZ-Literatur“ unterscheidet Christian Angerer die autobiographische Aufarbeitung des Holocausts in zwei, sich grundlegend unterscheidende, Generationen.
Die „erste“ Generation der KZ-Literatur, also die Bücher, die kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges entstanden sind: Die frühen Berichte standen unter dem drängenden Imperativ, detailliert Zeugnis abzulegen von den Leiden der Opfer und den Verbrechen der Täter. Unter der „Hypothek des Überlebthabens“ liehen die Berichterstatter den ermordeten Mithäftlingen ihre Stimme und bemühten sich um eine „objektive Darstellung“ der Lagerrealität.
Und die „zweite“ Generation, also die Bücher, die erst Jahrzehnte später entstanden sind, und auf deren Autoren diese „Hypothek“, Angerers Meinung nach, nicht mehr laste. Der Holocaust sei, beziehungsweise sollte, jedem ein Begriff sein, und es sei nicht mehr nötig der … sich oft hinter Ahnungslosigkeit oder Ungläubigkeit verschanzenden Bevölkerung die Verbrechen in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern glaubhaft zu machen … Dies sei der wesentliche Unterschied zwischen der KZ-Literatur der ersten und der zweiten Generation – musste die erste noch Zeugnis ablegen, und deshalb das Grauen bis ins kleinste Detail schildern, um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen, so könne die zweite Generation dieses Wissen voraussetzen. Während in der ersten Generation das ‚Ich’ des Autoren, die Gedanken, Gefühle, der Hintergrund, die Geschichte, die Familie und Freunde keinen Platz finden konnten, da sie, vor dem Hintergrund des Erlebten und der Pflicht des Berichtens, geradezu banal erscheinen mussten, könne sich die zweite Generation, von all diesen Pflichten befreit, viel mehr der persönlichen Erfahrung widmen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Holocaust-Autobiographie als literarische Form
- Die Autoren
- Primo Levi
- Hermann Langbein
- Elie Wiesel
- Ruth Elias
- Ruth Klüger
- Solly Ganor
- Kurzvorstellung der Autobiographien
- Primo Levi: Ist das ein Mensch?
- Hermann Langbein: Die Stärkeren
- Elie Wiesel: Die Nacht
- Ruth Elias: Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Ruth Klüger: weiter leben
- Solly Ganor: Light One Candle
- Adressaten und Schreibanlass
- Ist das ein Mensch?
- Die Stärkeren
- Die Nacht
- Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Weiter leben
- Light One Candle
- Fazit
- Aufbau, Form und Sprache
- Ist das ein Mensch?
- Die Stärkeren
- Die Nacht
- Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Weiter leben
- Light One Candle
- Fazit
- Untersuchung einiger Themen
- Religion
- Ist das ein Mensch?
- Die Stärkeren
- Die Nacht
- Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Weiter leben
- Light One Candle
- Fazit
- Eltern und Familie
- Ist das ein Mensch?
- Die Stärkeren
- Die Nacht
- Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Weiter leben
- Light One Candle
- Fazit
- Informationen / Leben während des Holocaust
- Ist das ein Mensch?
- Die Stärkeren
- Die Nacht
- Die Hoffnung erhielt mich am Leben
- Weiter leben
- Light One Candle
- Fazit
- Religion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht sechs Autobiographien von Holocaust-Überlebenden und analysiert, wie sich die Darstellung des Holocausts in den frühen Berichten von denen der späteren Generation unterscheidet. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Adressaten, der Schreibanlass, der Aufbau und die Sprache der jeweiligen Autobiographien.
- Unterschiede in der Darstellung des Holocausts zwischen den frühen und späten Berichten
- Analyse der Adressaten, des Schreibanlasses und des technischen Aufbaus der Autobiographien
- Vergleich der verwendeten Sprache und der gewählten literarischen Mittel
- Bedeutung des persönlichen Erlebens im Kontext des Holocaust
- Relevanz der Holocaust-Autobiographie als literarische Gattung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Holocaust-Autobiographie als literarische Form beleuchtet und die Unterschiede zwischen den frühen und späten Berichten herausstreicht. Anschließend werden die Autoren und ihre Autobiographien kurz vorgestellt, wobei die Schwerpunkte auf dem Schreibanlass, den Adressaten und dem Aufbau der Werke liegen.
Im darauf folgenden Kapitel wird die Sprache und die literarischen Mittel der Autobiographien analysiert, bevor die Arbeit verschiedene Themen innerhalb der Autobiographien untersucht, wie zum Beispiel Religion, Eltern und Familie sowie Informationen und das Leben während des Holocaust.
Schlüsselwörter
Holocaust-Autobiographie, literarische Form, KZ-Literatur, Erinnerungskultur, Adressaten, Schreibanlass, Aufbau, Sprache, Religion, Familie, Informationen, Leben während des Holocaust, Primo Levi, Hermann Langbein, Elie Wiesel, Ruth Elias, Ruth Klüger, Solly Ganor
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die erste von der zweiten Generation der Holocaust-Literatur?
Die erste Generation fühlte die Pflicht zur objektiven Zeugenschaft, während die zweite Generation persönliches Erleben und Reflexion stärker in den Vordergrund rücken kann.
Welche Autoren werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung umfasst Werke von Primo Levi, Hermann Langbein, Elie Wiesel, Ruth Elias, Ruth Klüger und Solly Ganor.
Wie wird das Thema Religion in den Autobiographien behandelt?
Die Arbeit vergleicht, wie unterschiedlich die Überlebenden ihren Glauben oder den Verlust desselben während und nach der Lagerhaft thematisieren.
Welche Rolle spielt die Sprache in diesen Erzählungen?
Es wird analysiert, welche literarischen Mittel und Sprachstile die Autoren nutzen, um das Unbeschreibliche der KZ-Realität zu vermitteln.
Warum ist Ruth Klügers Werk "weiter leben" besonders?
Klügers Werk wird oft als Wendepunkt zur zweiten Generation gesehen, da es sich von der reinen Berichterstattung löst und die Erinnerung selbst problematisiert.
- Quote paper
- Sven Lorenz (Author), 2004, Der Holocaust als autobiographisches Narrativ, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31393