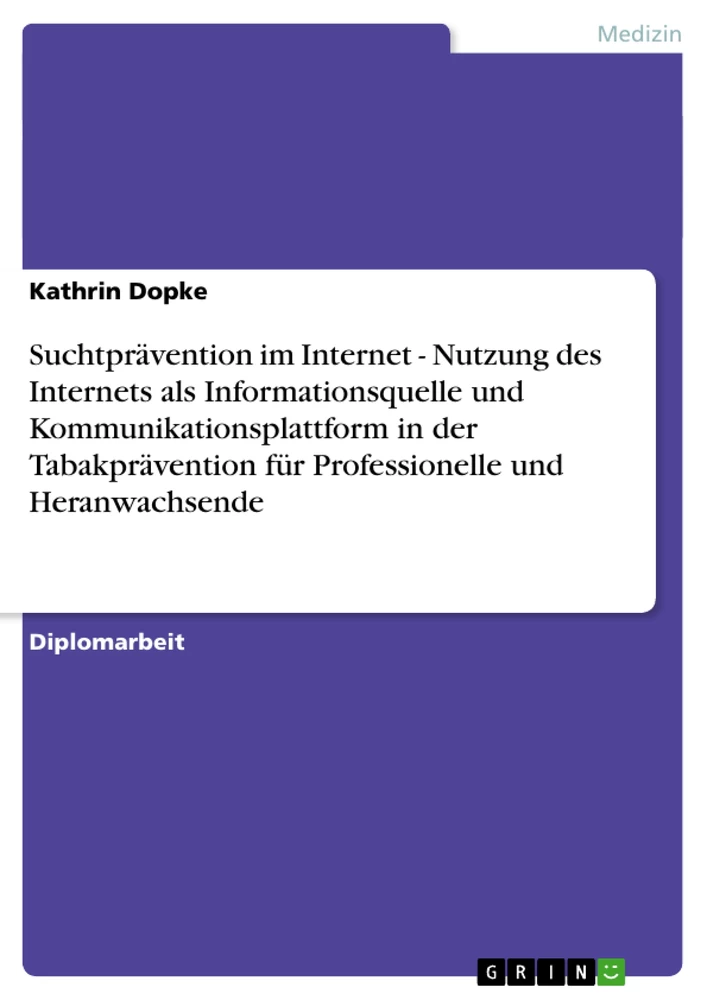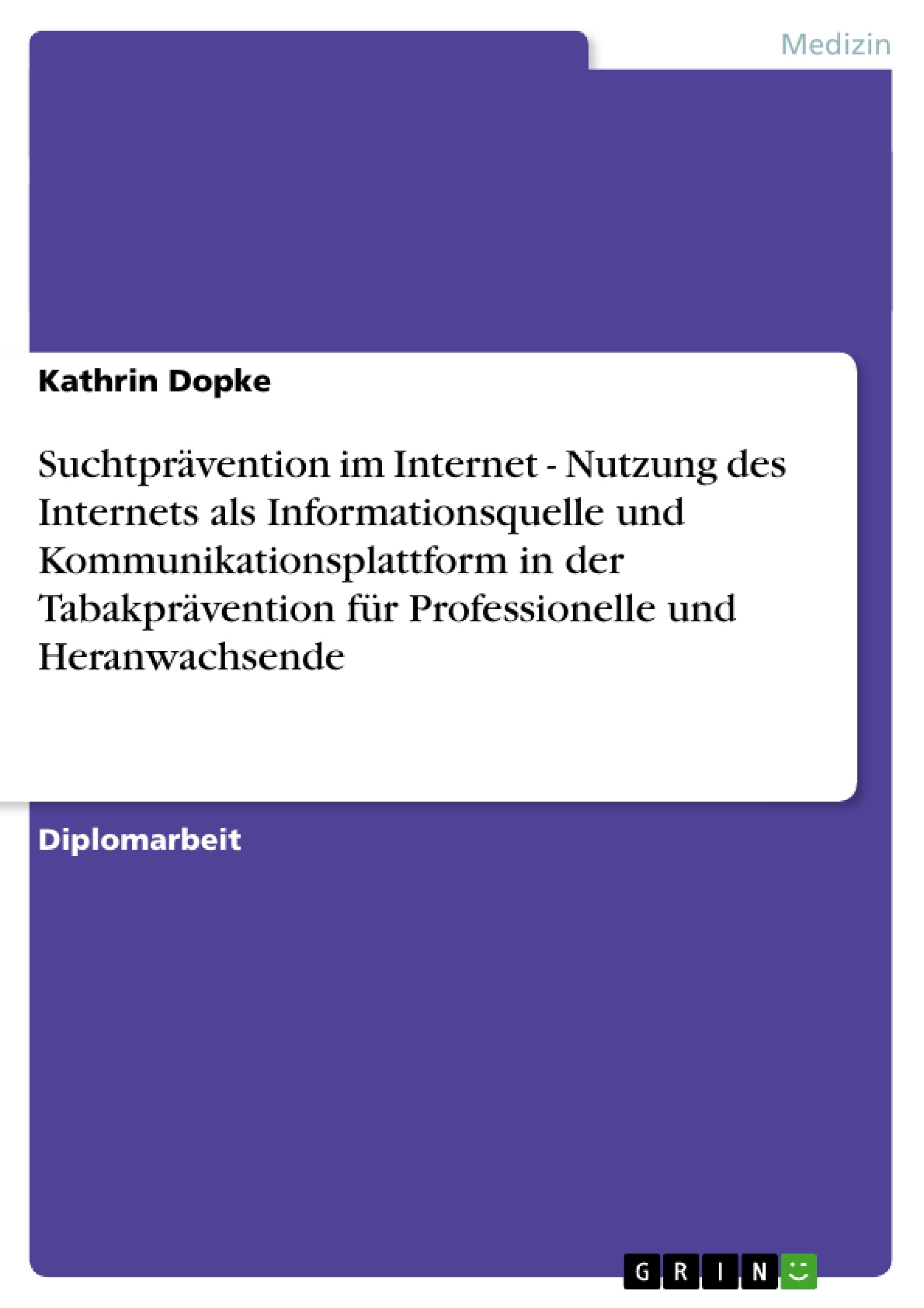Seit rund 15 Jahren stellen die Probleme rund um Konsum und Handel von legalen und illegalen Drogen für die Bundesrepublik Deutschland eines der zentralen Anliegen der Gesundheitspolitik dar. Allerdings stehen die Folgen des Alkoholmissbrauchs und des Tabakkonsums, die umfangmässig viel bedeutender sind, oft im Schatten des politischen Interesses und der Aufmerksamkeit der Medien.
Zur Wahrnehmung der Verantwortung der Regierung für die Gesundheit ihres Volkes sind Schritte erforderlich, die zum einen auf klaren Fakten basieren und die zum anderen den jeweiligen Problemen und ihrer Dimension auf angemessene Weise begegnen.
Die klaren Fakten sind epidemiologische Zahlen, die belegen, dass in der Bundesrepublik Deutschland in grossem Umfang legale und illegale Drogen konsumiert werden.
Herbst et al. zeigen durch Repräsentativerhebungen, dass von 7833 Probanden im Alter von 18 – 59 Jahren 42,6% der Männer und 29.4% der Frauen rauchen.
Mit über 10 Litern reinen Alkohols pro Einwohner kann Deutschland als ein Hochkonsumland bezeichnet werden.
Fakten sind auch die Tatsachen, dass Mitte der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 3,5 Millionen Männer und 2,5 Millionen Frauen regelmässig rauchen; 2,5 Millionen Menschen gelten als alkoholkrank, wovon die Zahl der Männer mit 1,7 Millionen als doppelt so hoch angesehen werden muss.
Medikamentenabhängig sind in diesem Zeitraum 400.000 Männer und 1 Million Frauen und 150.000 Menschen ( 100.000 Männer und 50.000 Frauen ) gelten als abhängig von illegalen Drogen.
Alkohol und Tabak gelten - im Gegensatz zu den illegalen Drogen – seit so langer Zeit und in so hohem Masse als fester Bestandteil unserer Kultur, dass man geneigt ist, über ihre negativen Auswirkungen hinwegzusehen. Der Handel mit Alkohol und Tabak und die Werbung für diese legalen Drogen gehören zum Alltagsbild jeder Stadt und die Wirtschaft hütet die Industrie – und Agrarzweige dieser beiden Genuss – und Suchtmittel wie zwei Kleinode unserer nationalen Produktion.
Inhaltsverzeichnis
- Schlussfolgerung
- Vorwort
- 1. Suchtprävention in der BRD
- 1.1. Aufgaben und Interventionen des Staates
- 1.2. Konzeptionelle Grundlagen der Suchtprävention
- 1.3. Die Begrifflichkeit in der Prävention
- 1.3.1. Primäre Prävention im Bereich der legalen Drogen
- 1.3.2. Sekundäre Prävention im Bereich der legalen Drogen
- 1.3.3. Tertiäre Prävention im Bereich der legalen Drogen
- 1.4. Darstellung der ausgewählten Zielgruppe
- 1.5. Benennung der in Suchtprävention tätigen Institutionen
- 1.6. LO
- 2. Suchtprävention durch Medien
- 2.1. Darstellung der an Suchtprävention beteiligten Medien
- 2.2. Suchtprävention im Kontext einer Gesundheitskommunikation
- 2.3. Suchtprävention in den Medien – beteiligte Institutionen
- 2.4. Ein Vergleich: Nutzung des Internets in der Tabakprävention durch die Schweiz
- 3. Suchtprävention am Beispiel der Tabakprävention
- 3.1. Darstellung der medizinischen Aspekte des Rauchens – ein Krankheitsbild
- 3.2. Zahlen und Fakten
- 3.3. Die Rolle der Wirtschaft - Rauchen als Wirtschaftsfaktor
- 3.4. Politische Aspekte und Gesetzesgrundlagen – die Tabaksteuer
- 3.5. Passivrauchen
- 3.6. Spezielle Argumente von jugendlichen Rauchern und Nichtrauchern
- 3.7. Schlussfolgerung
- 4. Die Homepage für die Tabakprävention
- 4.1. Kinder und Jugendliche im Umgang mit dem Internet
- 4.2. Möglichkeiten für Professionelle im Bereich Prävention im Internet
- 4.3. Eine Marktanalyse zur Tabakprävention im Internet
- 4.4. Angebotspalette für das Erstellen der Website „Ich rauche und will aufhören“
- 5. Perspektiven der Suchtprävention
- 5.1. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
- 5.2. Gewichtung der einzelnen Medien
- 5.3. Arbeitsfelder der Suchtprävention
- 5.4. Suchtforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Suchtprävention im Internet, insbesondere im Bereich der Tabakprävention. Sie analysiert die Nutzung des Internets als Informationsquelle und Kommunikationsplattform für professionelle und heranwachsende Nutzer.
- Die Rolle des Internets in der Suchtprävention
- Die Herausforderungen der Tabakprävention
- Die Bedeutung der Gesundheitskommunikation im Internet
- Die Entwicklung einer Website für die Tabakprävention
- Die Perspektiven der Suchtprävention im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einem Überblick über die Suchtprävention in der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Aufgaben und Interventionen des Staates, konzeptionelle Grundlagen und die verschiedenen Präventionsstufen im Bereich der legalen Drogen beleuchtet werden. Des Weiteren wird die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen sowie die beteiligten Institutionen vorgestellt.
In Kapitel 2 wird die Rolle von Medien in der Suchtprävention thematisiert. Die Arbeit analysiert die beteiligten Medien, die Bedeutung der Gesundheitskommunikation im Kontext der Suchtprävention und stellt die involvierten Institutionen vor. Ein Vergleich mit der Schweiz und ihrer Nutzung des Internets in der Tabakprävention rundet dieses Kapitel ab.
Kapitel 3 widmet sich dem Beispiel der Tabakprävention. Es werden die medizinischen Aspekte des Rauchens, Zahlen und Fakten zum Tabakkonsum, die Rolle der Wirtschaft, politische Aspekte und Gesetzesgrundlagen sowie das Passivrauchen behandelt. Darüber hinaus werden spezielle Argumente von jugendlichen Rauchern und Nichtrauchern beleuchtet.
In Kapitel 4 wird die Entwicklung einer Website für die Tabakprävention im Detail beschrieben. Es werden die Nutzung des Internets durch Kinder und Jugendliche, die Möglichkeiten für professionelle Präventionsarbeit im Internet sowie eine Marktanalyse zur Tabakprävention im Internet betrachtet. Die Arbeit stellt auch die Angebotspalette für die Entwicklung der Website „Ich rauche und will aufhören“ vor.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Internet, Tabakprävention, Gesundheitskommunikation, Kinder und Jugendliche, Professionelle, Website, Marktanalyse, Angebotspalette, Mediennutzung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Internet in der Tabakprävention genutzt?
Es dient als Informationsquelle und interaktive Kommunikationsplattform, um sowohl Professionelle als auch Heranwachsende gezielt über Risiken und Ausstiegshilfen zu informieren.
Welche Vorteile bietet das Internet gegenüber klassischen Medien?
Das Internet ermöglicht Anonymität, ständige Verfügbarkeit und eine zielgruppengerechte Ansprache (z.B. durch interaktive Tools für Jugendliche).
Was sind die Aufgaben des Staates in der Suchtprävention?
Der Staat ist verantwortlich für Aufklärung, Gesetzgebung (z.B. Tabaksteuer) und die Förderung von Programmen zur Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention.
Welche Rolle spielt die Wirtschaft beim Thema Rauchen?
Tabak wird oft als Wirtschaftsfaktor geschützt, was im Gegensatz zu gesundheitspolitischen Zielen steht und die Präventionsarbeit erschweren kann.
Wie sollte eine Website zur Tabakentwöhnung gestaltet sein?
Sie sollte auf einer Marktanalyse basieren, spezifische Argumente für Jugendliche bieten und konkrete Hilfestellungen wie „Ich rauche und will aufhören“ enthalten.
- Quote paper
- Kathrin Dopke (Author), 2004, Suchtprävention im Internet - Nutzung des Internets als Informationsquelle und Kommunikationsplattform in der Tabakprävention für Professionelle und Heranwachsende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31398