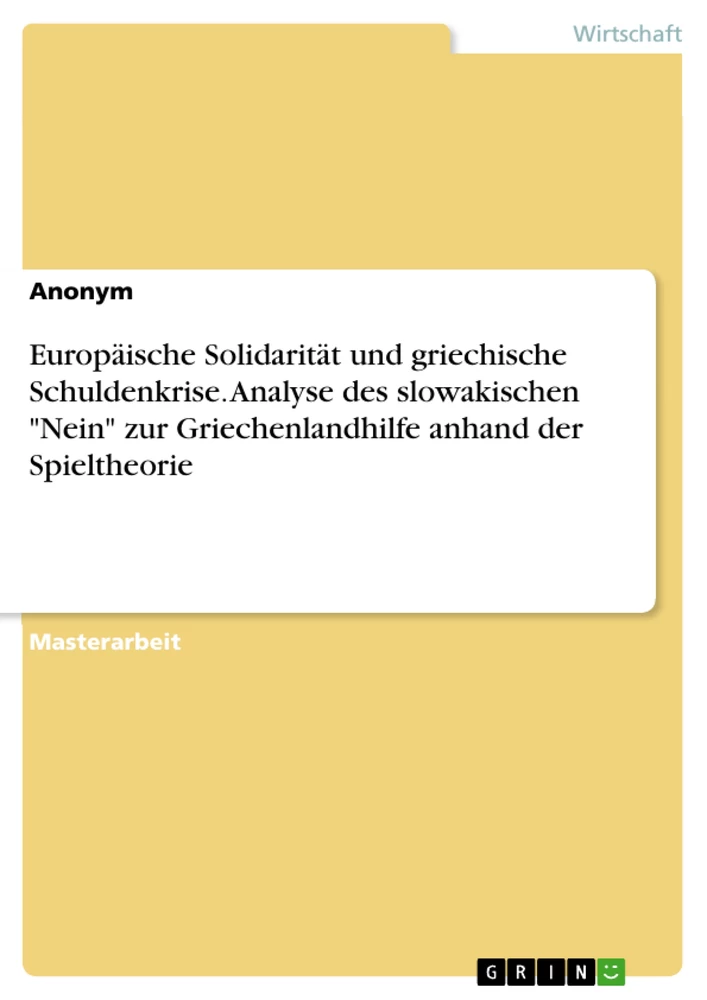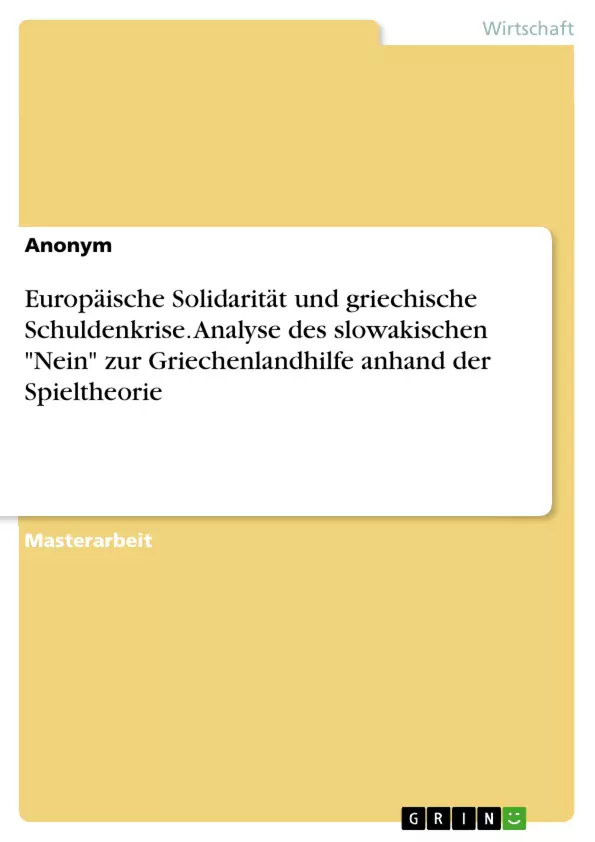Europäische Solidarität und griechische Schuldenkrise.
Ein bedeutender Zeitpunkt für die EU war der Dezember 2009, in welchem die griechische Schuldenkrise ausbrach und somit in Europa und der restlichen Welt wahrgenommen wurde. Aufgrund dieser ernsthaften Krisensituation beschließen die Regierungschefs der Euroländer im März 2010 eine zur Vermeidung des griechischen Staatsbankrotts dienende Hilfe in Form von bilateralen Krediten.
Als Motivationshintergrund für diese Hilfsleistungen diente der Wert der Solidarität in der EU. Diese Hilfe wurde zunächst von allen zu dem Zeitpunkt zur Eurozone gehörenden Mitgliedsstaaten – außer Griechenland – befürwortet. Die endgültige Zustimmung im August 2010 kam aber nur von vierzehn Mitgliedsstaaten der Eurozone. Die Slowakei lehnte diese Hilfe als einziges Land der Eurozone ab. Nach dieser Absage wurde die Slowakische Republik sehr stark kritisiert. Die Kritiker nannten die negative Entscheidung der Slowakei einen Verstoß gegen die europäische Solidarität. Demgegenüber reagieren die slowakischen Politiker nicht nur mit der Verteidigung ihres „Nein“ zur Griechenlandhilfe, sondern auch mit der Aussage, dass sie gegen keine Solidarität verstießen. Aufgrund von diesen Meinungsverschiedenheiten entstand ein Konflikt, welcher ungelöst blieb. Auf der Ebene der EU, in der Presse oder in anderen Medien gab es nur Darstellungen der Meinungsverschiedenheiten, nie aber eine genaue Analyse dieser Problematik oder eine Lösung dieses Konflikts. An dieser Stelle stellte man sich also die Frage, was überhaupt europäische Solidarität im Kontext der griechischen Schuldenkrise bedeutet. Um diese Fragestellung zu beantworten, erfasste man den Stand der Literatur im deutschsprachigen Raum zum Thema der europäischen Solidarität.
Tomuschat veröffentlichte im Jahr 1987 als Erster eine Studie, welche sich mit der europäischen Solidarität beschäftigte. Im Jahr 1997 folgte ihm Zuleeg und ein Jahr später auch Volkmann mit der Analyse der Entstehung der Solidarität in der EU. Gussone gab im Jahr 2006 sein Buch „Das Solidaritätsprinzip in der EU und seine Grenzen“ heraus. Im Jahr 2007 erforschte Lais in ihrem wissenschaftlichen Beitrag „Das Solidaritätsprinzip im europäischen Verfassungsverbund“ die Bedeutung der Solidarität für die EU sowie ihr Rechtsprinzip und dessen Ausprägungen. Calliess untersuchte das Konfliktpotenzial zwischen rechtlichem Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip der EU. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Von der griechischen Schuldenkrise zur Solidarität in der EU
- 2. Solidarität der Europäischen Union
- 2.1 Solidarität
- 2.1.1 Ursprung und Bedeutung von Solidarität
- 2.1.2 Trennung des Solidaritätsbegriffs von anderen verwandten Begriffen
- 2.1.3 Entwicklung und Formen der Solidarität
- 2.2 Solidarität in der Rechtsgemeinschaft der Europäischen Union
- 2.2.1 Funktionsweise des Unionsrechts
- 2.2.1.1 Verbindliche Rechtsakte der EU
- 2.2.1.2 Unverbindliche Handlungsformen der EU - „Soft law“
- 2.2.2 Verbindung von Unionsrecht und Solidarität
- 2.2.3 Solidarität im Recht der EU
- 2.3 Solidaritätsprinzip der EU
- 2.3.1 Solidaritätsprinzip als Rechtsprinzip der EU
- 2.3.2 Solidaritätsprinzip als Politisches Prinzip der EU
- 2.3.3 Dimensionen des rechtlichen Solidaritätsprinzips der EU
- 2.3.3.1 Prozedurale Dimension
- 2.3.3.1.1 Rechtliche Pflicht zum solidarischen Verhalten
- 2.3.3.1.2 Rechtliche Regelung des solidarischen Verhaltens
- 2.3.3.2 Materielle Dimension
- 2.3.3.2.1 Finanzausgleich - Bedeutung und Funktionsweise
- 2.3.3.2.2 Die materielle Dimension der Solidarität im Finanzsystem der EU
- 3. Solidarität in der Wirtschafts- und Währungsunion der EU
- 3.1 Wirtschafts- und Währungsunion der EU
- 3.1.1 Grundsätze der Solidität in der Wirtschafts- und Währungsunion
- 3.1.2 Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion
- 3.2 Eingeschränkte Solidarität in der Wirtschafts- und Währungsunion
- 3.3 Rechtliche Grenzen der Solidarität in der Wirtschafts- und Währungsunion
- 3.3.1 Finanzierungsausschluss
- 3.3.2 Haftungsausschluss - Nichtbeistandsklausel
- 3.3.2.1 Ausnahme der Nichtbeistandsklausel
- 3.3.2.2 Unterschiedliche Sichtweise der Nichtbeistandsklausel
- 3.3.2.3 Teleologische Reduktion der Nichtbeistandsklausel
- 3.3.2.4 Teleologische Reduktion als Anreiz für Moral-Hazard-Verhalten
- 4. Die erste Griechenlandhilfe im Mai 2010
- 4.1 Wirtschaftliche und politische Entwicklung Griechenlands
- 4.2 Ursachen der griechischen Schuldenkrise
- 4.3 Gewährung der ersten Griechenlandhilfe im Mai 2010
- 4.3.1 EK, EZB und IWF - europäische Troika
- 4.3.2 Mitgliedstaaten der Eurozone
- 4.3.3 Maßnahmen von Griechenland
- 4.4 Einstellung der Slowakei zur Griechenlandhilfe
- 5. Solidarität und Griechenlandhilfe
- 5.1 Befürwortende Partei
- 5.2 Gegnerische Partei
- 5.3 Vergleich der Solidaritätssichtweise der beiden Parteien
- 5.3.1 Analyse und Definition der Solidarität nach der befürwortenden Partei
- 5.3.2 Analyse und Definition der Solidarität nach der gegnerischen Partei
- 5.3.3 Konflikt zwischen Solidaritätsverständnissen in der griechischen Schuldenkrise
- 6. Spieltheoretische Analyse des slowakischen „Nein“ zur Griechenlandhilfe
- 6.1 Gefangenendilemma
- 6.2 Spieltheoretische Darstellung des Entscheidungsprozesses der Griechenlandhilfe
- 6.2.1 Solidaritätsdilemma der Slowakei
- 6.2.2 Mögliche Gründe für die Ablehnung der Griechenlandhilfe
- 7. Solidarisch oder unsolidarisch? Abschließende Bewertung der slowakischen Ablehnung zur Griechenlandhilfe
- II. Literaturverzeichnis
- III. Anhang
- Die Rolle des Solidaritätsprinzips in der Europäischen Union
- Die verschiedenen Interpretationen und Grenzen des Solidaritätsprinzips in der Wirtschafts- und Währungsunion
- Die Ursachen und Auswirkungen der griechischen Schuldenkrise
- Die Spieltheoretische Analyse des slowakischen „Nein“ zur Griechenlandhilfe
- Die Auswirkungen des slowakischen „Nein“ auf das Solidaritätsverständnis innerhalb der EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Analyse des slowakischen „Nein“ zur Griechenlandhilfe im Jahr 2010 im Kontext der Europäischen Solidarität und der griechischen Schuldenkrise. Sie verwendet spieltheoretische Modelle, um den Entscheidungsprozess der Slowakei zu analysieren und die zugrundeliegenden Motivationen und Herausforderungen zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Europäischen Solidarität und der griechischen Schuldenkrise. Sie beleuchtet die Entwicklung des Solidaritätsbegriffs in der EU und die Bedeutung des Solidaritätsprinzips im Unionsrecht. Anschließend wird die Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion analysiert, wobei der Fokus auf die Grenzen der Solidarität in diesem Bereich liegt.
Kapitel 4 befasst sich mit der ersten Griechenlandhilfe im Mai 2010. Es wird die wirtschaftliche und politische Entwicklung Griechenlands im Vorfeld der Krise beleuchtet sowie die Ursachen für die Schuldenkrise analysiert. Die Gewährung der ersten Griechenlandhilfe wird im Detail beschrieben und die Einstellung der Slowakei zur Hilfe wird vorgestellt.
Kapitel 5 analysiert das Solidaritätsverständnis von Befürwortern und Gegnern der Griechenlandhilfe. Es werden die verschiedenen Interpretationen des Solidaritätsprinzips untersucht und der Konflikt zwischen den beiden Sichtweisen wird beleuchtet.
Kapitel 6 wendet spieltheoretische Modelle auf den Entscheidungsprozess der Slowakei an. Es wird das Gefangenendilemma als Modell für die Analyse des Solidaritätsdilemmas der Slowakei verwendet und mögliche Gründe für die Ablehnung der Griechenlandhilfe werden beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert sich auf die Bereiche Europäische Solidarität, griechische Schuldenkrise, Spieltheorie, Solidaritätsprinzip, Nichtbeistandsklausel, Wirtschafts- und Währungsunion, Entscheidungsprozess, Moral Hazard, Gefangenendilemma, Slowakei, Griechenlandhilfe.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2013, Europäische Solidarität und griechische Schuldenkrise. Analyse des slowakischen "Nein" zur Griechenlandhilfe anhand der Spieltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314026