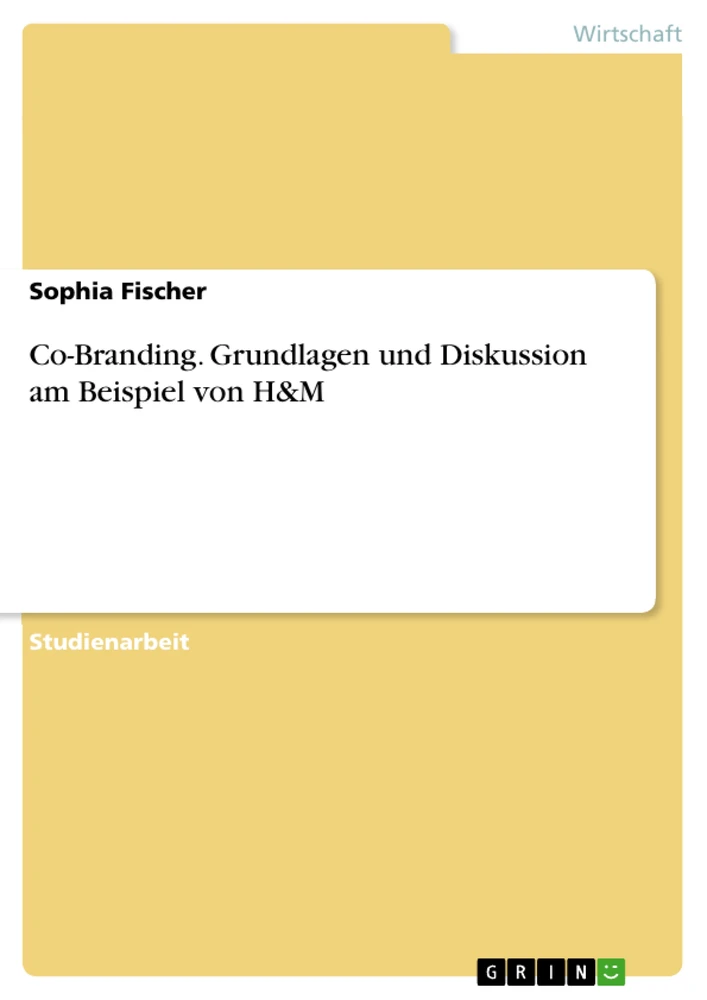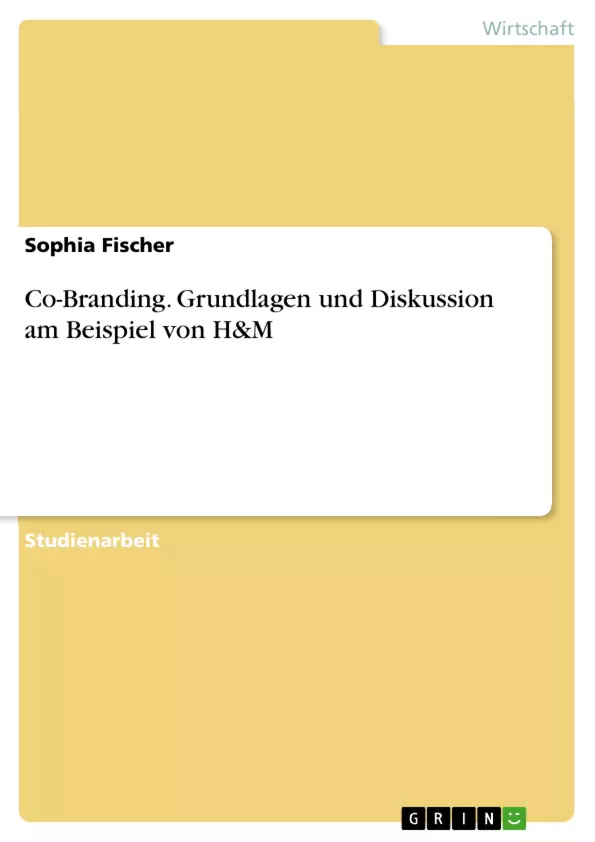„In Zukunft ist die Marke das wichtigste Kapital eines Unternehmens.“ Diese Aussage von KAPFERER hat bereits vor Jahren den Anstieg der Markenbedeutungen vorausgesagt.
Bestätigt wird diese Aussage durch eine Umfrage, der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMa). Diese liefert das Ergebnis, dass in Deutschland im Jahr 2013 rund 39,6 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre beim Kauf von Mode und Bekleidung eher auf die Marke als auf den Preis achteten. Angesichts dessen beschäftigt sich der Autor in dieser Arbeit mit der Bildung von Markenallianzen, insbesondere dem Co-Branding. Vertieft wird das Vorgehen anhand der Vorstellung und der Diskussion am Praxisbeispiel H&M. Die Modemarke hat seit 2004 mit einer Vielzahl von bekannten Personen neue Modelinien kreiert.
Zunächst stellt sich jedoch die Frage: was ist Co-Branding? Und welche Effekte bringt es mit sich? Worauf muss geachtet werden? In Bezug auf die Modebranche kommen weitere Fragen auf: Wie setzt H&M mit den Designer und Berühmtheiten die Strategie des Co-Brandings um? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Modewelt?
Im Laufe dieser Arbeit wird auf die Fragestellungen näher eingegangen. In dem folgen-den Kapitel werden vorerst die Begrifflichkeiten einer Marke und des Co-Brandings erläutert. Daraufhin werden auf die verschieden Ausprägungsformen und die Faktoren, die den Erfolg einer Markenallianz beeinflussen, erläutert. Das zweite Kapitel schließt mit der Implementierungsstrategie.
Im dritten Kapitel wird das Praxisbeispiel betrachtet. Die Ziele und die verfolgte Strategie von H&M bei der Umsetzung des Co-Brandings werden erörtert. Anschließend folgt eine Auflistung der Chancen und Risiken für Fast Fashion und Luxusmarken in Bezug auf die Kooperation mit Dritten. Abschließend werden die induzierten Auswirkungen dieser Vorgehensweise genannt und anhand eines Ausgewählten Beispiels näher gebracht, ob die Umsetzung von Co-Branding bei H&M erfolgreich verläuft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Theorie
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.1.1 Marke & Markenpolitik
- 2.1.2 Co-Branding
- 2.2 Ausprägungsformen
- 2.3 Erfolgsfaktoren
- 2.4 Implementierung
- 2.1 Begriffserklärung
- 3 Praxisbeispiel H&M
- 3.1 Ziele des Co-Brandings
- 3.2 Strategie
- 3.3 Chancen und Risiken
- 3.4 Auswirkungen
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Co-Branding und analysiert dessen Bedeutung für das Markenmanagement. Dabei wird das Praxisbeispiel von H&M im Vordergrund stehen.
- Begriffserklärung und -abgrenzung von Co-Branding
- Ausprägungsformen und Erfolgsfaktoren von Co-Branding
- Die Implementierung von Co-Branding in der Praxis
- Analyse des Co-Brandings im Kontext von H&M
- Bewertung der Chancen und Risiken von Co-Branding
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Co-Branding ein und definiert den Begriff sowie dessen Relevanz für die Markenpolitik. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Ausprägungsformen von Co-Branding vorgestellt und die wichtigsten Erfolgsfaktoren erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der praktischen Implementierung von Co-Branding anhand des Beispiels von H&M. Dabei werden die Ziele, die Strategie, die Chancen und Risiken sowie die Auswirkungen des Co-Brandings auf H&M analysiert. Das vierte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Co-Branding, Markenmanagement, Markenpolitik, H&M, Fashion, Erfolgsfaktoren, Chancen und Risiken, Implementierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Co-Branding?
Co-Branding ist eine Markenallianz, bei der mindestens zwei etablierte Marken gemeinsam ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, um Synergieeffekte zu nutzen.
Warum nutzt H&M Co-Branding-Strategien?
H&M kooperiert mit Luxusdesignern (wie Karl Lagerfeld oder Versace), um Exklusivität zu schaffen, das Markenimage aufzuwerten und neue Kundengruppen anzusprechen.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Markenallianz?
Entscheidend sind die Passung (Fit) der Markenwerte, die Bekanntheit der Partner und ein klarer Mehrwert für den Kunden.
Welche Risiken birgt Co-Branding für Luxusmarken?
Es besteht die Gefahr der Markenverwässerung, wenn die Exklusivität der Luxusmarke durch die Massenverfügbarkeit bei einem Fast-Fashion-Partner wie H&M leidet.
Welchen Einfluss hat Co-Branding auf das Kaufverhalten?
Viele Konsumenten achten heute stärker auf die Marke als auf den Preis; Co-Branding nutzt diesen Trend, um durch zeitlich begrenzte Kollektionen hohe Kaufanreize zu setzen.
- Arbeit zitieren
- Sophia Fischer (Autor:in), 2015, Co-Branding. Grundlagen und Diskussion am Beispiel von H&M, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314115