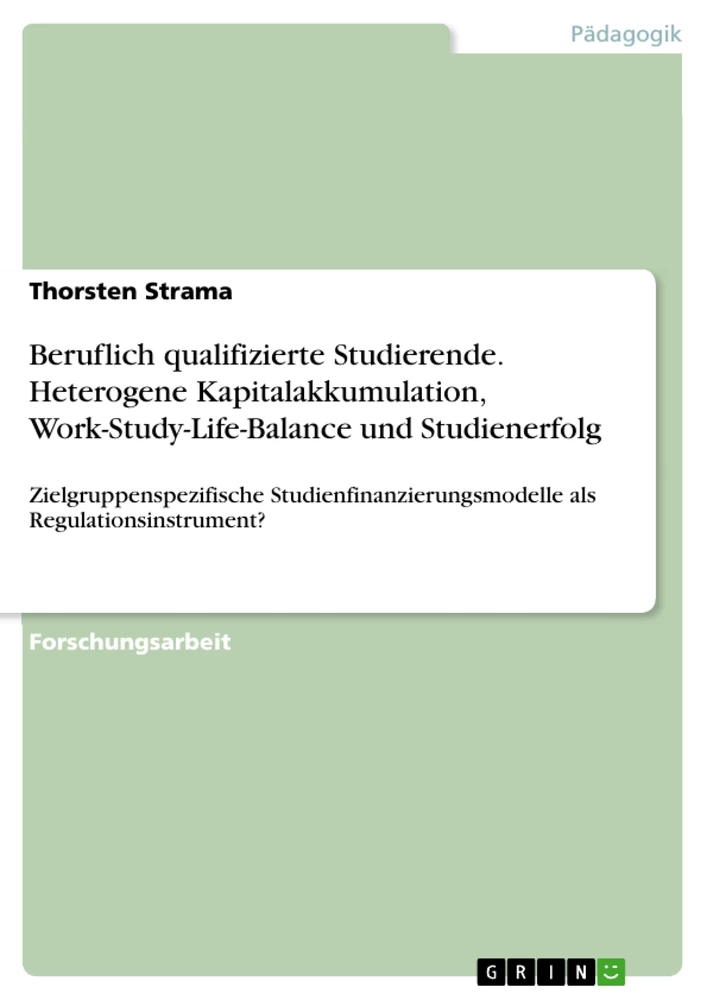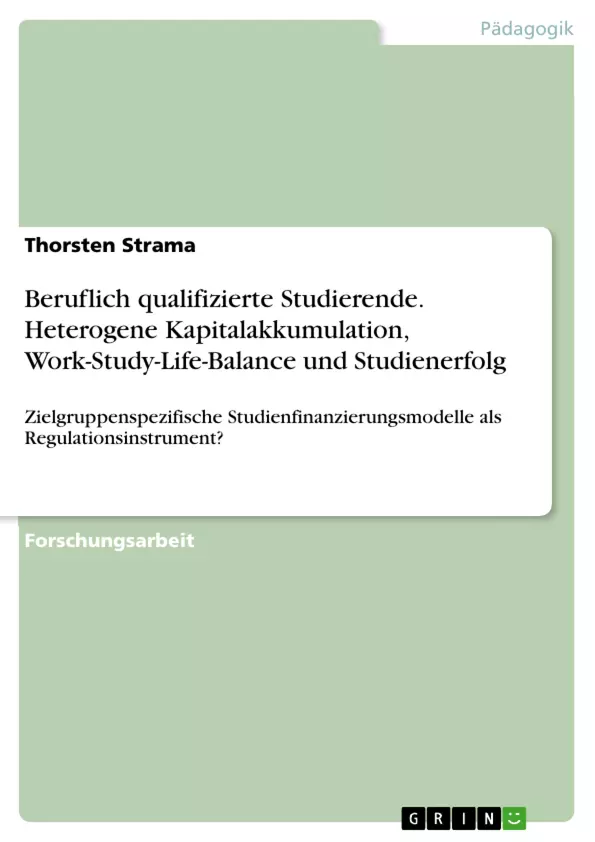Die strikte institutionelle Segmentierung von allgemeiner und beruflicher Bildung, die Baethge als „das deutsche Bildungs-Schisma“ (2007, S. 93) bezeichnet, ist eine Erbschaft aus dem 19. Jahrhundert. Basierend auf der curricularen Ausrichtung des Gymnasiums zur Zeit des deutschen Bildungsidealismus entwickelte sich der Exklusivitätscharakter der Hochschulreife als Zugangsbefähigung zum tertiären Bildungssektor, der eine Hochschulöffnung für einen beruflich qualifizierten Personenkreis nachhaltig erschwerte. Wenngleich sich Kontroversen über liberalere Hochschulzugangsrechte für diese Zielgruppe bis in die Anfänge der Weimarer Republik zurückverfolgen lassen, sehen Kritiker hierin damals wie heute eine Abwertung des akademischen Systems (Wolter, im Erscheinen, Absatz 5–6).
Die wohl einflussreichste Zäsur in diesem Entwicklungszeitraum stellt der Beschluss der Kultusministerkonferenz über den „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung“ (KMK, 2009) dar, der für neue Dynamik im Diskursfeld des Dritten Bildungsweges sorgte. Hieraus sind mehrere politische Initiativen zur Förderung der Durchlässigkeit beider Subsysteme erwachsen (Nickel & Püttmann, 2015, S. 87; Wolter, im Erscheinen, Absatz 1; Wolter, Dahm, Kamm, Kerst, & Otto, 2015, S. 12).
Ein Bereich, der von diesen Fördermaßnahmen jedoch weitgehend unberührt bleibt, ist die Studienfinanzierungssituation, die BQ-Studierende hinsichtlich relevanter Förderkriterien ausschließt. Weiterhin besteht ein noch sehr geringer Wissensstand über diese Zielgruppe, speziell was die zeitliche Aufwendung für Studium, Berufstätigkeit, Freizeit und Familie und die Gestaltung der W-S-L-Balance betrifft. Ebenso rudimentär sind empirische Erkenntnisse über den Studienerfolg und Studienabbruch – diese stammen überwiegend aus Studien der 1980er- und 1990er-Jahre (Nickel & Püttmann, 2015, S. 94; Otto & Herzog, 2013, S. 100; Jürgens & Zinn, 2015, S. 48).
Diese empirische Forschungsarbeit widmet sich dem Dritten Bildungsweg unter den genannten Aspekten der Studienfinanzierung, W-S-L-Balance und Erfolgsfaktoren. Dabei soll in einer qualitativen Einzelfallanalyse erforscht werden, welche Auswirkungen zielgruppengerechte Studienfinanzierungsmodelle als Regulationsfunktion auf die W-S-L-Balance und den Studienerfolg der Zielgruppe erwarten lassen und welche Bedeutung in diesem Kontext der sozialen und ökonomischen Kapitalausstattung zukommt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1 Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu
- 2.2 Stand der Forschung und Ableitung der Hypothesen
- 3. Empirischer Teil
- 3.1 Methoden
- 3.1.1 Erhebungsmethode: Experteninterview
- 3.1.2 Feldzugang
- 3.1.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.2 Interpretation der Ergebnisse
- 3.3 Beantwortung der Forschungsfrage
- 3.4 Ausblick und Empfehlungen unter theoretischem Rückbezug
- 4. Fazit und methodische Reflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang 1: Abkürzungsverzeichnis
- Anhang 2: Abbildungen
- Anhang 3: Interviewleitfaden
- Anhang 4: Transkriptionsregeln
- Anhang 5: Transkription des Experteninterviews
- Anhang 6: Post-Interview-Memo
- Anhang 7: Auswertungstabelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Forschungsarbeit untersucht die Studienfinanzierung, Work-Study-Life-Balance und Erfolgsfaktoren von beruflich qualifizierten Studierenden ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die diese Gruppe im Studium erlebt, und befasst sich mit der Frage, ob zielgruppenspezifische Studienfinanzierungsmodelle als Regulationsinstrument dienen könnten.
- Studienfinanzierung von beruflich qualifizierten Studierenden
- Work-Study-Life-Balance im Studium
- Erfolgsfaktoren für beruflich qualifizierte Studierende
- Regulierungsmöglichkeiten durch zielgruppenspezifische Studienfinanzierungsmodelle
- Empirische Erkenntnisse über den Studienerfolg und Studienabbruch in dieser Zielgruppe
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Der theoretische Teil beleuchtet die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu und analysiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Der empirische Teil beschreibt die durchgeführte Experteninterview-Studie und die qualitative Inhaltsanalyse der Daten. Die Ergebnisse werden interpretiert und zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen. Abschließend werden Empfehlungen unter theoretischem Rückbezug gegeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Dritter Bildungsweg, beruflich qualifizierte Studierende, Studienfinanzierung, Work-Study-Life-Balance, Studienerfolg, Studienerfolg, Studienabbruch, Experteninterview, qualitative Inhaltsanalyse, Kapitaltheorie, Pierre Bourdieu.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind „beruflich qualifizierte Studierende“ (BQ-Studierende)?
Dies sind Personen, die ohne klassisches Abitur, aber aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation (Dritter Bildungsweg) ein Studium aufnehmen.
Was versteht man unter dem „deutschen Bildungs-Schisma“?
Der Begriff beschreibt die strikte institutionelle Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung, die den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte lange erschwert hat.
Wie beeinflusst die Studienfinanzierung den Erfolg von BQ-Studierenden?
Viele BQ-Studierende sind von gängigen Fördermodellen ausgeschlossen, was Auswirkungen auf ihre Work-Study-Life-Balance und das Risiko eines Studienabbruchs hat.
Welche Rolle spielt die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu in dieser Arbeit?
Die Theorie wird genutzt, um die Bedeutung der sozialen und ökonomischen Kapitalausstattung für den Studienerfolg dieser spezifischen Zielgruppe zu analysieren.
Wie lässt sich die Work-Study-Life-Balance dieser Studierenden verbessern?
Die Arbeit untersucht, ob zielgruppengerechte Studienfinanzierungsmodelle als Regulationsfunktion dienen können, um Zeitkonflikte zwischen Beruf, Studium und Familie zu mindern.
- Quote paper
- Thorsten Strama (Author), 2015, Beruflich qualifizierte Studierende. Heterogene Kapitalakkumulation, Work-Study-Life-Balance und Studienerfolg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314166