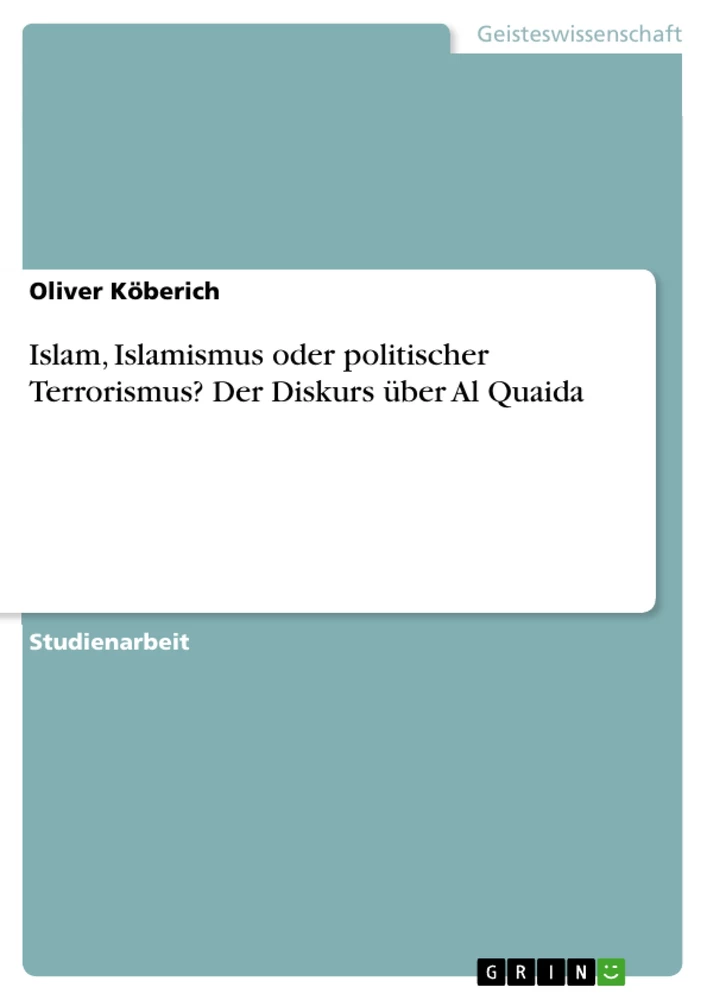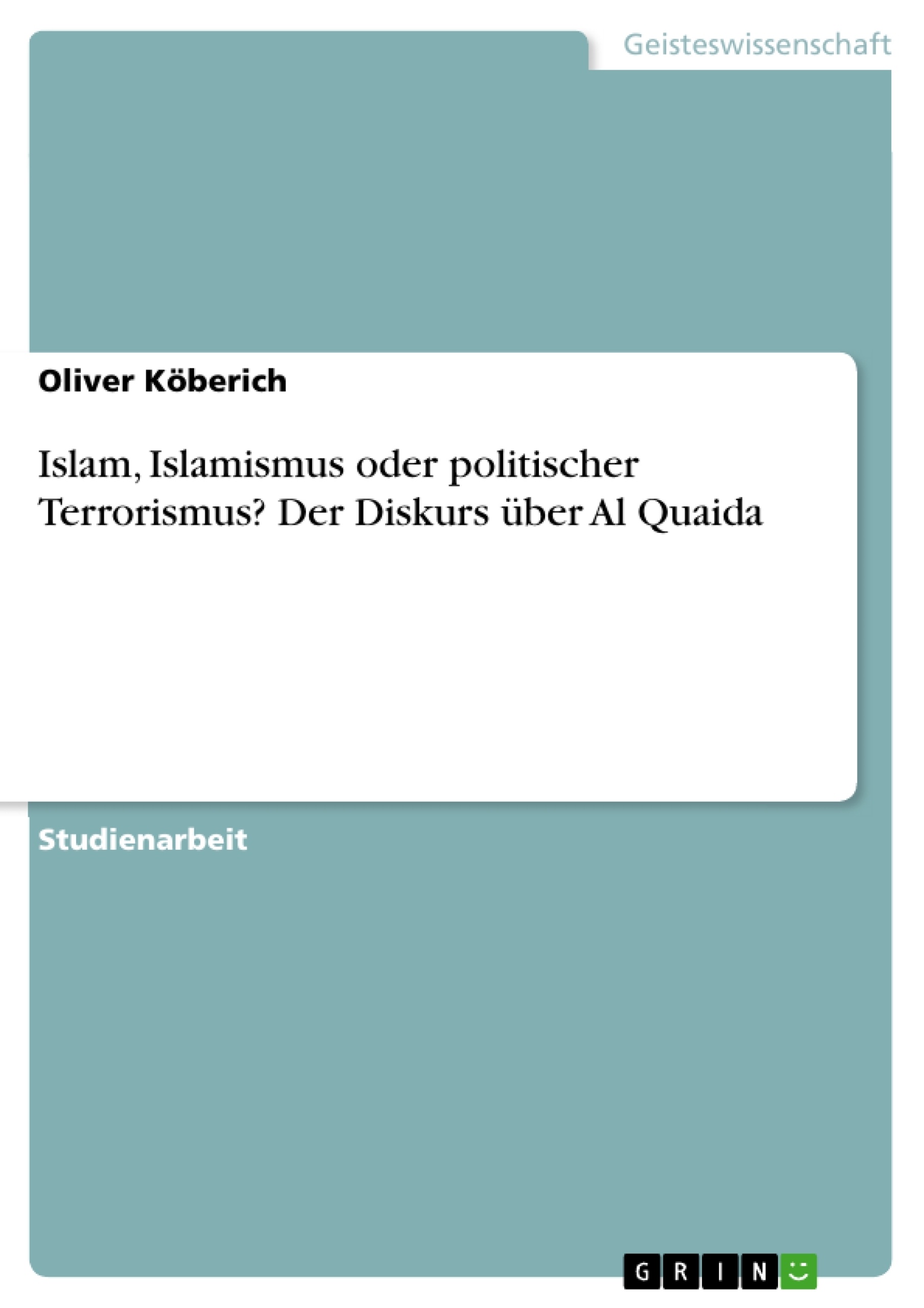Darf man eine Religion aufgrund einzelner Terrorakte unter Generalverdacht stellen? Könnte es sein, dass dies eine völlig unzutreffende, undifferenzierte Ansicht ist, welche ein pauschales Bild von den Muslimen weltweit zeichnet? Vielleicht Ist es sogar völlig unmöglich, alle Muslime buchstäblich über einen Kamm zu scheren, weil der Islam viel facettenreicher und vielfältiger ist, als dass man ihn über die Taten einiger weniger definieren könnte. Oder es stellt sich die Frage, ob diejenigen Recht haben, die den Islam grundsätzlich für friedfertig halten, einzelne Terrorakte als eigentlich unislamisch kategorisieren und jede Warnung vor dem Islam als Islamophobie und latente Tendenz zur Fremdenfeindlichkeit enttarnt haben wollen.
Um diese Fragen zu beantworten, ist es notwendig, sich mit den Grundbegriffen "Islam", "Islamismus" und "politischer (islamistischer) Terrorismus" zu beschäftigen. Ebenso mit der Frage, welcher Unterschied - sofern es überhaupt einen gibt - zwischen den genannten Begriffen besteht.
Es geht zunächst darum, den Islam als religiösen Glauben zu betrachten. Auf welche Entstehungsgeschichte kann er
zurückblicken, was sind die Glaubensinhalte und wie sollen sie eingehalten werden? Anschließend wird der Begriff des Islamismus auf seine Inhalte hin beleuchtet. Was will der Islamismus, wodurch zeichnet er sich aus, und wie kann er vom
Islam abgegrenzt werden, wenn er sich doch schon vom reinen Wortstamm her so augenfällig auf genau diesen zu beziehen scheint.
Abschließend soll es um die Beschäftigung mit dem politisch geprägten Terrorismus gehen. In dieser Abhandlung geht es ausschließlich um den islamisch geprägten politischen Terrorismus und nicht um eine Beschäftigung mit dem politischen Terrorismus an sich, wie er sich etwa in der Bundesrepublik Deutschland in den siebziger Jahren in Gestalt der RAF manifestiert hat. Zu guter Letzt soll eine Bilanz gezogen werden, um zu sehen ob sich aus der Beschäftigung mit den genannten Themengebieten eine deutliche
Differenzierung voneinander ergibt, oder ob es letztlich doch nur unterschiedliche Begriffe für ein und dieselben Inhalte sind, die sich voneinander so marginal unterscheiden, wie die verschiedenen Dialekte einer Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Islam - eine Weltreligion
- Entstehung und Verbreitung
- Inhalte der Offenbarung
- Die Scharia - Islamisches Recht
- Der Jihad die Pflicht zum „,Heiligen Krieg\"?
- Der Islamismus - eine extreme politische Ideologie
- Begriff und Entstehung
- Die Protagonisten
- Der politische Terrorismus - Hintergründe der Gewalt
- Eine neue Form
- Bilanz und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Islam, den Islamismus und den politischen Terrorismus mit dem Fokus auf Al Qaida. Sie zielt darauf ab, die Unterschiede zwischen den genannten Begriffen zu untersuchen und die Entwicklung des Islamismus als einer extremen politischen Ideologie zu verstehen.
- Entstehung und Verbreitung des Islam
- Inhalte des islamischen Glaubens und der Scharia
- Der Islamismus als politische Ideologie
- Der politische Terrorismus als Ausdruck von Gewalt
- Differenzierung zwischen Islam, Islamismus und politischem Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die Grundlage der Arbeit und stellt die wichtigsten Begriffe vor, die im Kontext der Diskussion über den Islam, den Islamismus und den Terrorismus von Bedeutung sind. Das zweite Kapitel beleuchtet den Islam als Weltreligion und betrachtet seine Entstehung, Verbreitung und die Inhalte der Offenbarung. Es befasst sich auch mit der Rolle der Scharia und der Frage des heiligen Krieges. Das dritte Kapitel widmet sich dem Islamismus als einer extremen politischen Ideologie und beleuchtet seine Entstehung und die wichtigsten Protagonisten. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Hintergründen des politischen Terrorismus. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich dieser Terrorismus von anderen Formen der Gewalt unterscheidet.
Schlüsselwörter
Islam, Islamismus, politischer Terrorismus, Al Qaida, Weltreligion, Offenbarung, Scharia, Jihad, politische Ideologie, Gewalt, Extremismus, Differenzierung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus?
Der Islam ist eine Weltreligion mit spirituellen Inhalten; der Islamismus hingegen ist eine extreme politische Ideologie, die den Islam für politische Zwecke instrumentalisiert.
Was versteht man unter politischem Terrorismus im islamischen Kontext?
Es handelt sich um Gewaltakte, die religiös begründet werden, aber primär politische Ziele verfolgen, wie es bei Organisationen wie Al Quaida der Fall ist.
Was bedeutet „Jihad“ wirklich?
Die Arbeit untersucht, ob der Jihad tatsächlich als Pflicht zum „Heiligen Krieg“ zu verstehen ist oder ob es facettenreichere religiöse Deutungen gibt.
Was ist die Scharia?
Die Scharia ist das islamische Recht, das auf den Inhalten der Offenbarung basiert und verschiedene Lebensbereiche regelt.
Darf man Muslime aufgrund von Terrorakten unter Generalverdacht stellen?
Die Arbeit plädiert für eine deutliche Differenzierung und warnt vor undifferenzierten Ansichten, die den Islam allein über die Taten weniger Extremisten definieren.
- Quote paper
- Oliver Köberich (Author), 2012, Islam, Islamismus oder politischer Terrorismus? Der Diskurs über Al Quaida, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314192