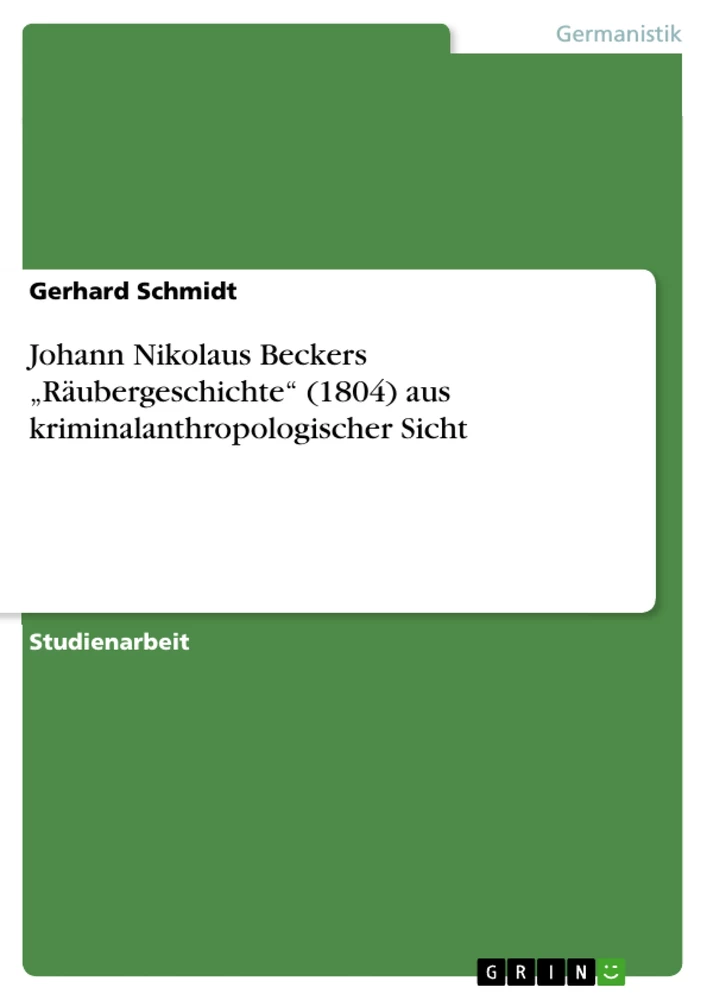Um 1800 gewann die Untersuchung von Kriminalfällen unter dem Aspekt ihrer menschlichen Hintergründe (Kriminalanthropologie) das Interesse zahlreicher deutscher Schriftsteller. Die bekanntesten Werke dieser Richtung sind Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre" oder Kleists "Michael Kohlhaas".
In der vorliegenden Arbeit wird die "Actenmässige Geschichte der rheinischen Räuberbanden" (1804) von Johann Nikolaus Becker (1773 - 1809) unter diesem Aspekt untersucht und am Beispiel der darin enthaltenen Geschichte des bekannten Räubers "Schinderhannes" dargelegt, wie der Autor die menschlichen Hintergründe beleuchtet und welche aufklärerische Absicht er damit verfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Begriffsklärungen.
- Kriminalanthropologie.
- Fallgeschichte.
- Biographische Notizen zu Autor und Protagonist.
- Johann Nikolaus Becker (1773 – 1809).
- Johannes Bückler, gen. Schinderhannes (1779 – 1803).
- Johannes Bückler.
- Schinderhannes.
- Der Mensch hinter der Figur: Methoden einer Demaskierung.
- Bücklers,,eigene Worte\" als Darstellungs- und Beglaubigungsinstrument.
- Schilderung und Analyse einer Straftat.
- Klassenzugehörigkeit und Individualität.
- Verschmelzen von Person und Rolle.
- Analyse eines Entscheidungsmoments.
- Vergleiche als Mittel der Charakterisierung.
- Schlussbemerkung: Eine Kriminalchronik als Aufklärungsinstrument….
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Johann Nikolaus Beckers „Actenmässige Geschichte der verschiedenen Räuberbanden an den beyden Ufern des Rheins“ (1804) und speziell die darin enthaltene Lebens- und Verbrechensgeschichte des Johannes Bückler, gen. Schinderhannes. Dabei steht im Vordergrund Beckers Bestreben, Erkenntnisse über den Menschen Bückler hinter der Figur Schinderhannes zu gewinnen und zu vermitteln. Die Arbeit analysiert Beckers Werk aus kriminalanthropologischer Sicht und beleuchtet die Methoden, die Becker einsetzt, um den „Menschen hinter den Taten“ zu enthüllen.
- Die Rolle der „Fallgeschichte“ als Genre der Kriminalanthropologie
- Die Verwendung von Bücklers „eigenen Worten“ als Darstellungs- und Beglaubigungsinstrument
- Die Analyse von Straftaten im Kontext von Klassenzugehörigkeit und Individualität
- Die Verschmelzung von Person und Rolle im Fall des Schinderhannes
- Die Interpretation von Entscheidungsmomenten im Leben des Johannes Bückler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Fragestellung. Sie stellt den Bezug zum Studienbrief „Kriminalanthropologie: Repräsentation von Kriminalität und Strafverfolgung in der Literatur“ her und erläutert die methodische Vorgehensweise. Im Anschluss werden die Begriffe „Kriminalanthropologie“ und „Fallgeschichte“ definiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den biographischen Notizen des Autors Johann Nikolaus Becker sowie seines Protagonisten Johannes Bückler, gen. Schinderhannes. Es werden sowohl Fakten über Beckers Leben und Werk als auch über Bücklers Lebensgeschichte und die Entstehung des Banditenmythos um die Figur des Schinderhannes zusammengefasst.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse von Beckers Methodik. Es werden verschiedene Teilaspekte seines Werkes untersucht, wie beispielsweise Bücklers „eigene Worte“ als Darstellungs- und Beglaubigungsinstrument, die Schilderung und Analyse einer Straftat, die Bedeutung von Klassenzugehörigkeit und Individualität, das Verschmelzen von Person und Rolle sowie die Analyse eines Entscheidungsmoments.
Schlüsselwörter
Kriminalanthropologie, Fallgeschichte, Johannes Bückler, Schinderhannes, Johann Nikolaus Becker, Aufklärungsliteratur, Verbrechensgeschichte, Lebensgeschichte, Methoden der Demaskierung, „eigene Worte", Klassenzugehörigkeit, Individualität, Person und Rolle, Entscheidungsmoment.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kriminalanthropologie?
Kriminalanthropologie ist die Untersuchung von Kriminalfällen unter dem Aspekt ihrer menschlichen Hintergründe, Motive und der Persönlichkeit des Täters.
Wer war „Schinderhannes“?
Johannes Bückler, bekannt als Schinderhannes, war ein berühmter Räuber um 1800, dessen Lebensgeschichte von Johann Nikolaus Becker dokumentiert wurde.
Welches Ziel verfolgte Johann Nikolaus Becker mit seinem Werk?
Becker wollte den „Menschen hinter der Figur“ demaskieren und nutzte die Kriminalchronik als ein Instrument der Aufklärung.
Welche Methoden nutzt Becker zur Charakterisierung des Täters?
Er verwendet Bücklers „eigene Worte“, analysiert Entscheidungsmomente im Leben des Räubers und setzt Vergleiche sowie die Untersuchung der Klassenzugehörigkeit ein.
Wie unterscheidet sich die „Fallgeschichte“ von einer reinen Chronik?
Eine Fallgeschichte im Sinne der Kriminalanthropologie versucht, die psychologischen und sozialen Ursachen für das Abgleiten in die Kriminalität zu ergründen.
Welche Rolle spielt die „Verschmelzung von Person und Rolle“?
Die Arbeit analysiert, wie Johannes Bückler in die ihm zugeschriebene Rolle des Banditenmythos hineinwuchs und wie Becker versuchte, diese Schichten wieder zu trennen.
- Quote paper
- Gerhard Schmidt (Author), 2015, Johann Nikolaus Beckers „Räubergeschichte“ (1804) aus kriminalanthropologischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314355