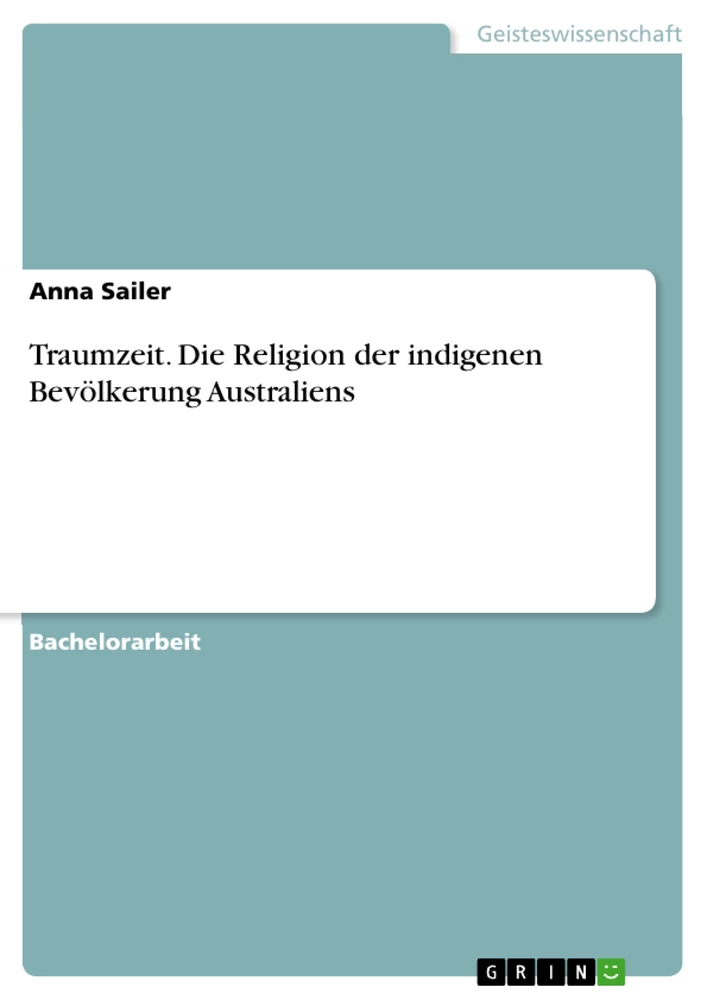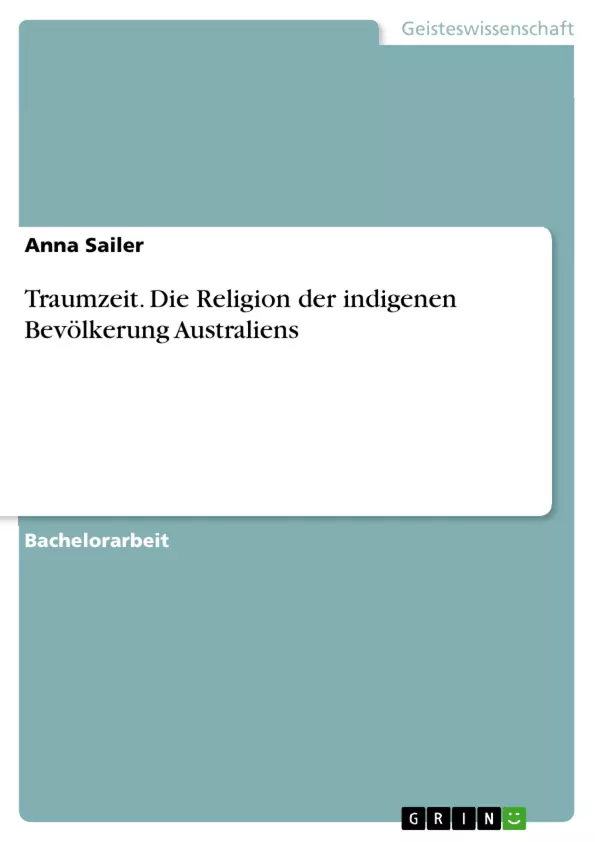In dieser Bachelorarbeit geht es um die Traumzeit der indigenen Bevölkerung Australiens. Die Arbeit beinhaltet einen groben geschichtlichen Überblick über die Entdeckung des Kontinents, die Traumzeit (was ist das, Charakteristika, Traumzeitwesen, etc.), sowie die Forschungsgeschichte über Religion. Anschließend habe ich Werke aus zwei verschiedenen Zeiträumen (1940/1950 und 1980/1990) analysiert, verglichen und versucht, Veränderungen herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1. Zugang
- 1.2. Forschungsstand und Methode
- 1.3. Forschungsfrage
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 1.5. Allgemeine Informationen
- 2. Geschichtlicher Überblick über die Entdeckung Australiens
- 2.1. Geschichte der Aborigines
- 2.2. Entdeckung Australiens
- 2.3. Erste Aufeinandertreffen von Aborigines und EuropäerInnen
- 3. Traumzeit
- 3.1. Allgemeine Charakteristika der Traumzeit
- 3.2. Was geschah während der Traumzeit?
- 3.3. Traumzeitwesen
- 3.4. Überlieferung der Traumzeit
- 3.5. Schöpfungsmythe aus Rainbow Beach
- 4. Forschungsgeschichte Religion: Anfänge - 1940
- 5. Zeitraum 1: 1940er und 1950er Jahre
- 5.1. Auswahl der Texte
- 5.2. Biographie der AutorInnen
- 5.3. Analyse
- 5.3.1. Zugang und Themenauswahl
- 5.3.2. Darstellung der Traumzeit
- 5.3.3. Erkennbare politische Einflüsse
- 6. Zeitraum 2: 1980er und 1990er Jahre
- 6.1. Auswahl der Texte
- 6.2. Biographie der AutorInnen
- 6.3. Analyse
- 6.3.1. Zugang und Themenauswahl
- 6.3.2. Darstellung der Traumzeit
- 6.3.3. Erkennbare politische Einflüsse
- 7. Veränderungen Zeitraum 1 - Zeitraum 2
- 7.1. AutorInnen
- 7.2. Darstellungen der Traumzeit
- 7.3. Erkennbare politische Einflüsse
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Religion der indigenen Bevölkerung Australiens, der Traumzeit. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Forschungsliteratur zur Traumzeit im Zeitraum von den 1940er Jahren bis in die 1990er Jahre zu analysieren. Die Arbeit untersucht dabei, wie sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Traumzeit in den unterschiedlichen Zeiträumen entwickelt hat und welche politischen Einflüsse auf die Forschung erkennbar sind.
- Entwicklung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Traumzeit
- Politische Einflüsse auf die Forschung
- Darstellung der Traumzeit in verschiedenen Forschungsphasen
- Veränderungen im Zugang und in der Themenauswahl der Forschung
- Vergleich der verschiedenen Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den persönlichen Zugang der Autorin zur Traumzeit. Sie erläutert den Forschungsstand und die Methode, die in der Arbeit angewendet wird. Die Einleitung beinhaltet auch die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel gibt einen geschichtlichen Überblick über die Entdeckung Australiens und die ersten Begegnungen zwischen den Aborigines und den Europäern. Es beleuchtet auch die Geschichte der Aborigines und die Auswirkungen der Kolonialisierung auf ihre Kultur.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Traumzeit, die als Religion der indigenen Bevölkerung Australiens angesehen wird. Es werden die allgemeinen Charakteristika der Traumzeit sowie die Schöpfungsgeschichte aus Rainbow Beach beschrieben.
Das vierte Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Forschungsgeschichte der Religion in Australien bis zum Jahr 1940.
Kapitel fünf untersucht die Forschung der Traumzeit in den 1940er und 1950er Jahren. Es werden Texte aus dieser Zeit analysiert, die Biografien der AutorInnen dargestellt und die jeweiligen Zugänge und Themenauswahlen der Forschung beschrieben. Der Einfluss der Politik auf die Forschung wird ebenfalls betrachtet.
Kapitel sechs widmet sich der Forschung der Traumzeit in den 1980er und 1990er Jahren. Die Analyse der Texte aus dieser Zeit, die Biografien der AutorInnen und die politischen Einflüsse auf die Forschung werden ebenfalls beleuchtet.
Das siebte Kapitel vergleicht die Forschung der Traumzeit in den verschiedenen Zeiträumen. Es wird auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Darstellungen der Traumzeit, den AutorInnen und den politischen Einflüssen eingegangen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit der Traumzeit, der Religion der indigenen Bevölkerung Australiens. Sie untersucht die Forschungsgeschichte, die Entwicklung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Traumzeit, die Darstellung der Traumzeit in verschiedenen Forschungsphasen, die politischen Einflüsse auf die Forschung und die Biografien der AutorInnen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der 'Traumzeit' (Dreamtime)?
Die Traumzeit bezeichnet das religiöse und mythologische Weltbild der Aborigines, das die Schöpfung der Welt durch Ahnenwesen und die daraus resultierenden Gesetze beschreibt.
Wie hat sich die Forschung über die Aborigines-Religion verändert?
Die Arbeit vergleicht Texte aus den 1940er/50er Jahren mit denen der 1980er/90er Jahre und zeigt einen Wandel von kolonial geprägten zu respektvolleren, politisch bewussteren Darstellungen.
Was sind 'Traumzeitwesen'?
Dies sind Schöpferwesen (wie die Regenbogenschlange), die während der Traumzeit das Land gestalteten und in Felsen, Wasserlöchern oder Sternen weiterleben.
Wie wird die Traumzeit überliefert?
Die Überlieferung erfolgt mündlich durch Mythen, rituellen Gesang, Tänze und Felsmalereien, die das Wissen über Generationen hinweg bewahren.
Welchen Einfluss hatte die Entdeckung Australiens auf die Aborigines?
Die Arbeit beleuchtet die oft gewaltvollen ersten Begegnungen mit Europäern und die massiven Auswirkungen der Kolonialisierung auf die indigene Kultur und Religion.
- Quote paper
- Anna Sailer (Author), 2013, Traumzeit. Die Religion der indigenen Bevölkerung Australiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314364