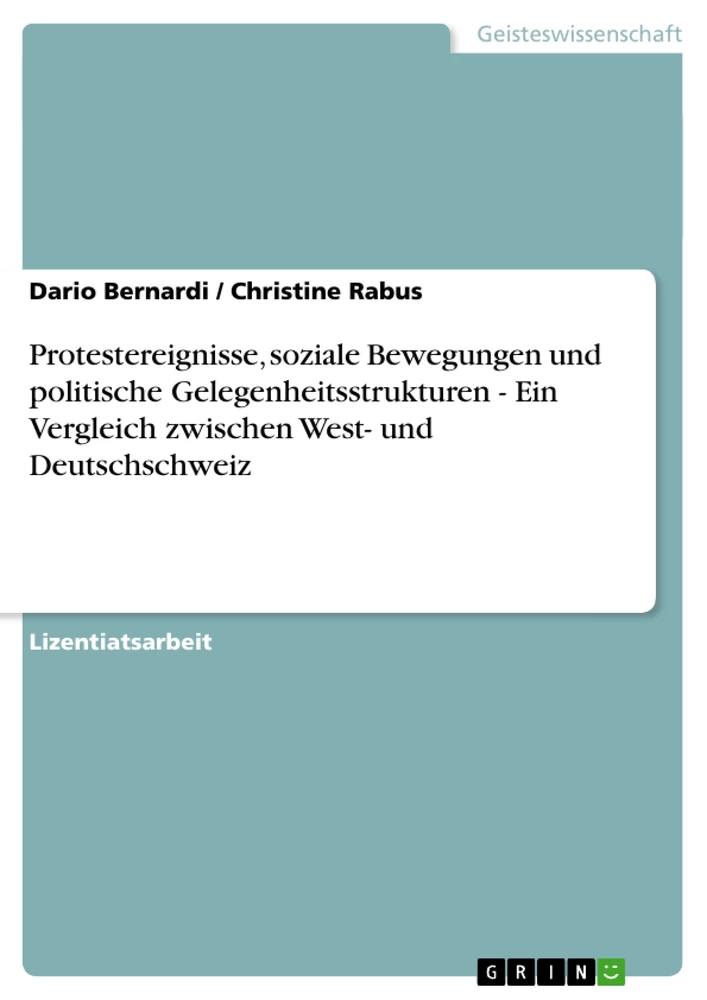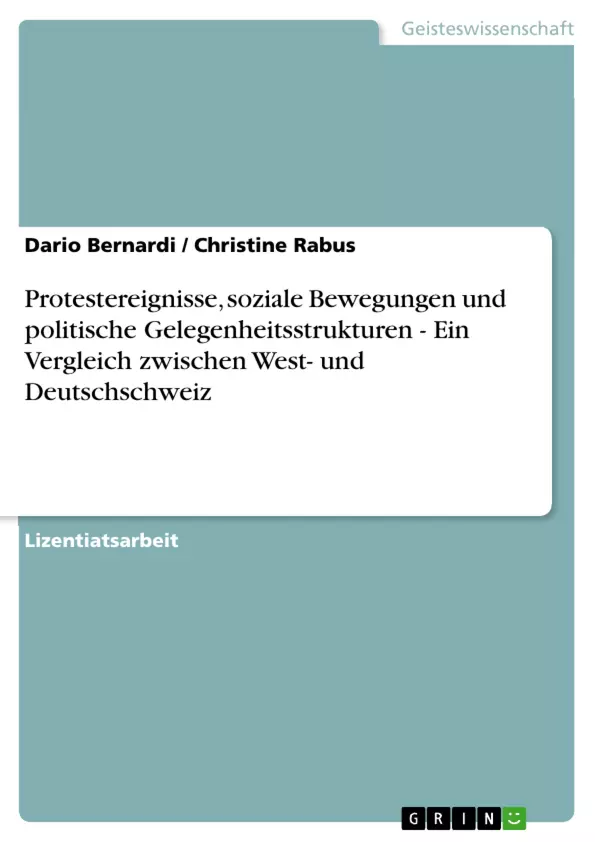[...] Es
werden darin konkrete Aussagen zu Themen, Formen und Inhalten der Proteste in den
einzelnen Ländern gemacht. Eine detailliertere Betrachtung dieser gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen und Beweggründe innerhalb der Schweiz auf regionaler und
kantonaler Ebene wird gänzlich weggelassen. Diesem Manko soll die vorliegende
Arbeit Abhilfe schaffen, indem sie die deutsche und französische Schweiz eingehend
untersucht und Vergleiche zwischen den Kantonen anstellt. Ferner wird die vorliegende
Lizentiatsarbeit den Leser zusätzlich in ein in der Schweiz unerforschtes Gebiet
einführen – die Erklärung möglicher Unterschiede sozialer Bewegungen zwischen
West- und Deutschschweiz anhand der Theorie der politischen Gelegenheitsstrukturen.
Ein weiterer Unterschied zwischen dieser und anderen Arbeiten besteht darin, dass wir
uns mit sämtlichen Protestereignissen in der Schweiz seit 1945 befassen, während andere Untersuchungen sich meistens auf einen bestimmten Zeitraum, ein bestimmtes
Thema, eine bestimmte Aktionsform oder bestimmte Konsequenzen beschränkten.
Protestereignisse werden hier also in ihren sämtlichen Facetten betrachtet, um
systematische Unterschiede zwischen der Deutsch- und Westschweiz feststellen zu
können.
Im folgenden werden kurz einige wichtige Definitionen vorgestellt, worauf im nächsten
Kapitel das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit dargelegt wird. Nach einem
Überblick über den Stand der Forschung sowie theoretische Modelle zu sozialen
Bewegungen und Protestaktionen bilden die zentralen Fragestellungen den Abschluss
des theoretischen Teils. Im zweiten Teil der Arbeit werden Datengrundlage und
methodisches Vorgehen besprochen sowie die Resultate der empirischen Analyse der
Protestereignisse vorgestellt. In einem weiteren, empirisch abschliessendem Teil sollen
mögliche Erklärungsansätze der zwischen der Deutsch- und Westschweiz existierenden
Unterschiede bezüglich Protestaktivitäten anhand der Theorie der politischen
Gelegenheitsstrukturen besprochen. Dazu werden die einzelnen Komponenten der
Gelegenheitsstrukturen einer empirischen Analyse unterzogen sowie Unterschiede
zwischen der Deutsch- und Westschweiz aufgezeigt. Dies erlaubt eine erste grobe
Einschätzung, ob sich die Theorie der politischen Gelegenheitsstrukturen zur Erklärung
des unterschiedlichen Protestverhaltens der Deutsch- und Westschweizer eignet. Den
Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der Resultate sowie Überlegungen
zu weiterführenden Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Soziale Bewegungen
- 2.2. Kurzer deskriptiver Exkurs des Begriffs „soziale Bewegung“
- 2.3. Neue soziale Bewegungen
- 2.4. Mobilisierung
- 2.5. Protestereignisse/Protestaktionen
- 2.6. Protestthemen
- 2.7. Aktionsformen
- 2.8. Identität und Kultur
- 3. Erkenntnisinteresse
- 4. Stand der Forschung zu Protestereignissen und Sozialen Bewegungen
- 4.1. Allgemeiner Überblick
- 4.2. Analyse von Protestereignissen im Überblick
- 4.3. Analyse von Protestereignissen in der Schweiz
- 5. Theorien der Bewegungsforschung
- 5.1 Historischer Überblick zur Entstehung und Entwicklung der Bewegungsforschung
- 5.2. Political Opportunity Structure (POS)
- 5.2.1. Politische Gelegenheitsstrukturen und soziale Bewegungen in der Schweiz
- 6. Untersuchte Komponenten der politischen Gelegenheitsstrukturen
- 6.1. Formelle institutionelle Strukturen
- 6.1.1. Zentralismus
- 6.1.2. Institutionalisierung direkt-demokratischer Verfahren
- 6.2. Informelle Strategien der Behörden
- 6.3. Machtkonstellation im Parteiensystem
- 6.1. Formelle institutionelle Strukturen
- 7. Forschungsfragen
- 7.1. Unterschiede von Protestereignissen in den Kantonen
- 7.2. Kantonale Unterschiede bezüglich politischer Gelegenheitsstrukturen
- 8. Methodik
- 8.1. Methodik des ersten Datensatzes 1945-1978
- 8.2. Verzerrungen des Datenmaterials des ersten Datensatzes 1945-1978
- 8.3. Methodik des zweiten Datensatzes 1975-1989
- 9. Befunde zu Protestereignissen und sozialen Bewegungen
- 10. Überblick und Zusammenfassung der Befunde zu Protestereignissen und sozialen Bewegungen
- 11. Befunde zu den politischen Opportunitätsstrukturen
- 11.1. Allgemeiner Überblick
- 11.1.1. Allgemeine Strukturdaten zu den Kantonen
- 11.1.2. Fünf Typologien kantonaler Demokratien
- 11.1.3. Demokratiekarte der Schweiz
- 11.2. Formelle Institutionelle Strukturen
- 11.2.1. Zentralismus
- 11.2.2. Institutionalisierung direkt-demokratischer Verfahren
- 11.3. Exkurs: Demokratieindex der Schweizer Kantone
- 11.3.1. Konstruktion der Demokratieindices
- 11.3.2. Befunde zu den Demokratieindices
- 11.4. Informelle Strategien der Behörden
- 11.5. Machkonstellationen in den Kantonen
- 11.1. Allgemeiner Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Protestereignisse und soziale Bewegungen in der Schweiz, insbesondere den Vergleich zwischen der Deutsch- und der Westschweiz. Ziel ist es, die Unterschiede in der Häufigkeit, den Formen und den Themen von Protesten zu analysieren und diese mit den jeweiligen politischen Gelegenheitsstrukturen in Verbindung zu bringen.
- Vergleichende Analyse von Protesten in der Deutsch- und Westschweiz
- Zusammenhang zwischen Protestformen und politischen Gelegenheitsstrukturen
- Untersuchung der Rolle von formalen und informellen Institutionen
- Analyse verschiedener Protestthemen (z.B. Arbeiter-, Frauen-, Umweltproteste)
- Entwicklung eines Protestindex zur Quantifizierung von Protestintensität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Forschungsansatz, der darauf abzielt, Protestereignisse und soziale Bewegungen in der Schweiz vergleichend zu untersuchen und diese mit den politischen Gelegenheitsstrukturen in Verbindung zu bringen. Es werden die Forschungsfragen formuliert und die Struktur der Arbeit skizziert.
2. Definitionen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen von zentralen Begriffen wie „soziale Bewegung“, „neue soziale Bewegung“, „Mobilisierung“, „Protestereignisse“, „Protestthemen“ und „Aktionsformen“. Es bietet einen theoretischen Rahmen für die anschließende empirische Analyse, indem es die verschiedenen Facetten des Protestes beleuchtet und konzeptuell voneinander abgrenzt. Der Fokus liegt auf der Klärung terminologischer Unschärfen und der Schaffung einer einheitlichen Grundlage für die folgenden Kapitel.
3. Erkenntnisinteresse: Dieses Kapitel spezifiziert das Erkenntnisinteresse der Arbeit. Es benennt die Forschungslücke, die die vorliegende Arbeit zu schließen versucht, und erläutert die Bedeutung der Untersuchung von Protesten und sozialen Bewegungen im Kontext der schweizerischen politischen Landschaft. Es argumentiert für die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf die regionale Variation von Protestformen und -intensität.
4. Stand der Forschung zu Protestereignissen und Sozialen Bewegungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Protesten und sozialen Bewegungen. Es analysiert bestehende Studien und Theorien und identifiziert Forschungslücken, die die vorliegende Arbeit adressiert. Der Fokus liegt auf der Einordnung der eigenen Arbeit in den bestehenden Diskurs, sowie der Herleitung der theoretischen Grundlagen der Untersuchung.
5. Theorien der Bewegungsforschung: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die Theorie der „Political Opportunity Structures“ (POS). Es wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der Bewegungsforschung gegeben, um die Bedeutung und Relevanz des POS-Ansatzes zu verdeutlichen. Die Anwendung des POS-Ansatzes auf den schweizerischen Kontext wird detailliert erläutert und bildet die methodologische Basis für die folgenden Analysen.
6. Untersuchte Komponenten der politischen Gelegenheitsstrukturen: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Komponenten der politischen Gelegenheitsstrukturen, die in der Arbeit untersucht werden. Es unterteilt die Strukturen in formelle institutionelle Strukturen (Zentralismus, direkt-demokratische Verfahren) und informelle Strategien der Behörden und analysiert die Machtkonstellation im Parteiensystem. Die Definition und Operationalisierung dieser Variablen bildet die Grundlage für die empirische Analyse im späteren Verlauf.
7. Forschungsfragen: Dieses Kapitel präzisiert die Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die Unterschiede in Protestereignissen und politischen Gelegenheitsstrukturen zwischen der Deutsch- und der Westschweiz konzentrieren. Es beschreibt die spezifischen Aspekte, die im Laufe der Arbeit untersucht und beantwortet werden sollen, und bildet so den roten Faden für die empirische Analyse.
8. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Arbeit. Es erläutert die verwendeten Datensätze, die angewandten Methoden der Datenanalyse und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Beschreibung der Methodik stellt die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicher und erlaubt eine kritische Bewertung der angewandten Verfahren.
Schlüsselwörter
Protestereignisse, soziale Bewegungen, politische Gelegenheitsstrukturen, Schweiz, Deutschschweiz, Westschweiz, Vergleichende Analyse, Protestformen, Protestthemen, Direkte Demokratie, Zentralismus, Methoden der Bewegungsforschung, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Protestereignissen und sozialen Bewegungen in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Protestereignisse und soziale Bewegungen in der Schweiz, insbesondere im Vergleich zwischen der Deutsch- und der Westschweiz. Der Fokus liegt auf der Analyse der Unterschiede in Häufigkeit, Formen und Themen von Protesten und deren Zusammenhang mit den jeweiligen politischen Gelegenheitsstrukturen.
Welche Definitionen werden im Dokument verwendet?
Das Dokument definiert zentrale Begriffe wie "soziale Bewegung", "neue soziale Bewegung", "Mobilisierung", "Protestereignisse", "Protestthemen" und "Aktionsformen". Es klärt terminologische Unschärfen und schafft eine einheitliche Grundlage für die Analyse.
Was ist das Erkenntnisinteresse der Arbeit?
Das Erkenntnisinteresse liegt in der Schließung einer Forschungslücke bezüglich der regionalen Variation von Protestformen und -intensität in der Schweiz. Es wird die Bedeutung der Untersuchung von Protesten und sozialen Bewegungen im schweizerischen Kontext hervorgehoben.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Theorie der "Political Opportunity Structures" (POS). Es wird ein historischer Überblick über die Bewegungsforschung gegeben, um den POS-Ansatz im schweizerischen Kontext zu erläutern und anzuwenden.
Welche Komponenten der politischen Gelegenheitsstrukturen werden untersucht?
Untersucht werden formelle institutionelle Strukturen (Zentralismus, direkt-demokratische Verfahren), informelle Strategien der Behörden und die Machtkonstellation im Parteiensystem. Diese Variablen werden definiert und operationalisiert.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Forschungsfragen konzentrieren sich auf die Unterschiede in Protestereignissen und politischen Gelegenheitsstrukturen zwischen der Deutsch- und der Westschweiz. Es werden spezifische Aspekte untersucht, die den Vergleich der Regionen ermöglichen.
Welche Methodik wird angewendet?
Das Dokument beschreibt detailliert die Methodik, einschließlich der verwendeten Datensätze (zwei Datensätze, 1945-1978 und 1975-1989), der Datenanalysemethoden und der damit verbundenen Herausforderungen. Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse werden sichergestellt.
Welche Befunde werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Befunde zu Protestereignissen und sozialen Bewegungen, sowie zu den politischen Opportunitätsstrukturen. Diese umfassen allgemeine Strukturdaten zu den Kantonen, Typologien kantonaler Demokratien, einen Demokratieindex der Schweizer Kantone und Analysen zu formalen und informellen Strukturen.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zur Einleitung, Definitionen, Erkenntnisinteresse, Stand der Forschung, Theorien der Bewegungsforschung, untersuchten Komponenten der politischen Gelegenheitsstrukturen, Forschungsfragen, Methodik, Befunden zu Protestereignissen und sozialen Bewegungen, sowie einer Zusammenfassung der Befunde. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Protestereignisse, soziale Bewegungen, politische Gelegenheitsstrukturen, Schweiz, Deutschschweiz, Westschweiz, Vergleichende Analyse, Protestformen, Protestthemen, Direkte Demokratie, Zentralismus, Methoden der Bewegungsforschung, Empirische Forschung.
- Quote paper
- Dario Bernardi (Author), Christine Rabus (Author), 2004, Protestereignisse, soziale Bewegungen und politische Gelegenheitsstrukturen - Ein Vergleich zwischen West- und Deutschschweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31443