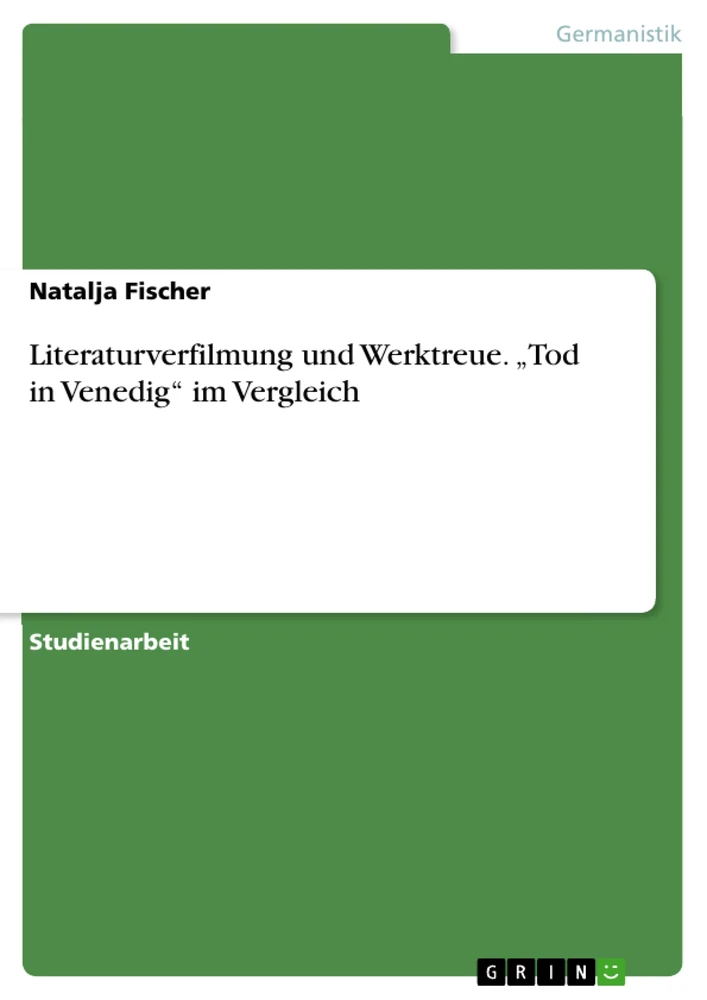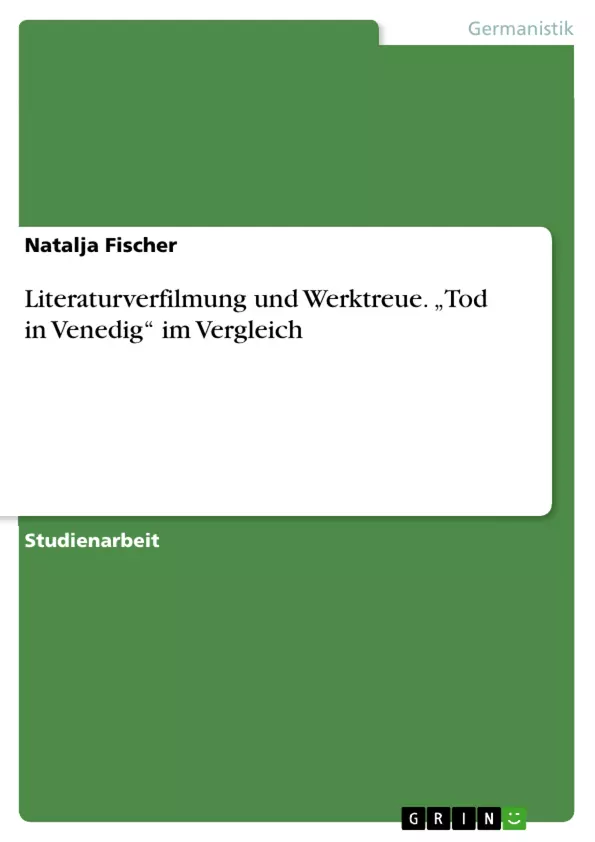Literaturverfilmungen haben keinen leichten Stand. Das gnadenlose Publikum schreckt oft nicht vor dem direkten Vergleich mit der literarischen Vorlage zurück und so lautet das vernichtende Urteil nach dem Kinobesuch nicht selten, der Film sei ja gar nicht so wie das Buch und überhaupt, das Buch sei ja viel besser.. Auch im akademischen Kontext wurden Literaturverfilmungen aufgrund unzureichender Werktreue jahrelang verunglimpft und die Kritik sogar auf den Film als Medium insgesamt ausgeweitet: „The cinema inevitably lacks the depth and dignity of literature“. Der Ruf nach Werktreue und die geradezu „konfessorische Ablehung“ gegenüber Literaturverfilmungen war lange Zeit vorherrschend und ist trotz großer Fortschritte im akademischen Bereich noch immer nicht vollkommen überwunden.
Die vorliegende Arbeit möchte daher ihren Beitrag dazu leisten, mehr Verständnis für die Eigenständigkeit von Literaturverfilmungen zu schaffen. Folgende These gilt es dabei zu stützen: Um ein literarisches Werk adäquat ins Medium Film zu übersetzen muss die Forderung sklavischer Werktreue gegen den Anspruch interpretativer Transformation ersetzt werden.
Hierzu soll zunächst der Prozess des Medienwechsels nachvollzogen werden, der die Unmöglichkeit absoluter Werktreue beweißt und die Forderung somit hinfällig macht. Nach welchen Maßstäben man stattdessen eine gelungene Literaturverfilmung schaffen kann, soll daraufhin unter Bezug auf die Theorie von Bazin gezeigt werden, der für eine indirekte Werktreue plädiert. Anschließend soll die Analyse eines konkreten Beispiels Bazins Theorie stützen. Hierfür wurde Luchino Viscontis Film "Morte a Venezia" gewählt, die „von der überwiegenden Mehrheit der Kritiker als gelungene Literaturadaption anerkannt [wurde].“ Es soll herausgearbeitet werden, an welchen Stellen und zu welchem Zweck Visconti von der literarischen Vorlage abweicht und wie er Thomas Manns Novelle dadurch im Kern näher kommt. Im Fazit sollen die Erkenntnisse dieser Arbeit abschließend zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturverfilmung und Werktreue
- Das Problem des Medienwechsels
- Indirekte Werktreue nach Bazin
- Der Tod in Venedig: Vergleich Novelle und Film
- Handlungsebene
- Deutungsebene
- Erzählperspektive
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, ein tieferes Verständnis für die Eigenständigkeit von Literaturverfilmungen zu entwickeln. Dabei wird die These vertreten, dass eine gelungene Adaption von literarischen Werken im Film nicht sklavisch der Vorlage folgen darf, sondern eine interpretative Transformation erfordert.
- Die Herausforderungen des Medienwechsels von Literatur zu Film
- Die Unmöglichkeit absoluter Werktreue und die Forderung nach interpretativer Transformation
- Die Bedeutung von indirekter Werktreue nach Bazin
- Die Analyse von Luchino Viscontis „Tod in Venedig“ als Beispiel für eine gelungene Literaturverfilmung
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Novelle und Film
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik von Literaturverfilmungen und die Debatte um die Werktreue vor. Sie argumentiert, dass eine sklavische Anpassung an die literarische Vorlage nicht möglich ist und stattdessen eine interpretative Transformation angestrebt werden sollte.
Literaturverfilmung und Werktreue
Das Problem des Medienwechsels
Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen des Medienwechsels von Literatur zum Film. Es werden die Unterschiede zwischen den beiden Medien, wie z.B. die konkrete Visualisierung im Film im Gegensatz zu den Leerstellen in der Literatur, herausgestellt. Es wird argumentiert, dass diese Unterschiede eine absolute Werktreue unmöglich machen.
Indirekte Werktreue nach Bazin
In diesem Kapitel wird die Theorie von Andre Bazin zur Werktreue in Literaturverfilmungen vorgestellt. Bazin plädiert für eine indirekte Werktreue, die den tieferen Sinn des Werkes erfasst und in den Film überträgt. Die Analyse von Bazin zeigt, dass die Konzentration auf den Sinn und die Essenz eines Werkes wichtiger ist als die detailgetreue Anpassung von Dialogen, Handlung und Beschreibungen.
Der Tod in Venedig: Vergleich Novelle und Film
Dieses Kapitel analysiert Luchino Viscontis Film „Tod in Venedig“ als Beispiel für eine gelungene Literaturverfilmung. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Novelle von Thomas Mann und der Filmadaption auf den Ebenen der Handlung, der Deutung und der Erzählperspektive untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Literaturverfilmung, Werktreue, Intermedialität, Medienwechsel, interpretative Transformation und der Analyse von Luchino Viscontis „Tod in Venedig“ als Beispiel für eine gelungene Literaturadaption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Werktreue" bei Literaturverfilmungen?
Werktreue beschreibt den Grad der Übereinstimmung zwischen der literarischen Vorlage und dem Film. Die Arbeit argumentiert jedoch für eine interpretative Transformation statt sklavischer Treue.
Warum ist absolute Werktreue unmöglich?
Der Medienwechsel bringt strukturelle Unterschiede mit sich; während Literatur mit Leerstellen arbeitet, muss der Film alles konkret visualisieren.
Was versteht André Bazin unter "indirekter Werktreue"?
Bazin plädiert dafür, den Kern und den tieferen Sinn eines Werkes zu erfassen und in die Sprache des Films zu übersetzen, anstatt nur die Handlung zu kopieren.
Wie setzt Luchino Visconti "Tod in Venedig" filmisch um?
Visconti weicht an einigen Stellen von Thomas Manns Novelle ab, um die Essenz der Geschichte und die psychologische Tiefe der Hauptfigur adäquat darzustellen.
Ist das Buch immer besser als der Film?
Dies ist ein häufiges Vorurteil. Die Arbeit zeigt, dass Literaturverfilmungen eigenständige Kunstwerke sind, die nach eigenen medialen Gesetzen funktionieren.
- Arbeit zitieren
- Natalja Fischer (Autor:in), 2013, Literaturverfilmung und Werktreue. „Tod in Venedig“ im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314503