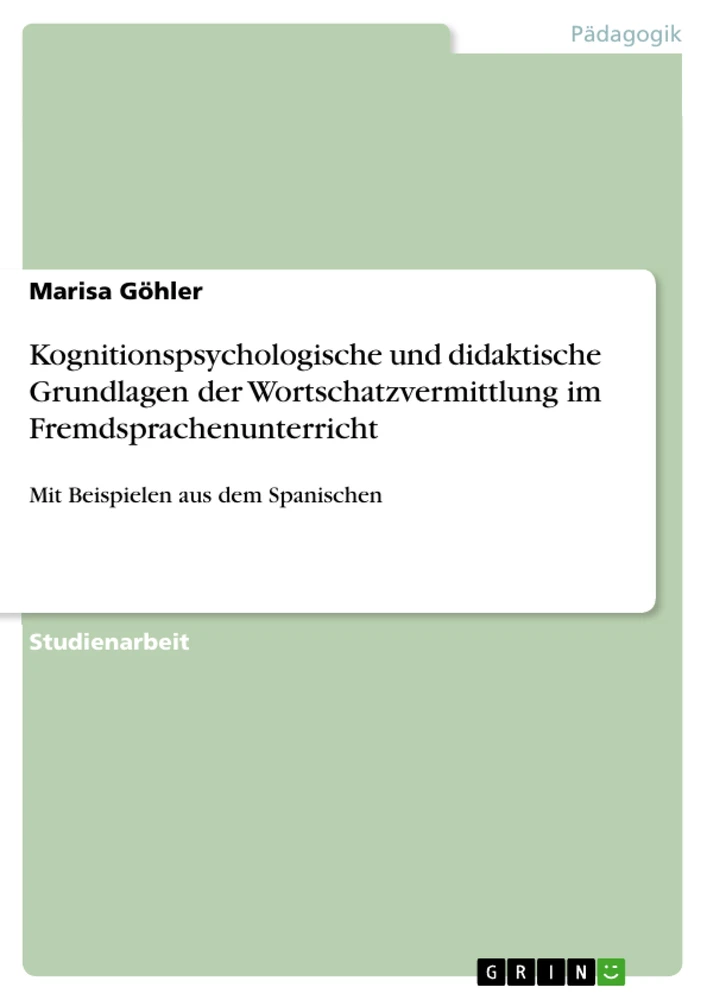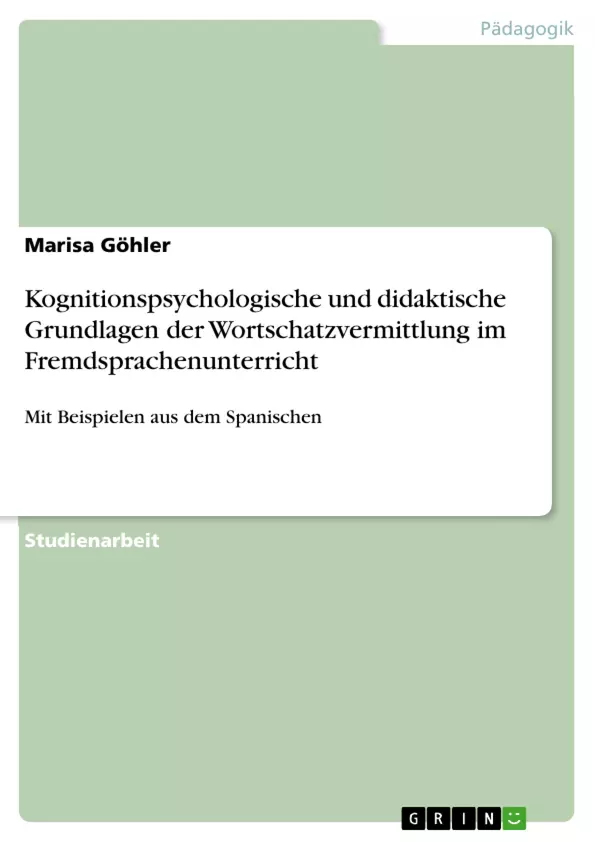Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht (FSU). Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erstvermittlung neuer Lexik. Dabei werden die verschiedenen Möglichkeiten der Bedeutungsvermittlung näher betrachtet und die einzelnen Phasen im Unterricht vorgestellt. Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten, die sich dem Lehrer dabei auftun, stellt sich die Frage, wie neue Wörter am besten eingeführt werden sollen und worauf dabei geachtet werden muss. Soll die Vermittlung einsprachig oder zweisprachig erfolgen? Welche Faktoren beeinflussen die Behaltensleistung der Lerner und wie wird der Wortschatz einer Person im Gehirn gespeichert?
Im Anschluss an eine kurze Einführung wird zunächst auf den Begriff ‚Wortschatz‘ und seine Klassifikation eingegangen. Dabei soll auch die lexikalische Einheit erklärt und mit ihren einzelnen Komponenten vorgestellt werden, da diese bei der Wortschatzvermittlung berücksichtigt werden sollten. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden außerdem die Prozesse des Lernens im Gehirn sowie das mentale Lexikon von Interesse sein. Im vierten Kapitel steht schließlich die Wortschatzvermittlung im Mittelpunkt und es werden anhand der Erkenntnisse zur Lernforschung Prinzipien für die Vermittlung neuer Lexik abgeleitet. Zudem werden verschiedene Methoden der Wortschatzarbeit vorgestellt und kritisch betrachtet. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Trotz der Erkenntnis, dass eine gut strukturierte Wortschatzarbeit das Erlernen der fremdsprachlichen Lexik erleichtert, wird das Wörterlernen i.d.R. „aus dem Unterricht ausgelagert“. So sind Lehreräußerungen wie: „Lernt die Vokabeln zu dieser Lektion bis nächste Woche auswendig!“ oder „Schaut euch jetzt die Vokabeln an. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen, gut, dann lernt sie auswendig!“ keine Seltenheit. Durch diese gängige Unterrichtspraxis werden Schüler mit dem Erlernen des fremdsprachlichen Wortschatzes weitgehend allein gelassen, was wiederum meist zum sturen ‚Pauken‘ von Vokabellisten führt und das Behalten der Wörter erschwert. Zudem umfasst der Wortschatzerwerb „weit mehr als das Wissen um die Entsprechung des einzelnen Wortes in der Muttersprache“ (Hutz, Kolb, 2010: 6).
Inhaltsverzeichnis
- Überblick
- Der Wortschatz
- Begriffsklärung und Klassifikation
- Die lexikalische Einheit
- Kognitionspsychologische Grundlagen zum Wortschatzlernen
- Wie lernen wir?
- Das mentale Lexikon
- Wortschatzvermittlung
- Phasen
- Verfahren
- Allgemeine Prinzipien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht (FSU) und analysiert, wie die systematische Einbindung von Wortschatzlernen im Unterricht die Aneignung fremdsprachlicher Lexik erleichtern kann.
- Bedeutung des Wortschatzes für erfolgreiche Kommunikation
- Kognitionspsychologische Grundlagen des Wortschatzlernens
- Verschiedene Phasen und Verfahren der Wortschatzvermittlung
- Prinzipien für die effektive Vermittlung neuer Lexik
- Analyse des mentalen Lexikons und seine Bedeutung im Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Problematik der Wortschatzvermittlung im FSU. Es werden die Herausforderungen des traditionellen Vokabellernens sowie die Bedeutung eines fundierten Wortschatzes für die erfolgreiche Kommunikation hervorgehoben.
Kapitel 2 widmet sich dem Begriff "Wortschatz" und dessen Klassifizierung. Es werden verschiedene Kategorien des Wortschatzes, wie der produktive und der rezeptive Wortschatz, erklärt. Zusätzlich wird die lexikalische Einheit mit ihren verschiedenen Komponenten erläutert, die für den erfolgreichen Wortschatzaufbau im FSU von Bedeutung sind.
Kapitel 3 befasst sich mit den kognitionspsychologischen Grundlagen des Wortschatzlernens. Es wird die Funktionsweise des Gehirns beim Wortschatzlernen betrachtet und das mentale Lexikon als Speichersystem für Vokabeln und deren Bedeutung vorgestellt.
Kapitel 4 beleuchtet die Wortschatzvermittlung im Unterricht. Es werden verschiedene Phasen und Verfahren der Wortschatzvermittlung vorgestellt und anhand der Erkenntnisse der Lernforschung Prinzipien für die effektive Vermittlung neuer Lexik abgeleitet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht. Wichtige Schlüsselwörter sind: Wortschatz, Lexik, mentale Lexikon, kognitionspsychologische Grundlagen, Vermittlung, Phasen, Verfahren, Prinzipien, Kommunikation, Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Wortschatz im menschlichen Gehirn gespeichert?
Der Wortschatz ist im sogenannten „mentalen Lexikon“ organisiert. Wörter sind dort nicht isoliert, sondern über verschiedene Netzwerke (semantisch, phonetisch) miteinander verknüpft.
Warum ist stures Vokabelpauken oft ineffektiv?
Wortschatzerwerb umfasst mehr als nur die Übersetzung. Ohne Kontextualisierung und Vernetzung im Gehirn fällt es schwer, die Lexik langfristig zu behalten und produktiv anzuwenden.
Was ist der Unterschied zwischen produktivem und rezeptivem Wortschatz?
Rezeptiver Wortschatz umfasst Wörter, die man beim Hören oder Lesen versteht. Produktiver Wortschatz sind jene Wörter, die man selbst aktiv beim Sprechen oder Schreiben anwenden kann.
Sollte Wortschatz ein- oder zweisprachig vermittelt werden?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Verfahren. Während Einsprachigkeit die Immersion fördert, kann Zweisprachigkeit (Übersetzung) bei komplexen Begriffen für Klarheit sorgen.
Welche Phasen gibt es bei der Wortschatzarbeit im Unterricht?
Typischerweise erfolgt erst die Präsentation (Bedeutungsvermittlung), gefolgt von der Semantisierung, Festigung und schließlich der freien Anwendung in der Kommunikation.
- Citar trabajo
- Marisa Göhler (Autor), 2015, Kognitionspsychologische und didaktische Grundlagen der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314565