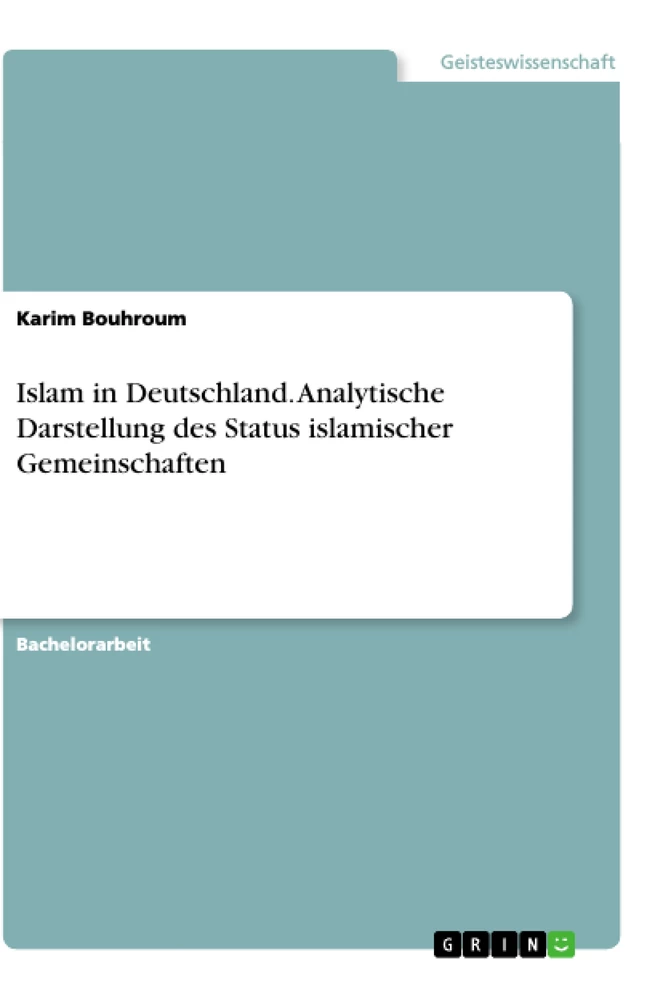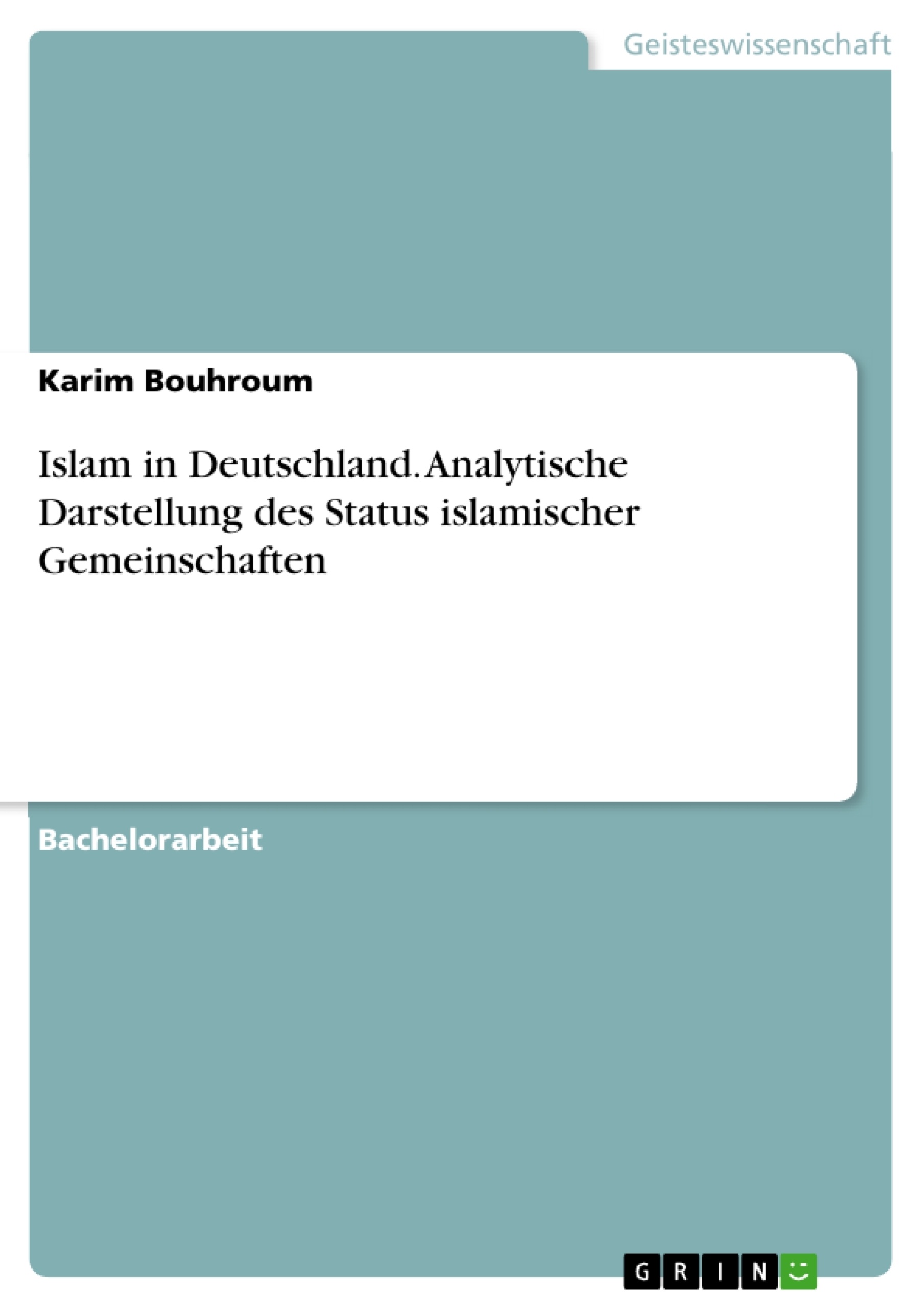Das Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist es, den Status muslimischer Gemeinschaften in Deutschland und die mit dem Status verbundenen Entwicklungen der letzten Jahre analytisch darzustellen. Im Fokus der Analyse stehen dabei die großen Dach- und Moscheeverbände auf Bundes- und Landesebene, die an der rechtlichen Gleichstellung ihrer Religionsgemeinschaft in der religiös pluralistischen Gesellschaft Deutschlands arbeiten.
Untersucht werden dabei im Laufe der Arbeit nicht nur der Status muslimischer Gemeinschaften in Bezug auf das Staatskirchenrecht, sondern auch die Entstehung einzelner Gemeinden, Organisationsstrukturen der Gemeinschaften in Deutschland und die Entwicklungen der Gemeinschaften vor allem, aber nicht ausschließlich, in den Jahren von 2010 bis 2013. Insgesamt lässt sich feststellen, dass es in den letzten Jahren zu positiven Entwicklungen gekommen ist und die rechtliche Gleichstellung muslimischer Gemeinschaften vorangeht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Entstehung muslimischer Gemeinschaften - ein historischer Rückblick
- 3 Organisationsstrukturen muslimischer Gemeinschaften im privaten Recht
- 3.1 Besonderheit des Organisationswesens im Islam
- 3.2 Grundlegende Aspekte der Organisationsstrukturen in Deutschland
- 3.3 Organisationsstrukturen auf Bundesebene
- 3.3.1 Die Deutsche Islamkonferenz (DIK)
- 3.3.2 Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DİTİB)
- 3.3.3 Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ)
- 3.3.4 Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)
- 3.3.5 Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland (IR)
- 3.3.6 Koordinationsrat der Muslime (KRM)
- 3.3.7 Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF)
- 3.4 Organisationsstrukturen auf Landesebene
- 3.4.1 Gründe für die Organisation auf Landesebene
- 3.4.2 Konferenz der Islamischen Landesverbände (KILV)
- 3.4.3 Islamische Föderation Berlin (IFB)
- 3.4.4 Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg (IGBW)
- 3.4.5 Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH)
- 3.4.6 Schura Hamburg
- 3.4.7 Schura Bremen
- 3.4.8 Schura Niedersachsen
- 3.4.9 Schura Schleswig-Holstein
- 3.4.10 Neuere Mitgliedsverbände
- 4 Anerkennungsmöglichkeiten muslimischer Gemeinschaften im öffentlichen Recht
- 4.1 Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts
- 4.2 Anerkennung durch Kooperation mit dem Staat
- 4.2.1 Staatsverträge mit Religionsgemeinschaften
- 4.2.2 Die Bildung von Runden Tischen mit muslimischen Gemeinschaften
- 5 Entwicklungen bei der öffentlichen Anerkennung muslimischer Gemeinschaften
- 6 Herausforderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert den Status muslimischer Gemeinschaften in Deutschland und deren Entwicklung in den letzten Jahren. Der Fokus liegt auf großen Dachverbänden und Moscheeverbänden auf Bundes- und Landesebene, die sich für die rechtliche Gleichstellung einsetzen. Untersucht werden der Status im Staatskirchenrecht, die Entstehung einzelner Gemeinden, Organisationsstrukturen und Entwicklungen von 2010 bis 2013.
- Der Status muslimischer Gemeinschaften im deutschen Staatskirchenrecht
- Die Entstehung und Entwicklung muslimischer Gemeinden in Deutschland
- Organisationsstrukturen muslimischer Gemeinschaften auf Bundes- und Landesebene
- Möglichkeiten der öffentlichen Anerkennung muslimischer Gemeinschaften
- Herausforderungen für die Anerkennung und Integration muslimischer Gemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, nämlich den Status muslimischer Gemeinschaften in Deutschland und die damit verbundenen Entwicklungen analytisch darzustellen. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf die großen Dachverbände und Moscheeverbände und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel und liefert eine erste Übersicht über die Thematik.
2 Die Entstehung muslimischer Gemeinschaften - ein historischer Rückblick: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung muslimischer Gemeinschaften in Deutschland. Es analysiert die Migrationsbewegungen, die zur Entstehung der Gemeinden führten, und beschreibt die Herausforderungen, vor denen diese Gemeinschaften in ihren Anfängen standen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der graduellen Entwicklung von kleinen, lokal organisierten Gruppen hin zu den heute bekannten Dachverbänden und Moscheegemeinden. Wichtige Meilensteine und Einflussfaktoren werden detailliert dargestellt, um ein umfassendes Verständnis der geschichtlichen Wurzeln zu ermöglichen.
3 Organisationsstrukturen muslimischer Gemeinschaften im privaten Recht: Dieses Kapitel untersucht die Organisationsstrukturen muslimischer Gemeinschaften in Deutschland im Kontext des Privatrechts. Es wird auf die Besonderheiten des islamischen Organisationswesens eingegangen und grundlegende Aspekte der Organisationsstrukturen in Deutschland erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Beschreibung der verschiedenen Organisationen auf Bundes- und Landesebene, inklusive ihrer jeweiligen Strukturen, Ziele und Einflüsse. Die Analyse umfasst die Darstellung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Organisationen und deren Interaktionen innerhalb der deutschen Gesellschaft.
4 Anerkennungsmöglichkeiten muslimischer Gemeinschaften im öffentlichen Recht: Kapitel 4 befasst sich mit den rechtlichen Möglichkeiten der Anerkennung muslimischer Gemeinschaften im öffentlichen Recht. Es analysiert die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und die Anerkennung durch Kooperation mit dem Staat, inklusive Staatsverträge und die Bildung von Runden Tischen. Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die verschiedenen Strategien, die von muslimischen Gemeinschaften zur Erlangung einer offiziellen Anerkennung verfolgt werden. Die Diskussion der Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze ist zentral für das Verständnis der komplexen rechtlichen Situation.
5 Entwicklungen bei der öffentlichen Anerkennung muslimischer Gemeinschaften: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Anerkennung muslimischer Gemeinschaften in Deutschland. Es analysiert die Rolle von Runden Tischen, Staatsverträgen und die Bemühungen um die Verleihung von Körperschaftsrechten. Die Darstellung konkreter Beispiele, wie beispielsweise die Situation in Hamburg und Bremen, dient der Veranschaulichung der Fortschritte und Herausforderungen, die mit dem Prozess der Anerkennung verbunden sind. Das Kapitel bietet einen aktuellen Stand der Entwicklung und zeigt die unterschiedlichen Wege auf, die von verschiedenen Bundesländern beschritten werden.
Schlüsselwörter
Muslimische Gemeinschaften, Deutschland, Staatskirchenrecht, Religionsfreiheit, Integrationspolitik, Dachverbände, Moscheeverbände, öffentliche Anerkennung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Staatsverträge, Runde Tische, Organisationsstrukturen, rechtliche Gleichstellung.
FAQ: Analyse des Status Muslimischer Gemeinschaften in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert den Status muslimischer Gemeinschaften in Deutschland und deren Entwicklung in den letzten Jahren. Der Fokus liegt auf großen Dachverbänden und Moscheeverbänden auf Bundes- und Landesebene, die sich für die rechtliche Gleichstellung einsetzen. Untersucht werden der Status im Staatskirchenrecht, die Entstehung einzelner Gemeinden, Organisationsstrukturen und Entwicklungen von 2010 bis 2013.
Welche Organisationen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf große Dachverbände und Moscheeverbände auf Bundes- und Landesebene. Konkrete Beispiele auf Bundesebene umfassen die Deutsche Islamkonferenz (DIK), DİTİB, VIKZ, ZMD, IR, KRM und AABF. Auf Landesebene werden die Konferenz der Islamischen Landesverbände (KILV), IFB, IGBW, IRH, sowie verschiedene Schuras (Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) und neuere Mitgliedsverbände genannt.
Welche Aspekte des Status muslimischer Gemeinschaften werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Status im Staatskirchenrecht, die Entstehung und Entwicklung muslimischer Gemeinden in Deutschland, deren Organisationsstrukturen auf Bundes- und Landesebene, Möglichkeiten der öffentlichen Anerkennung und die damit verbundenen Herausforderungen für Anerkennung und Integration.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, historische Entstehung muslimischer Gemeinschaften, Organisationsstrukturen im privaten Recht (mit detaillierter Betrachtung auf Bundes- und Landesebene), Anerkennungsmöglichkeiten im öffentlichen Recht (Körperschaft des öffentlichen Rechts und Kooperation mit dem Staat), Entwicklungen bei der öffentlichen Anerkennung und schließlich Herausforderungen.
Welche Arten der öffentlichen Anerkennung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und die Anerkennung durch Kooperation mit dem Staat, einschließlich Staatsverträge und die Bildung von Runden Tischen.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Der Fokus liegt auf Entwicklungen von 2010 bis 2013.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Muslimische Gemeinschaften, Deutschland, Staatskirchenrecht, Religionsfreiheit, Integrationspolitik, Dachverbände, Moscheeverbände, öffentliche Anerkennung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Staatsverträge, Runde Tische, Organisationsstrukturen, rechtliche Gleichstellung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts beschreibt.
Wo finde ich eine detaillierte Auflistung der untersuchten Organisationen?
Eine detaillierte Auflistung der untersuchten Organisationen auf Bundes- und Landesebene findet sich im Inhaltsverzeichnis und im Kapitel über die Organisationsstrukturen muslimischer Gemeinschaften im privaten Recht.
- Quote paper
- Karim Bouhroum (Author), 2013, Islam in Deutschland. Analytische Darstellung des Status islamischer Gemeinschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314584