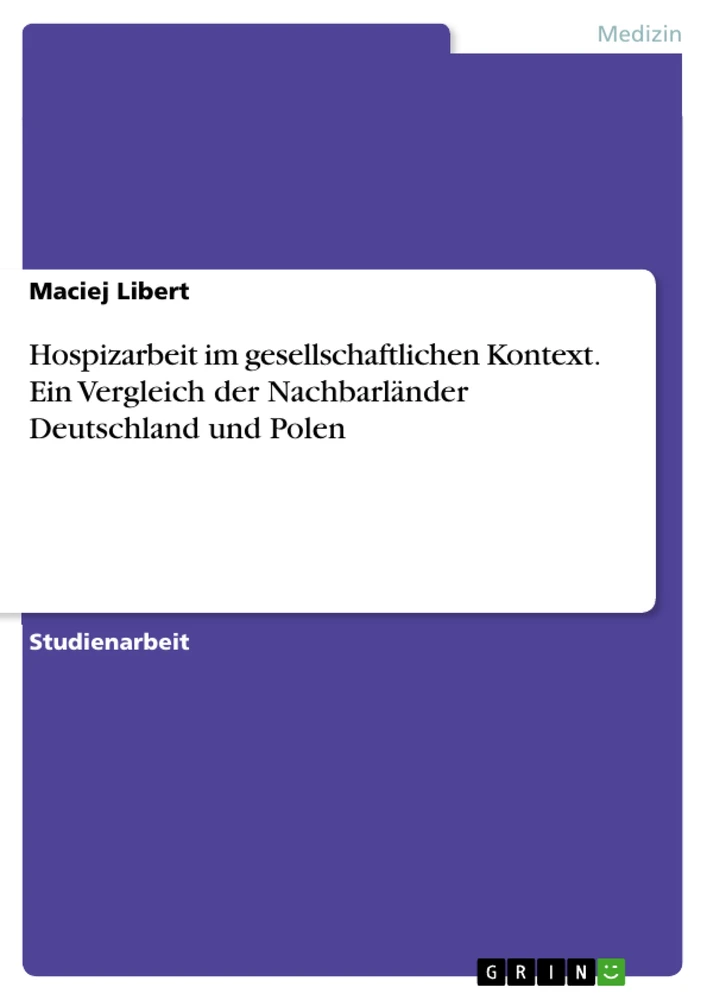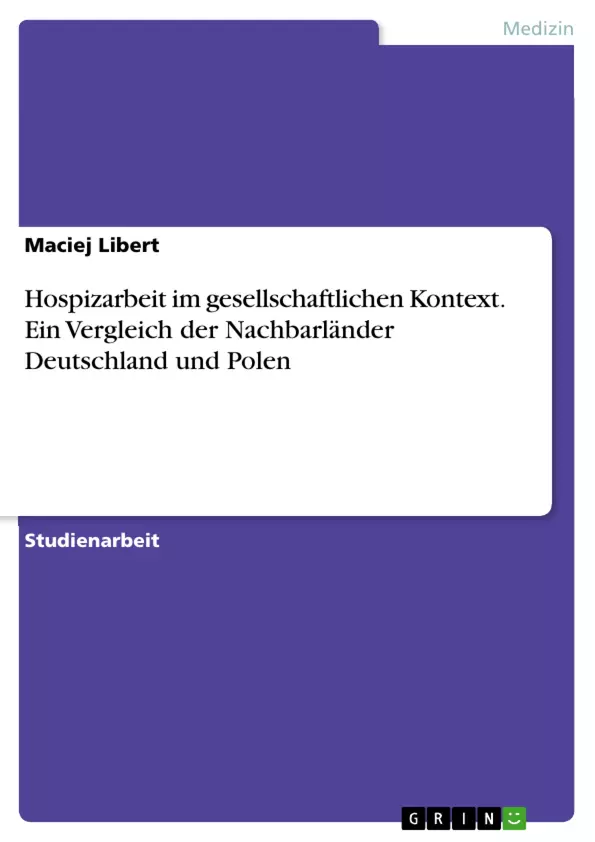„Den Tagen mehr Leben geben…” – diesen Leitspruch formulierte die Begründerin der Hospizarbeit, Cicley Saunders, und läutete damit Ende der 1950er Jahre einen Richtungswechsel im Umgang mit sterbenden Menschen ein.
In früheren Zeiten war es selbstverständlich zu Hause innerhalb der Familie zu sterben. Die Industrialisierung und der Glaube an die Medizin verlegte den Tod jedoch in Krankenhäuser. Parallel dazu ging mit den gesellschaftlichen Entwicklungen eine „Erosion der Familie“ einher. Schließlich wirkt sich der demographische Wandel entscheidend auf das Sterben aus: Immer weniger junge Menschen müssen immer mehr Alte versorgen. Aufgrund der beruflich geforderten Mobilität und Ungebundenheit leben Familien heute räumlich weit voneinander entfernt. Das traditionelle Familienmodell, das die Versorgung der Alten garantierte, trägt nicht mehr.
In dieser Situation entstanden die ersten Hospize als Orte für „würdiges Sterben“. Folgt man der aktuellen Statistik des Deutschen Hospiz und PalliativVerbandes (www.dhpv.de) existierten in Deutschland im Jahr 2011 195 stationäre Hospize, 231 Palliativstationen und rund 1.500 ambulante Hospiz- und Palliativdienste. Daneben gibt es eine ständig wachsende Zahl von Hospizvereinen und -initiativen, die die Wünsche und Bedürfnisse sterbender Menschen als Leitziel aller Begleitungs-, Betreuungs- und Behandlungsarbeit verstehen und so eine veränderte „Sterbekultur“ etablieren möchten.
Der Blick in unser Nachbarland Polen zeigt, wie sich die Hospizarbeit unter völlig anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt hat. Wirtschaftlich und politisch bewegt das Land immer noch die sozialistische Vergangenheit. Darüber hinaus ist in Polen der Einfluss der katholischen Kirche nach wie vor groß, der Zusammenhalt der Familie hat einen hohen Stellenwert und ist gleichzeitig aufgrund der ökonomischen Lage versorgende Notwendigkeit.
Um Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten feststellen zu können, werden in Kapitel 1 die Grundgedanken der Hospizarbeit sowie die Ausgestaltung palliativer Angebote dargestellt. In Kapitel 2 folgt eine Beschreibung der historischen Entwicklung der Hospizarbeit, die auch die Entwicklungen in Deutschland und Polen nachvollzieht. Anschließend werden im dritten Kapitel anhand verschiedener Aspekte Vergleiche zwischen den Nachbarländern gezogen und Unterscheidendes sowie Verbindendes herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Hospizarbeit als „Kultur des Sterbens“
- Palliative Care
- Organisationsformen hospizlicher Arbeit
- Organisationsformen hospizlicher Arbeit
- Geschichte der Hospizarbeit
- Ursprünge der Hospizarbeit im Mittelalter
- Hospizarbeit im 20. Jahrhundert
- Entwicklung der Hospizarbeit in Deutschland
- Entwicklung der Hospizarbeit in Polen
- Vergleichende Aspekte: Deutschland - Polen
- Demographische Lage
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Finanzierung
- Versorgungssituation
- Rolle des Ehrenamtes
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Hospizarbeit in Deutschland und Polen im gesellschaftlichen Kontext und vergleicht die Entwicklung und Organisation der Hospizbewegung in beiden Ländern. Die Arbeit analysiert die historischen Wurzeln, die aktuellen Organisationsformen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Hospizarbeit. Ein besonderer Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der beiden Länder bezüglich demografischer Faktoren, Finanzierung und der Rolle des Ehrenamtes.
- Historische Entwicklung der Hospizarbeit in Deutschland und Polen
- Vergleich der Organisationsformen der Hospizarbeit in beiden Ländern
- Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Finanzierung der Hospizarbeit
- Rolle des Ehrenamtes in der Hospizarbeit
- Demographische Einflüsse auf die Hospizarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung stellt den Leitspruch der Hospizarbeit "Den Tagen mehr Leben geben" vor und erläutert den Wandel im Umgang mit Sterbenden im Kontext von Industrialisierung, medizinischem Fortschritt und dem demografischen Wandel. Sie beschreibt den Rückgang traditioneller Familienstrukturen und die daraus resultierende Notwendigkeit von Hospizen als Orte für ein würdiges Sterben. Die Einleitung vergleicht die Situation in Deutschland (mit einer etablierten Hospizlandschaft) und Polen (mit einem anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext), um den Rahmen für den Vergleich im weiteren Verlauf der Arbeit zu setzen.
Hospizarbeit als „Kultur des Sterbens“: Dieses Kapitel definiert den Begriff Hospizarbeit und grenzt ihn vom umfassenderen Begriff „Palliative Care“ ab. Es wird der Unterschied zwischen kurativen und palliativen Behandlungsansätzen herausgearbeitet. Die Definition von Palliative Care nach WHO wird ausführlich dargestellt und ihre Prinzipien erläutert, welche die Lebensqualität der Sterbenden und ihrer Angehörigen in den Mittelpunkt stellen und die Akzeptanz der Endlichkeit des Lebens betonen. Die verschiedenen Organisationsformen hospizlicher Arbeit werden kurz angerissen.
Geschichte der Hospizarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung der Hospizarbeit, beginnend mit ihren Ursprüngen im Mittelalter. Es wird der Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Sterbens und die Entstehung der modernen Hospizbewegung nachgezeichnet. Die Kapitel behandelt die Entwicklung der Hospizarbeit in Deutschland und Polen separat, wobei die unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Die Rolle der katholischen Kirche in Polen wird als ein relevanter Faktor für die Entwicklung der Hospizarbeit in diesem Land hervorgehoben.
Vergleichende Aspekte: Deutschland - Polen: Dieses Kapitel vergleicht die Hospizarbeit in Deutschland und Polen anhand verschiedener Aspekte. Es werden die demografischen Unterschiede, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsmodelle, die Versorgungssituation und die Rolle des Ehrenamtes in beiden Ländern analysiert. Die Kapitel beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Detail, um ein umfassendes Bild der Hospizarbeit in beiden Ländern zu liefern. Der Vergleich soll die Herausforderungen und Erfolge der Hospizbewegung in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten aufzeigen.
Schlüsselwörter
Hospizarbeit, Palliative Care, Deutschland, Polen, Sterbebegleitung, Demografie, Gesetzliche Rahmenbedingungen, Finanzierung, Ehrenamt, Sozialismus, Katholische Kirche, Vergleichende Analyse, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Vergleichende Analyse der Hospizarbeit in Deutschland und Polen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit vergleicht die Hospizarbeit in Deutschland und Polen. Sie untersucht die historische Entwicklung, die Organisationsformen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Finanzierung der Hospizbewegung in beiden Ländern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den demografischen Einflüssen und der Rolle des Ehrenamtes.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einführung, die den Wandel im Umgang mit Sterbenden und die Notwendigkeit von Hospizen erläutert. Es folgt eine Definition von Hospizarbeit und Palliative Care. Die Geschichte der Hospizarbeit in Deutschland und Polen wird separat behandelt, bevor ein Vergleich beider Länder anhand demografischer Faktoren, gesetzlicher Rahmenbedingungen, Finanzierung, Versorgungssituation und der Rolle des Ehrenamtes erfolgt. Die Arbeit schließt mit einem Resümee.
Wie wird Hospizarbeit definiert und von Palliative Care abgegrenzt?
Die Arbeit definiert Hospizarbeit und grenzt sie von dem umfassenderen Begriff „Palliative Care“ ab. Die WHO-Definition von Palliative Care wird erläutert, mit dem Fokus auf die Verbesserung der Lebensqualität Sterbender und ihrer Angehörigen und die Akzeptanz der Endlichkeit des Lebens. Die verschiedenen Organisationsformen hospizlicher Arbeit werden ebenfalls kurz vorgestellt.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge der Hospizarbeit im Mittelalter und verfolgt ihren Wandel bis zur modernen Hospizbewegung. Die Entwicklung in Deutschland und Polen wird separat dargestellt, wobei die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Die Rolle der katholischen Kirche in Polen wird als relevanter Faktor hervorgehoben.
Wie werden Deutschland und Polen im Vergleich dargestellt?
Der Vergleich fokussiert auf demografische Unterschiede, gesetzliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsmodelle, die Versorgungssituation und die Rolle des Ehrenamtes. Die Arbeit hebt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede hervor, um ein umfassendes Bild der Hospizarbeit in beiden Ländern zu liefern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hospizarbeit, Palliative Care, Deutschland, Polen, Sterbebegleitung, Demografie, Gesetzliche Rahmenbedingungen, Finanzierung, Ehrenamt, Sozialismus, Katholische Kirche, Vergleichende Analyse, Lebensqualität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Einführung, Hospizarbeit als „Kultur des Sterbens“, Geschichte der Hospizarbeit, Vergleichende Aspekte: Deutschland - Polen und Resümee. Jedes Kapitel beinhaltet spezifische Unterpunkte, wie z.B. die verschiedenen Organisationsformen hospizlicher Arbeit oder die Entwicklung der Hospizarbeit in einzelnen Ländern.
Wo liegt der Fokus der vergleichenden Analyse?
Der Schwerpunkt der vergleichenden Analyse liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Organisation, Finanzierung und gesetzlichen Rahmenbedingungen der Hospizarbeit in Deutschland und Polen, unter Berücksichtigung demografischer Faktoren und der Rolle des Ehrenamtes.
- Citation du texte
- Maciej Libert (Auteur), 2014, Hospizarbeit im gesellschaftlichen Kontext. Ein Vergleich der Nachbarländer Deutschland und Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314603