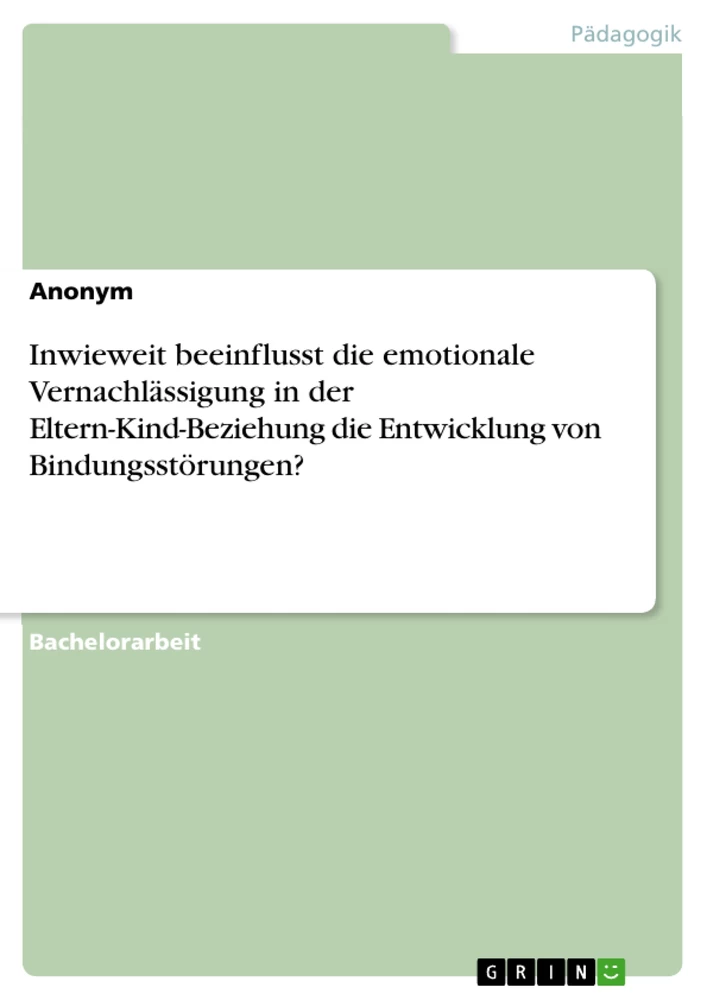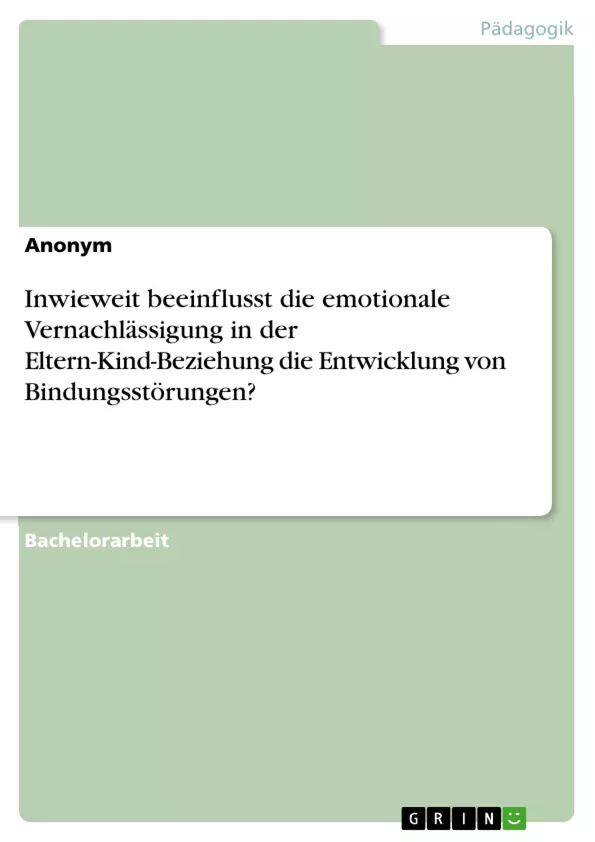Kommt ein Kind in eine Kindertagesstätte, hat es bereits die ersten Bindungserfahrungen mit seinen Hauptbezugspersonen, meistens den Eltern gemacht. Gerade Kinder, deren Beziehung zu den Eltern von Unsicherheit geprägt ist, können von einer hochwertigen außerhäuslichen Betreuung profitieren, wenn dadurch für sie die Möglichkeit gegeben ist, mit einer stabilen Bezugsperson eine sichere Bindung einzugehen. Eine große Bedeutung spielt bei der außerhäuslichen Betreuung die Qualität, welche die Institution aufweist. Hierfür wurden bereits Konzepte für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren entwickelt, welche auf eine bindungsorientierte Eingewöhnung des Kindes setzen.
In der Grundschulzeit, wird dem Bindungsaspekt durch die Konstanz des/der Klassenlehrers/lehrerin noch Rechnung getragen, doch spätestens mit dem Besuch der weiterführenden Schulen verliert der/die Klassenlehrer/in durch die Vielzahl der Fachlehrer/innen an Bindungsbedeutung. Dabei könnten durch die Herstellung einer guten Beziehung zum Lehrer bzw. zur Lehrerin eventuelle Bindungsdefizite zur primären Bezugsperson kompensiert werden.
Zudem stellt die emotionale Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für optimales Lernen dar. Besonders bei Schulwechseln haben es Schüler/innen häufig mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun. Jedoch sehen sich Lehrer/innen häufig nicht dazu in der Lage, die Rolle der Schulbezugsperson für ein Kind einzunehmen, da sie häufig die Vorstellung haben, sich „keinen Ärger“ einzuhandeln, wenn sie in der Klasse mit Schülern eher bindungsvermeidend und distanziert umgehen und sich nur auf den Lehrstoff fokussieren.
Es gibt immer mehr Kinder, denen die nötige emotionale Zuwendung von Zuhause aus fehlt und die von ihren Eltern vernachlässigt werden. Aufgrund der medialen Berichterstattung denken viele Menschen beim Stichwort „Vernachlässigung“ zunächst einmal an eine gravierende körperliche Mangelversorgung. Es wird häufig die Vernachlässigung kindlicher Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung oder kognitiver Anregung außer Acht gelassen.
In der Arbeit wird folgender Fragestellung nachgegangen: „Inwieweit beeinflusst die emotionale Vernachlässigung in der Eltern-Kind Beziehung die Entwicklung von Bindungsstörungen?“
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Kindeswohlgefährdung
- 2.1.1 Vernachlässigung/ emotionale Vernachlässigung
- 2.2 Definition Bindung und Bindungsverhalten
- 2.3 Definition Bindungsstörung
- 2.1 Kindeswohlgefährdung
- 3. Die Eltern-Kind Beziehung als Basis einer gesunden seelischen Entwicklung
- 3.1 Die Bindungstheorie nach John Bowlby
- 3.2 Die kindlichen Bindungsmuster: Entstehung und Bedeutung für das weitere Leben
- 4. Emotionale Vernachlässigung
- 4.1 Erkenntnisse zur Verbreitung von Vernachlässigung
- 4.2 Bedingungsfaktoren von Vernachlässigung
- 4.3 Bindungsstörungen und weitere Folgen von elterlicher Vernachlässigung für die psycho-soziale Entwicklung und die Beziehungsgestaltung
- 5. Bindungsstörungen
- 5.1 Typologien von Bindungsstörungen
- 5.2 Auswirkungen von Bindungsstörungen
- 6. Zwischenfazit
- 7. Sozialpädagogische Relevanz
- 7.1 Beispiel Bindungstheoretischer Arbeit in der Heimerziehung
- 7.2 Schlussfolgerungen für sozialpädagogische Fachkräfte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert den Einfluss emotionaler Vernachlässigung in der Eltern-Kind-Beziehung auf die Entwicklung von Bindungsstörungen. Sie setzt sich zum Ziel, ein tiefergehendes Verständnis für die Bedeutung der frühen Bindungserfahrungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Die Arbeit fokussiert auf die Relevanz der Bindungstheorie für die Praxis der Sozialpädagogik.
- Begriffsdefinitionen von Kindeswohlgefährdung, Bindung und Bindungsstörungen
- Die Eltern-Kind-Beziehung und die Entstehung von Bindungsmustern
- Verbreitung, Bedingungsfaktoren und Folgen von emotionaler Vernachlässigung
- Typologien und Auswirkungen von Bindungsstörungen
- Relevanz der Bindungstheorie für die sozialpädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Thematik der emotionalen Vernachlässigung ein und beleuchtet die Relevanz von Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit. Es wird die Bedeutung einer stabilen Bezugsperson in der außerhäuslichen Betreuung und die Rolle von Lehrkräften in der Schulzeit in Bezug auf Bindungsdefizite thematisiert.
Kapitel 2 definiert wichtige Begriffsdefinitionen wie Kindeswohlgefährdung, Bindung, Bindungsverhalten und Bindungsstörungen. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel.
Das dritte Kapitel stellt die Bindungstheorie nach John Bowlby vor und erläutert die Entstehung und Bedeutung von kindlichen Bindungsmustern für das weitere Leben. Es zeigt auf, wie frühe Bindungserfahrungen die psycho-soziale Entwicklung beeinflussen.
Kapitel 4 beleuchtet die Erkenntnisse zur Verbreitung von Vernachlässigung und analysiert die Bedingungsfaktoren, die zu emotionaler Vernachlässigung führen können. Es wird untersucht, wie diese Form der Vernachlässigung die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen kann.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit verschiedenen Typologien von Bindungsstörungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die möglichen Folgen von Bindungsstörungen werden anhand von Fallbeispielen aus der Praxis veranschaulicht.
Das sechste Kapitel fasst die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel aus bindungstheoretischer Sicht zusammen und verdeutlicht deren Relevanz für die sozialpädagogische Praxis.
Kapitel 7 befasst sich mit der sozialpädagogischen Relevanz der Bindungstheorie und beleuchtet die Bedeutung bindungsorientierter Arbeit in der Heimerziehung. Es wird gezeigt, wie sozialpädagogische Fachkräfte Kindern mit negativen Bindungserfahrungen positive Bindungserfahrungen ermöglichen können.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern der emotionalen Vernachlässigung, der Bindungstheorie, der Bindungsstörungen, der Bedeutung früher Bindungserfahrungen und der sozialpädagogischen Praxis. Wichtige Begriffe sind dabei Kindeswohlgefährdung, emotionale Vernachlässigung, Bindungsverhalten, Bindungsqualität, Bindungsmuster, Typologien von Bindungsstörungen, Auswirkungen von Bindungsstörungen, Heimerziehung, sozialpädagogische Arbeit.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2014, Inwieweit beeinflusst die emotionale Vernachlässigung in der Eltern-Kind-Beziehung die Entwicklung von Bindungsstörungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314662