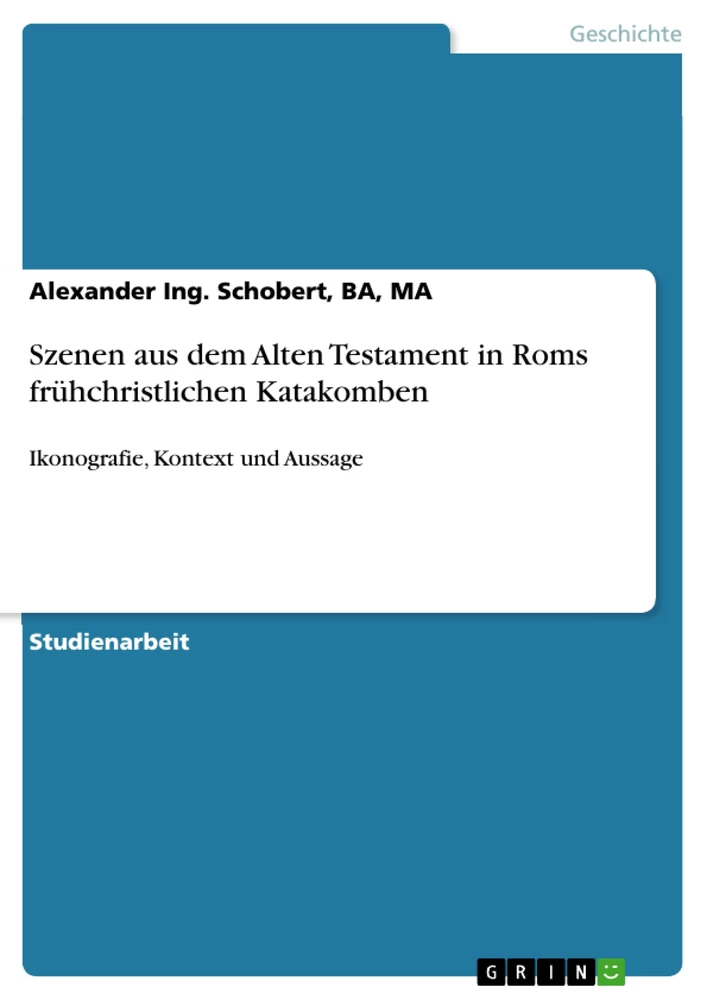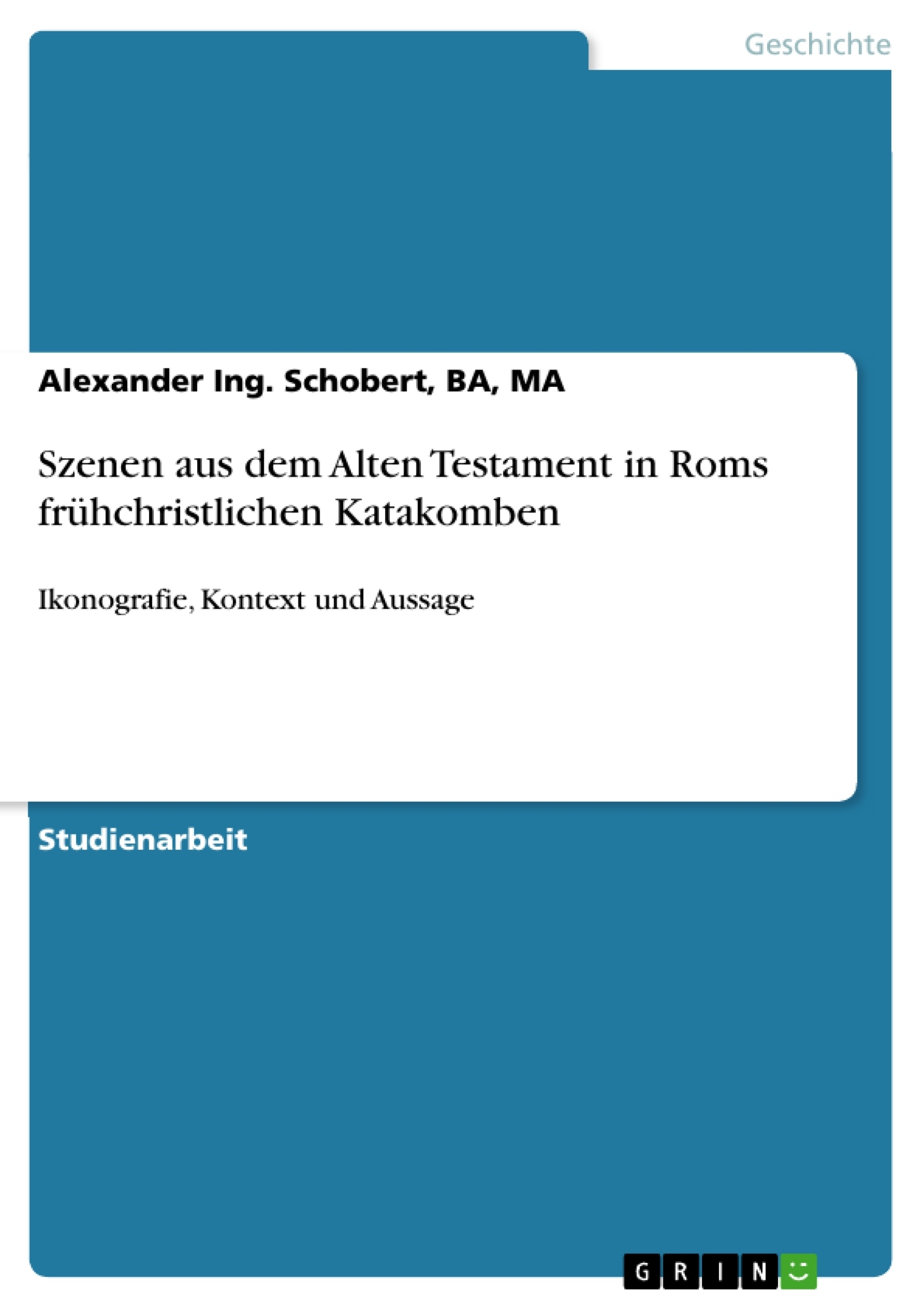Die vorliegende Arbeit untersucht die Ikonografie alttestamentarischer Szenen in den frühchristlichen Katakomben Roms.
Die Jenseitsvorstellungen der frühen Christen wurden durch Anknüpfung an pagane Darstellungen des Elysiums, durch sakral interpretierte Oranten, Mahldarstellungen und bukolische Szenen sowie durch die Verwendung bestimmter Themen aus dem Alten und Neuen Testament am Grab zum Ausdruck gebracht. Dass die Christen des dritten Jahrhunderts bei der von ihnen in Auftrag gegebenen Grabkunst frequent auf pagane Motive zurückgriffen, zeigt, dass es eine spezifisch christliche Ikonografie zu jener Zeit noch nicht gab und man sowohl in Stil und Form den zeitgenössischen Tendenzen folgte.
Im Laufe der Zeit entstand eine eigenständige Bildsprache, die weniger theologische Reflexion als die Sehnsucht nach Überwindung des Todes und Hoffnung auf die Auferstehung widerspiegelt. Bereits der Denkmälerbestand des 3. Jahrhunderts macht deutlich, dass sich die frühen Christen in den Katakomben bevorzugt für verkürzte Errettungsszenen aus dem Alten Testament entschieden. Die Wandlung von Endymion zu Jona oder vom bukolischen Schafträger zum Guten Hirten belegt den freien Umgang der Maler mit traditionellem Bildgut zur Erschließung der christlichen Bildthemen. Ein Beweis für die inhaltliche Weiterentwicklung einzelner Motive ist speziell mit der Errettung Daniels aus der Löwengrube gegeben, da männliche Oranten bei paganen Darstellungen nicht vorkommen.
Themen des Neuen Testamentes sind in geringerer Zahl in den Katakomben vertreten und beschäftigen sich weniger mit dem Jenseits oder dem Schicksal der Seele, sondern mit Heilung und Speisung. Erst im Verbund mit alttestamentlichen Episoden, welche vorausweisend, die einzig mögliche Errettung in Christus betonen, verdeutlicht sich die zentrale Aussage des Christentums: die Auferstehung.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Das Paradies, Adam und Eva und die Himmelfahrt Elias
- 3. Darstellungen maritimer Episoden des Alten Testaments
- 3.1 Noah in der Arche und der Jonaszyklus
- 3.2 Die Philoxenie und das Opfer Abrahams
- 3.3 Mose, der Archetypus Christi als Prophet
- 4. Episoden aus dem Buch Daniel
- 4.1. Daniel in der Löwengrube
- 4.2. Die drei Jünglinge im Feuerofen
- 4.3. Daniels Richtspruch über Susanna und die beiden Ältesten
- 5. Resümee
- 6. Abkürzungen
- 7. Abbildungsnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Text befasst sich mit der Darstellung des Todes und der Jenseitsvorstellungen im Römischen Reich unter den Soldatenkaisern (3. Jahrhundert n. Chr.). Dabei untersucht er, wie sich das Christentum in dieser Zeit in der römischen Gesellschaft etablierte und welche Rolle es im Angesicht der Krise und des Wertewandels spielte. Die Analyse der christlichen Grabmale und Katakomben soll Einblicke in die Jenseitsvorstellungen der ersten Christen und die Bedeutung des Todes in ihrem religiösen Kontext liefern.
- Das Christentum im 3. Jahrhundert n. Chr. als Antwort auf die Reichskrise
- Die Rolle des Todes in der antiken Welt und die Jenseitsvorstellungen der ersten Christen
- Die Bedeutung von Grabmale und Katakomben als Ausdruck des christlichen Glaubens
- Die Abgrenzung des Christentums von anderen Religionen und Kulten
- Die Integration paganer Elemente in die christliche Tradition
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des 3. Jahrhunderts n. Chr. dar und beschreibt die Bedeutung des Todes in der antiken Welt. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Umbrüche, die mit der Reichskrise einhergingen, und zeigt, wie das Christentum in dieser Zeit eine neue Bedeutung für die Menschen gewann.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Paradieses, der Geschichte von Adam und Eva und der Himmelfahrt Elias. Es werden die biblischen Erzählungen in Bezug auf die Jenseitsvorstellungen und die Bedeutung des Todes interpretiert.
Das dritte Kapitel analysiert die Darstellungen maritimer Episoden des Alten Testaments, wie z.B. Noah in der Arche und den Jonaszyklus. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 untersuchen die Bedeutung dieser Erzählungen für das Verständnis der Jenseitsvorstellungen und die Rolle von Moses als Archetypus Christi.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Episoden aus dem Buch Daniel, wie z.B. Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im Feuerofen und Daniels Richtspruch über Susanna und die beiden Ältesten. Es wird analysiert, wie diese Geschichten die christliche Jenseitsvorstellung und das Leid in der Welt interpretieren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Das Römische Reich, Soldatenkaiser, Reichskrise, Christentum, Jenseitsvorstellungen, Tod, Grabmale, Katakomben, Bibel, Altes Testament, Daniel, Noah, Mose, Mysterienkulte, Paganismus, Volksfrömmigkeit, Apokalypse, Bildsprache, Mosaisches Bilderverbot, Caritas.
Häufig gestellte Fragen
Welche alttestamentlichen Szenen findet man oft in römischen Katakomben?
Häufig dargestellt werden Jona und der Wal, Noah in der Arche, Daniel in der Löwengrube und das Opfer Abrahams.
Warum wählten frühe Christen Szenen aus dem Alten Testament für ihre Gräber?
Diese Szenen dienten als Symbole für die Errettung durch Gott und drückten die Hoffnung auf Auferstehung und Überwindung des Todes aus.
Wie wurden pagane Motive in die christliche Kunst integriert?
Christen nutzten bekannte Bilder wie den bukolischen Schafträger und deuteten ihn zum „Guten Hirten“ oder Endymion zur Figur des Jona um.
Was symbolisiert die Figur des Daniel in der Löwengrube?
Daniel steht für den standhaften Glauben in der Verfolgung und die wunderbare Errettung durch göttliches Eingreifen.
Gibt es Unterschiede zwischen Darstellungen des Alten und Neuen Testaments?
Szenen des Neuen Testaments fokussieren oft auf Heilung und Speisung, während alttestamentliche Szenen oft als vorausweisende Typologien für Christus dienen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Ing. Schobert, BA, MA (Autor:in), 2015, Szenen aus dem Alten Testament in Roms frühchristlichen Katakomben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314665