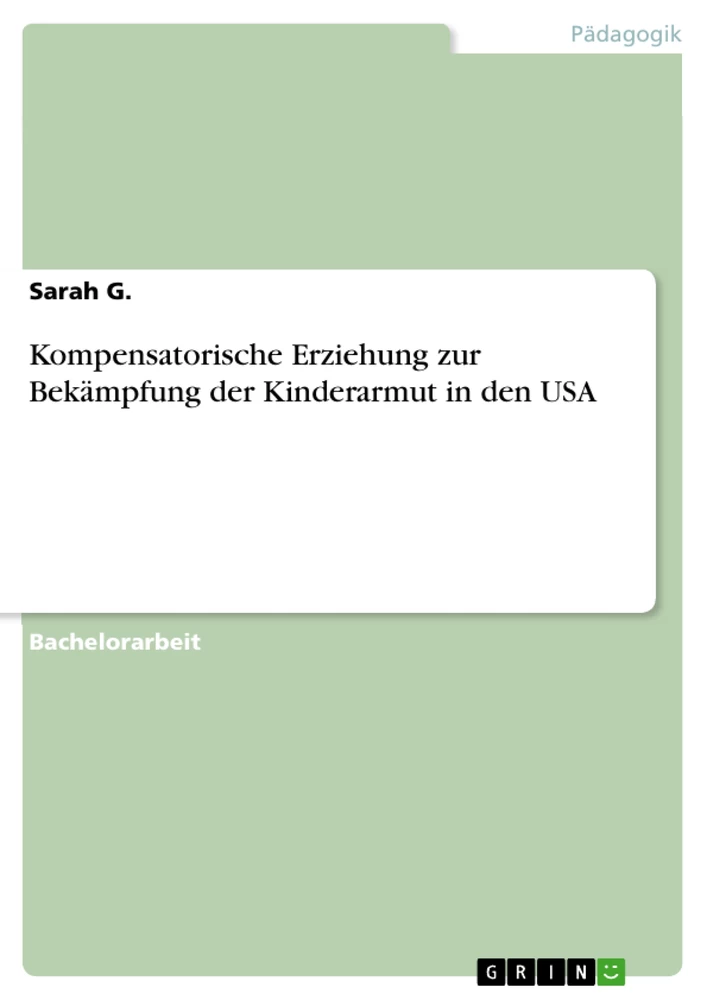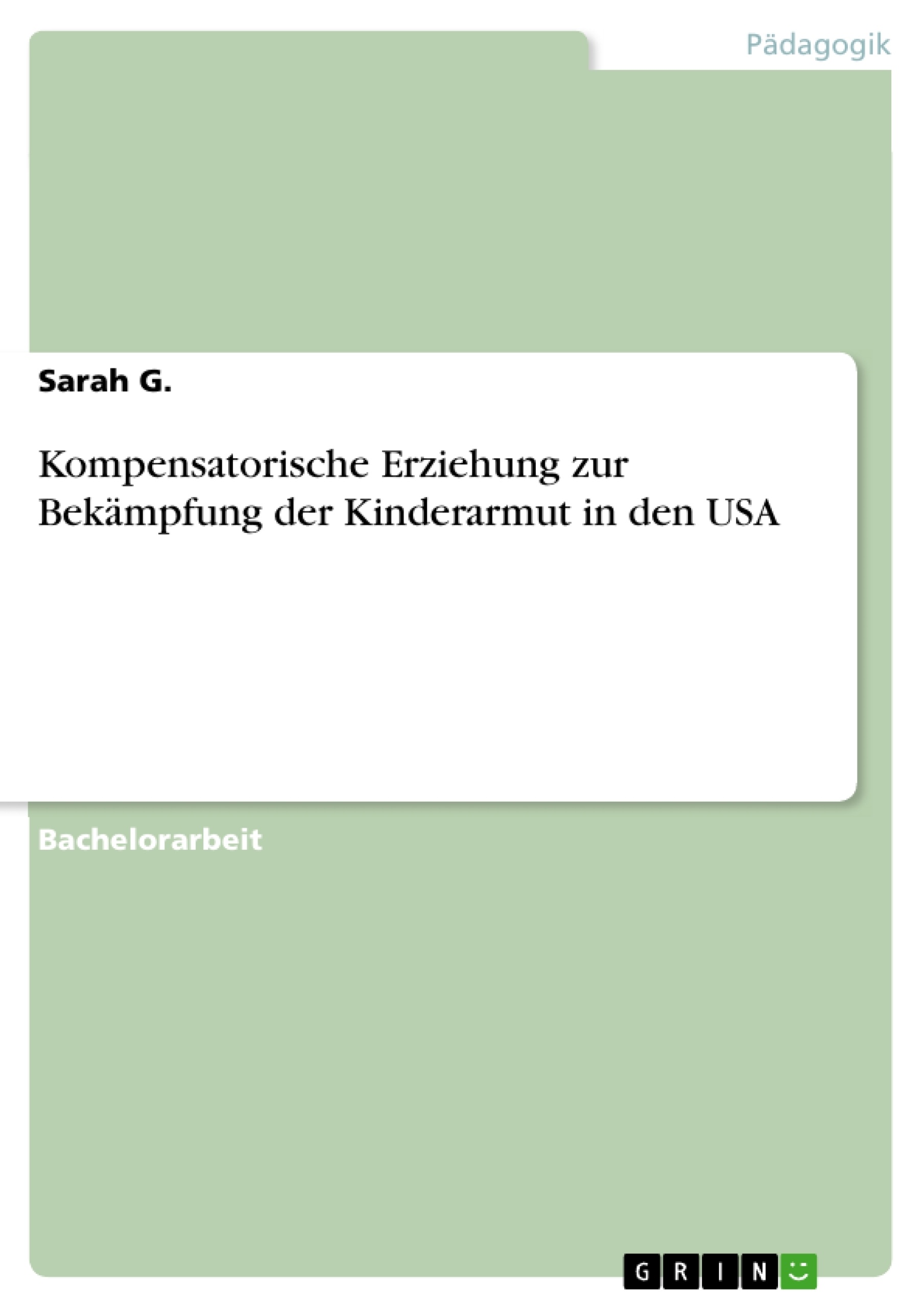Kann das Konzept der kompensatorischen Erziehung im aktuellen Kampf gegen Kinderarmut im Allgemeinen und im Kampf um Chancengleichheit auf Bildung für sozial benachteiligte Kinder im Speziellen in den USA bestehen oder gibt es gegenwärtig alternative Konzepte?
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Kinderarmut im Allgemeinen und insbesondere mit dem in den USA entstandenen Konzept der kompensatorischen Erziehung. Hierbei wird auf das unter diesem Konzept entwickelte Vorschulprogramm „Head Start“ eingegangen.
Mit Hilfe einer Analyse dessen soll versucht werden, die Aktualität der Anwendung des Konzeptes der kompensatorischen Erziehung in den USA darzustellen. Dem gegenüber werden alternative Projekte bzw. Programme vorgestellt. In einer abschließenden Diskussion soll herausgearbeitet werden, inwiefern das Konzept der kompensatorischen Erziehung die Chancengleichheit von Bildung für sozial benachteiligte Kinder aktuell in den USA ermöglichen kann oder ob es eventuell derzeit vorteilhaftere Alternativprogramme gibt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung in den Themenbereich
- Aufbau der Bachelorarbeit
- 1. Zur Entwicklung der Forschungsfrage
- 1.1. Einblick in den aktuellen Forschungsstand
- 1.2. Formulierung der Forschungsfrage
- 1.3. Methodische Vorgehensweise
- 1.4. Bildungswissenschaftliche Relevanz
- 2. Kinder in Armut
- 2.1. Unterschied zwischen sozial benachteiligte Kinder und sozial begünstigten Kindern
- 2.2. Wechselwirkung von Bildung und Armut
- 3. Das Konzept der Kompensatorischen Erziehung
- 3.1. Begriffsklärung und Entwicklung der kompensatorischer Erziehung
- 3.2. Ziele kompensatorischer Erziehung
- 3.3. Dimensionen und Programme kompensatorischer Erziehung
- 3.4. Head Start Program
- 3.4.1. Einordnung und historischer Hintergrund des Head Start Programs
- 3.4.2. Ziele des Head Start Program
- 3.4.3. Analyse vom Head Start
- 4. Ein Konzept der Gegenwart
- 4.1. The National Center for Children in Poverty
- 4.2. Projekte des National Center for Children Poverty (NCCP)
- 5. Gegenüberstellung und Diskussion der Konzepte „Kompensatorischen Erziehung“ und The National Center for Children in Poverty
- 6. Beantwortung der zentralen Forschungsfrage
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie die kompensatorische Erziehung in den USA dazu beitragen kann, die Nachteile von Kinderarmut auszugleichen. Sie analysiert das Head Start Programm und stellt es dem National Center for Children in Poverty (NCCP) gegenüber, um die aktuelle Relevanz der Konzepte im Kampf gegen Kinderarmut zu diskutieren.
- Kinderarmut in den USA
- Kompensatorische Erziehung als Instrument zur Bekämpfung von Kinderarmut
- Das Head Start Programm
- Das National Center for Children in Poverty (NCCP)
- Chancengleichheit in der Bildung für sozial benachteiligte Kinder
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einführung stellt den historischen Kontext der kompensatorischen Erziehung in den USA dar und führt in die Forschungsfrage ein. Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Entwicklung der Forschungsfrage, indem es den aktuellen Forschungsstand, die Forschungslücke und die methodische Vorgehensweise der Arbeit beleuchtet. Kapitel 2 erklärt den Begriff der Kinderarmut und die Unterschiede zwischen sozial benachteiligten und sozial begünstigten Kindern. Kapitel 3 beschreibt das Konzept der kompensatorischen Erziehung, seine Ziele und Dimensionen und analysiert das Head Start Programm. Kapitel 4 stellt das National Center for Children in Poverty (NCCP) vor und erläutert seine Projekte. In Kapitel 5 werden beide Konzepte verglichen und ihre aktuelle Relevanz diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kinderarmut, kompensatorische Erziehung, Head Start, National Center for Children in Poverty (NCCP), Chancengleichheit, Bildung, sozial benachteiligte Kinder, USA.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der kompensatorischen Erziehung?
Es handelt sich um pädagogische Maßnahmen, die darauf abzielen, soziale und bildungsbezogene Nachteile von Kindern aus armen Familien durch gezielte Förderung auszugleichen.
Was ist das „Head Start“ Programm?
Head Start ist ein in den 1960er Jahren in den USA entwickeltes Vorschulprogramm, das Kindern aus einkommensschwachen Familien umfassende Förderung in Bildung, Gesundheit und Ernährung bietet.
Wie hängen Bildung und Kinderarmut in den USA zusammen?
Kinderarmut führt oft zu geringeren Bildungschancen, was wiederum das Risiko für Armut im Erwachsenenalter erhöht. Kompensatorische Erziehung soll diesen Kreislauf durchbrechen.
Welche Rolle spielt das National Center for Children in Poverty (NCCP)?
Das NCCP entwickelt moderne Projekte und Strategien zur Bekämpfung von Kinderarmut und dient in der Arbeit als zeitgenössischer Vergleich zum Head Start Modell.
Kann kompensatorische Erziehung heute noch bestehen?
Die Arbeit diskutiert die aktuelle Relevanz des Konzepts und prüft, ob moderne alternative Programme mittlerweile effektiver für die Herstellung von Chancengleichheit sind.
Was sind die Ziele der kompensatorischen Erziehung?
Hauptziele sind die Verbesserung der Schulfähigkeit, die Förderung der kognitiven Entwicklung und die soziale Integration benachteiligter Kinder.
- Arbeit zitieren
- Sarah G. (Autor:in), 2013, Kompensatorische Erziehung zur Bekämpfung der Kinderarmut in den USA, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314828