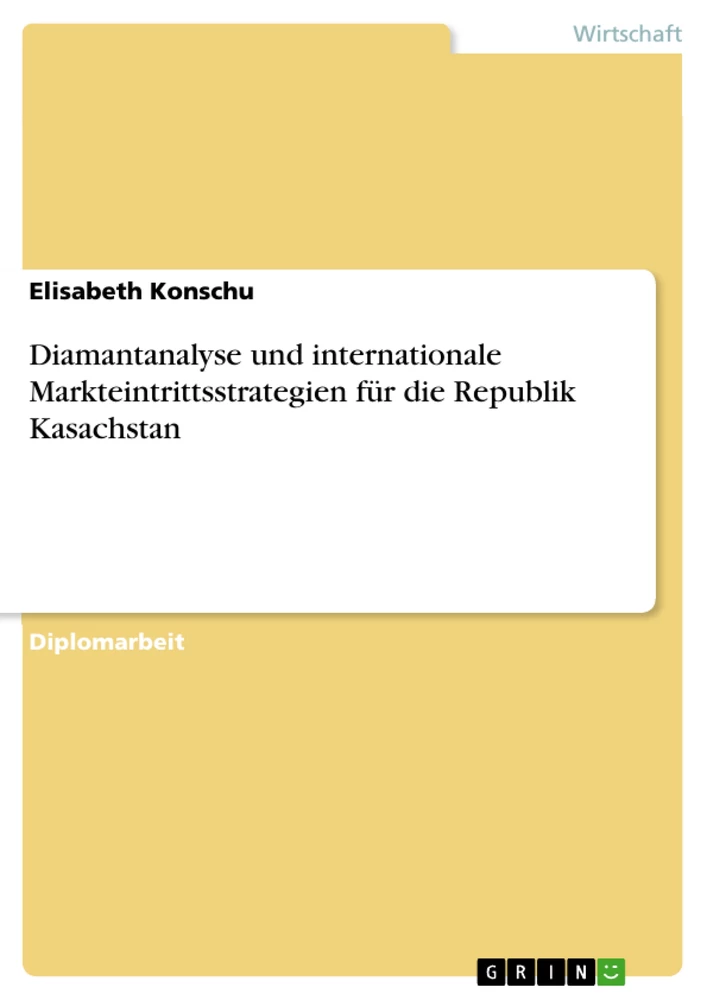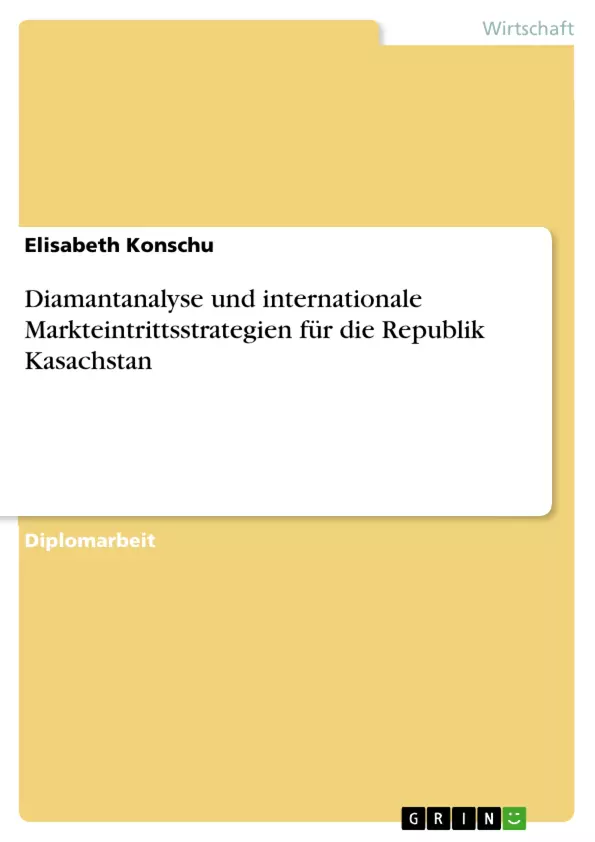Als die Sowjetunion im Dezember 1991 aufgelöst wurde, gewannen ihre Nachfolgestaaten nach und nach ihre politische Unabhängigkeit. Kurz darauf schlossen sich einige dieser Staaten zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zusammen, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Sicherheits- und Wirtschaftsraum zu schaffen. Zur GUS gehören derzeit elf Staaten, unter anderem Russland, Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan. Dieser Zusammenschluss und die vielen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die durch die Öffnung dieser Region aufgetan wurden, erschienen vielen Unternehmen der westlichen sowie der asiatischen Welt einerseits als äußerst erfolgsversprechend, andererseits wurde Zentralasien bis Anfang der 1990er Jahre als Gefahr- und Krisenregion wahrgenommen. So wird sie beispielsweise als Region beschrieben, in der "schwer durchschaubare und schwer beeinflussbare nationale, ethnische und religiöse Leidenschaften und wirtschaftliche Interessen eine brisante Mischung ergeben, die nur mit Glück unter einer friedlichen Decke gehalten werden können". Diese anfänglichen Befürchtungen haben sich allerdings angesichts der positiven Entwicklung der Region nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, man schätzt diese Region heute als wertvollen und angenehmen Wirtschaftspartner.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Thematik, Relevanz und Aufbau der Arbeit
- 1.1 Die Republik Kasachstan
- 1.2 Motive für ein Engagement in Kasachstan
- 1.2.1 Motive für die Internationalisierung von Unternehmen
- 1.2.2 Positive Standortfaktoren Kasachstans
- 1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Diamantansatz der Internationalisierung von Porter
- 2.1 Ausgangspunkt
- 2.2 Bestimmungsfaktoren
- 2.2.1 Faktorbedingungen
- 2.2.2 Nachfragebedingungen
- 2.2.3 Verwandte und unterstützende Branchen
- 2.2.4 Unternehmensstrategien, Strukturen und Wettbewerb
- 2.3 Zusatzbedingungen
- 2.3.1 Staat
- 2.3.2 Zufall
- 2.4 Clustertheorie
- 2.5 Wettbewerbsentwicklung von Volkswirtschaften
- 2.6 Kritische Bewertung des Diamantansatzes
- 3 Erweiterte Diamantanalyse der Republik Kasachstan
- 3.1 Bestimmungsfaktoren
- 3.1.1 Faktorbedingungen
- 3.1.2 Nachfragebedingungen
- 3.1.3 Verwandte und unterstützende Branchen
- 3.1.4 Unternehmensstrategien, Strukturen und Konkurrenz
- 3.2 Zusatzbedingungen
- 3.2.1 Staat
- 3.2.2 Zufall
- 3.3 Cluster
- 3.4 Internationale Wettbewerbsfähigkeit
- 4 Markteintrittsstrategien für Kasachstan
- 4.1 Wahl der Eintrittsform
- 4.1.1 Auslandsniederlassung
- 4.1.2 Tochtergesellschaft
- 4.1.3 Joint Venture
- 4.1.4 Exportgeschäft
- 4.1.5 Lizenzierung und Franchising
- 4.2 Länderspezifisches Timing
- 4.3 Finanzierung
- 4.4 Attraktive Branchen in Kasachstan
- 4.4.1 Bergbau
- 4.4.2 Energie
- 4.4.3 Landwirtschaft
- 4.4.4 Düngemittel
- 4.4.5 Bausektor
- 4.4.6 Tourismus
- 4.4.7 Informationstechnologie
- 4.4.8 Andere Wirtschaftssektoren
- 4.5 Weitere Erfolgsfaktoren des Markteintritts
- 4.6 Analyse der Länderrisiken in Kasachstan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Markteintrittsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen in Kasachstan. Die Arbeit nutzt den Diamantansatz von Porter, um die Wettbewerbsfähigkeit Kasachstans zu analysieren und daraus geeignete Markteintrittsstrategien abzuleiten. Der Fokus liegt auf der Identifizierung attraktiver Branchen und der Bewertung der damit verbundenen Risiken.
- Anwendung des Diamantmodells von Porter auf Kasachstan
- Analyse der Standortfaktoren Kasachstans
- Bewertung der Attraktivität verschiedener Branchen in Kasachstan
- Empfehlung geeigneter Markteintrittsstrategien
- Analyse von Länderrisiken
Zusammenfassung der Kapitel
1 Thematik, Relevanz und Aufbau der Arbeit: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Republik Kasachstan, ihre wirtschaftliche Bedeutung und die Motive für ein Engagement deutscher Unternehmen. Es skizziert die Zielsetzung der Arbeit und erläutert den Aufbau der folgenden Kapitel. Die Darstellung der positiven Standortfaktoren Kasachstans legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Analyse.
2 Diamantansatz der Internationalisierung von Porter: Dieses Kapitel erläutert den Diamantansatz von Porter als theoretisches Gerüst für die Analyse nationaler Wettbewerbsvorteile. Es werden die einzelnen Bestimmungsfaktoren – Faktorbedingungen, Nachfragebedingungen, verwandte und unterstützende Branchen sowie Unternehmensstrategien, Strukturen und Wettbewerb – detailliert beschrieben und deren Bedeutung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit erläutert. Zusätzlich werden die Zusatzbedingungen Staat und Zufall beleuchtet und die Clustertheorie in den Kontext eingeordnet. Die kritische Bewertung des Modells bereitet den Boden für die Anwendung im folgenden Kapitel.
3 Erweiterte Diamantanalyse der Republik Kasachstan: Dieses Kapitel wendet den Diamantansatz auf Kasachstan an. Es analysiert detailliert die einzelnen Bestimmungsfaktoren im Kontext des Landes und bewertet deren Stärken und Schwächen. Die Analyse der Faktorbedingungen, Nachfragebedingungen, verwandter und unterstützender Branchen sowie der Unternehmensstrategien, Strukturen und des Wettbewerbs bildet den Kern dieses Kapitels. Die Betrachtung der staatlichen und zufälligen Rahmenbedingungen vervollständigt das Bild der Wettbewerbsfähigkeit Kasachstans. Die Zusammenfassung der Ergebnisse ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes.
4 Markteintrittsstrategien für Kasachstan: Aufbauend auf der Diamantanalyse werden in diesem Kapitel verschiedene Markteintrittsstrategien für Kasachstan diskutiert, wie Auslandsniederlassungen, Tochtergesellschaften, Joint Ventures, Exportgeschäfte und Lizenzierungen. Das Kapitel untersucht zudem das länderspezifische Timing, die Finanzierung des Markteintritts und analysiert die Attraktivität verschiedener Branchen, unter anderem Bergbau, Energie, Landwirtschaft und Informationstechnologie. Die Betrachtung der Erfolgsfaktoren und der Länderrisiken rundet die Kapitelthematik ab und liefert praktische Handlungsempfehlungen.
Schlüsselwörter
Kasachstan, Diamantanalyse, Porter, Markteintrittsstrategien, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Standortfaktoren, Branchenanalyse, Länderrisiken, Internationalisierung, Wirtschaftswachstum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Markteintrittsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen in Kasachstan
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Markteintrittsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen in Kasachstan. Sie analysiert die Wettbewerbsfähigkeit Kasachstans mithilfe des Diamantansatzes von Porter und leitet daraus geeignete Markteintrittsstrategien ab.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet den Diamantansatz von Porter zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit Kasachstans. Dieser Ansatz berücksichtigt Faktorbedingungen, Nachfragebedingungen, verwandte und unterstützende Branchen sowie Unternehmensstrategien, Strukturen und Wettbewerb. Zusätzlich werden die Zusatzbedingungen Staat und Zufall und die Clustertheorie einbezogen.
Welche Aspekte Kasachstans werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Standortfaktoren Kasachstans, die Attraktivität verschiedener Branchen (Bergbau, Energie, Landwirtschaft, Düngemittel, Bausektor, Tourismus, Informationstechnologie u.a.), die internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes und die damit verbundenen Länderrisiken.
Welche Markteintrittsstrategien werden betrachtet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Markteintrittsstrategien, darunter Auslandsniederlassungen, Tochtergesellschaften, Joint Ventures, Exportgeschäfte und Lizenzierungen. Zusätzlich werden das länderspezifische Timing und die Finanzierung des Markteintritts beleuchtet.
Welche konkreten Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse der Wettbewerbsfähigkeit Kasachstans basierend auf dem Diamantansatz von Porter, identifiziert attraktive Branchen für deutsche Unternehmen und empfiehlt geeignete Markteintrittsstrategien unter Berücksichtigung der jeweiligen Länderrisiken. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte und Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kasachstan, Diamantanalyse, Porter, Markteintrittsstrategien, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Standortfaktoren, Branchenanalyse, Länderrisiken, Internationalisierung, Wirtschaftswachstum.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt Kasachstan, die Motive für ein Engagement und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 erläutert den Diamantansatz von Porter. Kapitel 3 wendet diesen Ansatz auf Kasachstan an. Kapitel 4 diskutiert Markteintrittsstrategien und Länderrisiken.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für deutsche Unternehmen, die einen Markteintritt in Kasachstan planen, sowie für Wissenschaftler und Studierende, die sich mit Internationalisierung, Standortanalysen und Markteintrittsstrategien beschäftigen.
- Quote paper
- Elisabeth Konschu (Author), 2011, Diamantanalyse und internationale Markteintrittsstrategien für die Republik Kasachstan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314947