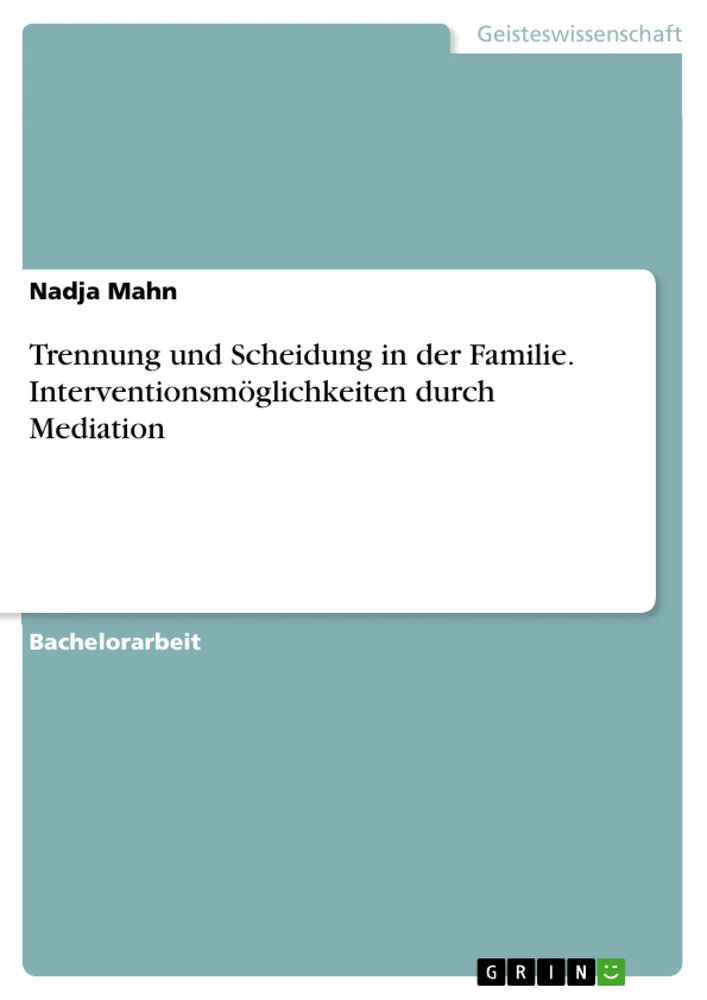Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Familie im Trennungs- und Scheidungsprozess und zeigt auf, welche Konflikte und psychischen Belastungen sowohl auf Eltern- und Paarebene, als auch insbesondere auf der Ebene der Kinder durch Trennung beziehungsweise Scheidung entstehen können. Am Beispiel der Mediation wird eine Möglichkeit der Intervention dargestellt. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Mediation für Familien im Trennungs- und Scheidungsprozess leisten kann und inwiefern diese Interventionsform für die Familie eine Basis schaffen kann, den psychischen Folgen bei Kindern aufgrund von Trennungs- und Scheidungskonflikten entgegenzuwirken oder vorzubeugen.
Trennungen und Scheidung sind inzwischen zur „Normalität“ geworden. Kinder aus geschiedenen Ehen oder Kinder unverheirateter, getrenntlebender Eltern gibt es in jeder Altersstufe, in jeder Klasse und in jedem Bekanntenkreis. Positiv an dieser Entwicklung scheint zumindest, dass die Akzeptanz von Trennung und Scheidung, von Wiederheirat, von Patchworkfamilien und anderen Formen familiären Zusammenlebens gestiegen ist und verfestigte Stigmata allmählich aufweichen.
So thematisieren zum Beispiel kommerzielle Kinofilme die Trennung und Scheidung der Eltern, die dann neue Partnerschaften eingehen und Kinder, die dann „zwei Papas“ haben. Es gibt hier und da Reibungen, doch diese werden überwiegend humoristisch dargestellt und am Ende sind alle glücklich. Die Ex-Partner haben eine freundschaftliche Basis, die neue Freundin von Papa ist Mamas beste Freundin und jeden Sommer fahren alle in den gemeinsamen „Patchwork“-Familienurlaub.
Alltäglichkeit oder „Normalität“ von Trennungen und Scheidungen führen jedoch nicht gleichzeitig zu weniger Schmerz, weniger Konflikten und weniger Belastungen für alle Beteiligten. In der Realität ist oft das Gegenteil der Fall: Jede Scheidung und Trennung führt zu einer Lebenskrise aller Betroffenen und geht mit einem teilweise hohem Konfliktniveau unter den Ex-Partnern einher. Beziehungskonflikte vermischen sich mit Konflikten, die die Scheidungsfolgen und das Re-Organisieren der neuen Familiensituation betreffen. Die Kinder sind hohen psychischen Belastungen und einschneidenden Veränderungen ausgesetzt und brauchen gerade in dieser schwierigen Zeit Eltern, die ihnen Sicherheit geben. Jedoch sind betroffene Eltern häufig nicht in der Lage, in ihrer eigenen Krise des Umbruches, kooperativ und im Sinne der Kinder zusammenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Zentrale Fragestellungen
- 1.2. Methodische Vorgehensweise
- 2. Definition, Statistik und Ursachen für Trennung und Scheidung
- 2.1 Definition Scheidung
- 2.2 Statistiken
- 2.3 Ursachen
- 3. Trennung und Scheidung als Prozess
- 3.1. Phasen von Trennung und Scheidung und entstehende Belastungsfaktoren
- 3.1.1. Ambivalenzphase
- 3.1.2. Trennungs- und Scheidungsphase
- 3.1.3. Nachscheidungsphase
- 3.2. Das Erleben von Trennung und Scheidung aus Perspektive der Kinder
- 3.2.1. Die akuten Reaktionen auf die Trennung und Scheidung
- 3.2.2. Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit dem Entstehen langfristiger psychischer Folgen für das Kind
- 3.2.3. Chancen einer Trennung /Scheidung für Eltern und Kinder
- 3.3. Das Erleben von Trennung und Scheidung auf Paar- und Elternebene
- 3.3.1. Die gescheiterte Paarbeziehung
- 3.3.2. Neugestaltung der Elternrolle
- 3.4. Zwischenbilanz
- 4. Interventionsmöglichkeit am Beispiel der Familienmediation
- 4.1. Definition Mediation
- 4.2. Exkurs Konfliktbegriff
- 4.2.1. Konfliktdefinition nach Glasl
- 4.2.2. Charakteristika familiärer Konflikte
- 4.2.3. Entstehung und (Eigen-)Dynamik des Konfliktes
- 4.3. Prinzipien der Mediation
- 4.4. Geeignetheit und Voraussetzungen der Mediation
- 4.5. Ablauf der Mediation
- 4.6. Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen
- 4.7. Aufgaben und Grundhaltungen des Mediators
- 4.8. Ansätze der Trennungs- und Scheidungsmediation in Deutschland
- 4.9. Chancen der Mediation
- 4.9.1. Auswirkungen der Mediation auf Eltern und Kinder
- 4.9.2. Chancen der Mediation als außergerichtliches Vermittlungsverfahren
- 4.10. Kritische Aspekte der Mediation im Trennungs- und Scheidungsprozess
- 5. Schlussbemerkung und Relevanz für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen von Familien im Trennungs- und Scheidungsprozess und beleuchtet die damit verbundenen Konflikte und psychischen Belastungen für Eltern und Kinder. Im Fokus steht die Mediation als Interventionsmöglichkeit. Die Arbeit will aufzeigen, welchen Beitrag Mediation zur Bewältigung dieser schwierigen Lebenssituation leisten kann und wie sie dazu beitragen kann, psychische Folgen bei Kindern zu reduzieren oder zu vermeiden.
- Trennung und Scheidung als Prozess und dessen Auswirkungen auf Familien
- Psychische Belastungen von Kindern durch elterliche Trennung und Scheidung
- Konfliktdynamiken in Trennungs- und Scheidungsprozessen
- Mediation als Interventionsmethode in Familienkonflikten
- Chancen und Herausforderungen der Mediation im Kontext von Trennung und Scheidung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die wachsende Akzeptanz von Trennung und Scheidung in der Gesellschaft dar, betont aber gleichzeitig die anhaltenden Herausforderungen und Belastungen für alle Beteiligten. Sie hebt die Bedeutung von Unterstützungsangeboten hervor und benennt die Mediation als ein solches Angebot, im Gegensatz zu häufig gewählten gerichtlichen Verfahren. Die zentrale Frage der Arbeit, welchen Beitrag Mediation für Familien im Trennungs- und Scheidungsprozess leisten kann und wie sie psychischen Folgen bei Kindern entgegenwirken kann, wird formuliert.
2. Definition, Statistik und Ursachen für Trennung und Scheidung: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Definition des Begriffs "Scheidung" und präsentiert statistische Daten zur aktuellen Scheidungsrate. Es untersucht anschließend verschiedene Ursachen für den Anstieg der Scheidungsrate. Diese Analyse bildet die Grundlage für das Verständnis der Problematik und der Notwendigkeit von Interventionsmaßnahmen.
3. Trennung und Scheidung als Prozess: Dieses Kapitel beschreibt den Trennungs- und Scheidungsprozess in verschiedenen Phasen (Ambivalenzphase, Trennungs- und Scheidungsphase, Nachscheidungsphase) und analysiert die damit verbundenen Belastungsfaktoren für Eltern und insbesondere Kinder. Es werden die akuten Reaktionen der Kinder sowie langfristige psychische Folgen beleuchtet, unter Berücksichtigung von Risiko- und Schutzfaktoren. Die Perspektive der Erwachsenen (Paar- und Elternebene) wird ebenfalls einbezogen, indem die gescheiterte Paarbeziehung und die Neugestaltung der Elternrolle analysiert werden. Der Fokus liegt auf den umfassenden Auswirkungen des Prozesses auf die gesamte Familie.
4. Interventionsmöglichkeit am Beispiel der Familienmediation: Dieser Abschnitt widmet sich der Mediation als Interventionsmethode. Er definiert den Begriff, beleuchtet den Konfliktbegriff im Kontext familiärer Konflikte, beschreibt die Prinzipien der Mediation, deren Geeignetheit und Voraussetzungen, sowie den Ablauf. Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen wird ebenso behandelt wie die Aufgaben und Grundhaltungen des Mediators. Der Abschnitt analysiert Ansätze der Trennungs- und Scheidungsmediation in Deutschland, ihre Chancen und auch kritische Aspekte. Das Kapitel beleuchtet die Auswirkungen auf Eltern und Kinder und die Vorteile der Mediation als außergerichtliches Verfahren.
Schlüsselwörter
Trennung, Scheidung, Familie, Kinder, psychische Belastung, Konflikt, Mediation, Intervention, Paarbeziehung, Elternrolle, Risiko- und Schutzfaktoren, außergerichtliches Verfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Trennung und Scheidung: Herausforderungen für Familien und die Rolle der Mediation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen von Familien im Trennungs- und Scheidungsprozess. Sie beleuchtet die damit verbundenen Konflikte und psychischen Belastungen für Eltern und Kinder und konzentriert sich insbesondere auf die Mediation als Interventionsmöglichkeit. Der Fokus liegt darauf, den Beitrag der Mediation zur Bewältigung dieser schwierigen Lebenssituation aufzuzeigen und wie sie psychischen Folgen bei Kindern reduzieren oder vermeiden kann.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Trennung und Scheidung als Prozess und dessen Auswirkungen auf Familien; psychische Belastungen von Kindern durch elterliche Trennung und Scheidung; Konfliktdynamiken in Trennungs- und Scheidungsprozessen; Mediation als Interventionsmethode in Familienkonflikten; Chancen und Herausforderungen der Mediation im Kontext von Trennung und Scheidung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die wachsende Akzeptanz von Trennung und Scheidung dar, betont aber die anhaltenden Herausforderungen. Es benennt die Mediation als Unterstützungsangebot und formuliert die zentrale Forschungsfrage.
Kapitel 2 (Definition, Statistik und Ursachen): Definiert Scheidung, präsentiert statistische Daten zur Scheidungsrate und untersucht die Ursachen für den Anstieg.
Kapitel 3 (Trennung und Scheidung als Prozess): Beschreibt den Trennungs- und Scheidungsprozess in Phasen (Ambivalenzphase, Trennungs- und Scheidungsphase, Nachscheidungsphase) und analysiert die Belastungsfaktoren für Eltern und Kinder. Es beleuchtet akute und langfristige psychische Folgen bei Kindern und berücksichtigt die Perspektive der Erwachsenen.
Kapitel 4 (Interventionsmöglichkeit am Beispiel der Familienmediation): Widmet sich der Mediation als Interventionsmethode. Es definiert den Begriff, beleuchtet den Konfliktbegriff, beschreibt die Prinzipien, Voraussetzungen und den Ablauf der Mediation. Es analysiert die Einbeziehung von Kindern, die Aufgaben des Mediators, Ansätze in Deutschland, Chancen und kritische Aspekte der Mediation.
Kapitel 5 (Schlussbemerkung und Relevanz): Zusammenfassung und Schlussfolgerungen, sowie die Relevanz der Ergebnisse für die Soziale Arbeit.
Was wird unter Mediation verstanden und wie funktioniert sie im Kontext von Trennung und Scheidung?
Mediation ist ein außergerichtliches Verfahren, bei dem ein neutraler Mediator die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien (hier: Eltern) unterstützt, um gemeinsam Lösungen zu finden. Im Kontext von Trennung und Scheidung hilft sie, Konflikte zu lösen und Vereinbarungen zum Kindeswohl zu treffen. Der Ablauf umfasst verschiedene Phasen, von der Klärung der Situation bis zur Vereinbarung von Regelungen zu Sorgerecht, Umgang und Unterhalt.
Welche Vorteile bietet die Mediation im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren?
Mediation bietet im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren den Vorteil einer konstruktiven Konfliktlösung, die auf Konsens und Kooperation basiert. Sie ist oft schneller, kostengünstiger und schont die Beziehung zwischen den Eltern, was insbesondere für das Kindeswohl von Vorteil ist. Die Beteiligten haben mehr Einfluss auf die Gestaltung der Lösung.
Welche Risiken und kritischen Aspekte gibt es bei der Mediation?
Die Arbeit beleuchtet auch kritische Aspekte der Mediation, wie z.B. die Frage der Freiwilligkeit und die Möglichkeit, dass Machtverhältnisse nicht ausgeglichen sind. Es wird auf die Notwendigkeit eingegangen, dass die Mediation professionell begleitet und durchgeführt wird, um negative Folgen zu vermeiden.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Trennung, Scheidung, Familie, Kinder, psychische Belastung, Konflikt, Mediation, Intervention, Paarbeziehung, Elternrolle, Risiko- und Schutzfaktoren, außergerichtliches Verfahren.
- Arbeit zitieren
- Nadja Mahn (Autor:in), 2013, Trennung und Scheidung in der Familie. Interventionsmöglichkeiten durch Mediation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315015