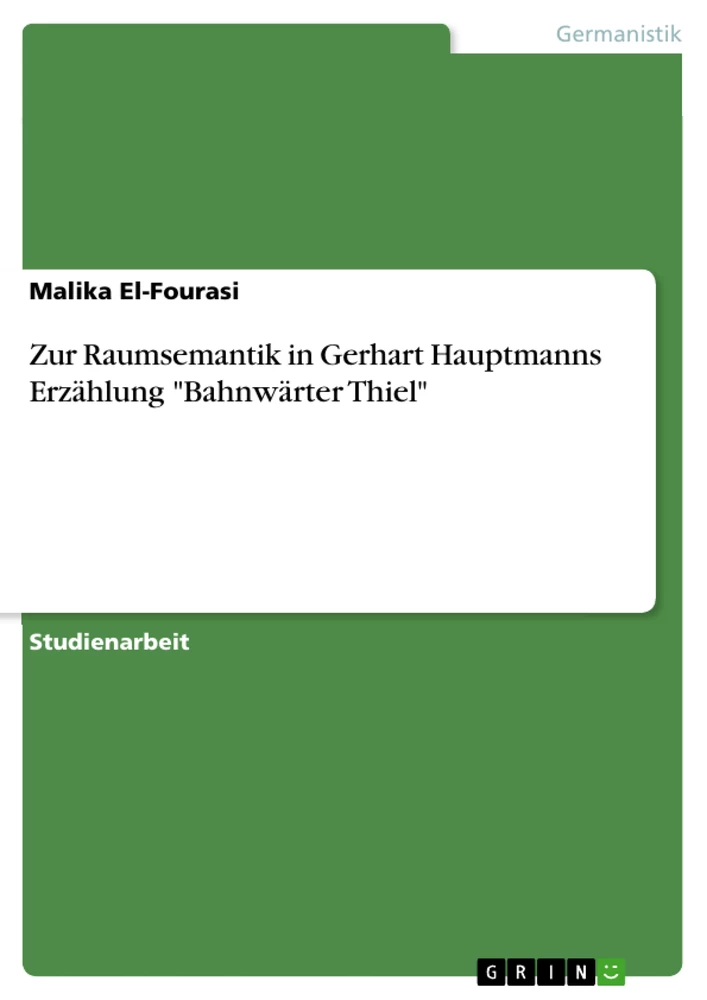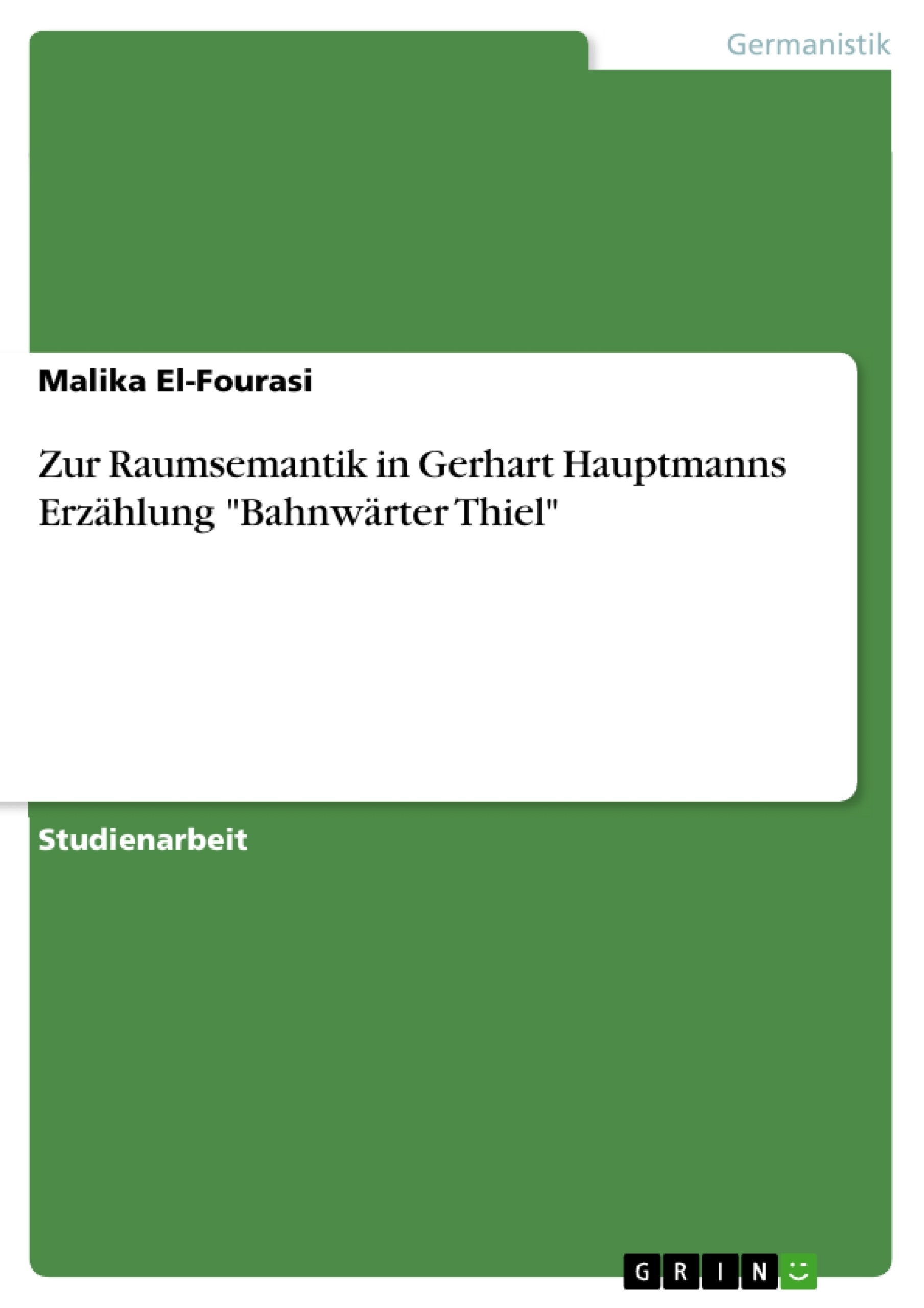In Gerhart Hauptmanns (1862-1946) novellistischer Studie "Bahnwärter Thiel" (1887) wird der Leser mit einer Handlung konfrontiert, die räumlich klar auf zwei komplementäre Bereiche aufgeteilt ist. Zum einem gibt es einen Raum, der, um es mit den Worten von Fritz Martini aus dem Nachwort zu der Novelle auszudrücken, für die „dinglich-sinnliche Außenwelt“ , das häusliche Milieu, steht. Dieser Raum umfasst die Dörfer Neu-Zittau, in dem die Kirche steht, die sonntäglich besucht wird, und das Dorf Schön-Schornstein, in dem der Wärter mit seiner Familie in einer Wohnung lebt.
Zum anderen gibt es in Kontrast dazu einen Raum, der die „psychische Innenwelt“ repräsentiert. Dazu gehören das Wärterhäuschen, das entlang der Bahngleise in einem Waldgebiet liegt, und der angrenzende, noch zu bebauende Acker. Getrennt werden die Bereiche durch einen Fluss, die Spree, die als Grenze dient und täglich auf dem Weg zur Arbeit und bei der Rückkehr überschritten werden muss. Beide Räume sind unterschiedlich dargestellt und semantisch klar definiert. Diese Räume sollen mit ihren verschiedenen Bedeutungen mithilfe des Modells der Raumsemantik nach Jurij M. Lotman beschrieben werden. Dazu werden zunächst für diese Arbeit relevante Aspekte des Modells erläutert, bevor es auf die beiden Räume inklusive der Grenze und die dazugehörigen Charaktere der Novelle angewandt wird.
Hauptsächlich dient Lotmans Modell als Grundlage dieser Arbeit, aber auch wichtige Ergänzungen von Hans Krah (1999), Karl Renner (2004) und Michael Titzmann (2004) sollen hier Erwähnung finden. Die oben genannten Bezeichnungen für die konträren Orte werden von Martini übernommen und als Kapitelüberschriften benutzt. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der in der Erzählung dargestellten Grenzüberschreitung, die in Kapitel 3.2. näher mit ihren Konsequenzen erläutert werden soll. Ziel der Arbeit ist es, aus raumsemantischer Sicht zu begründen, dass der Bahnwärter Thiel seinen Sohn nur wegen der Grenzüberschreitung seiner zweiten Ehefrau Lene verliert, was letztlich zu dem Verbrechen an seiner Frau und dem gemeinsamen Säugling führt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Jurij M. Lotmans Modell der Raumsemantik
- Räume in Gerhart Hauptmanns Bahnwärter Thiel
- Außenwelt vs. Innenwelt
- Grenzüberschreitung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert Gerhart Hauptmanns Novelle „Bahnwärter Thiel“ aus der Perspektive der Raumsemantik nach Jurij M. Lotman. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung der räumlichen Trennung zwischen „Außenwelt“ und „Innenwelt“ sowie der Bedeutung der Grenzüberschreitung für die Handlung der Novelle.
- Die Bedeutung von Raum als semantisch aufgeladenes Element in der Literatur
- Die Analyse der Oppositionen und Gegensätze zwischen den beiden räumlichen Bereichen in der Novelle
- Die Rolle der Grenzüberschreitung als Handlungsmotiv und ihre Auswirkungen auf die Charaktere
- Die Anwendung des Modells der Raumsemantik auf die Figuren und Ereignisse in der Novelle
- Die Interpretation der Grenzüberschreitung als Ursache für die tragischen Ereignisse in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Raumsemantik und den Fokus auf Gerhart Hauptmanns Novelle „Bahnwärter Thiel“ ein. Anschließend wird Jurij M. Lotmans Modell der Raumsemantik in Kapitel 2 vorgestellt und erläutert. In Kapitel 3.1 werden die beiden Räume in der Novelle, „Außenwelt“ und „Innenwelt“, anhand von Lotmans Modell analysiert. Die Auswirkungen der Grenzüberschreitung und ihre Konsequenzen für die Handlung werden in Kapitel 3.2 beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Raumsemantik, Jurij M. Lotman, Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel, Außenwelt, Innenwelt, Grenzüberschreitung, Handlung, Figuren, Ereignisse, Tragödie, Novelle, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Raumsemantik" in der Literaturwissenschaft?
Raumsemantik (nach Jurij M. Lotman) untersucht, wie literarische Räume mit bestimmten Bedeutungen, Werten und Gegensätzen aufgeladen sind.
Wie sind die Räume in "Bahnwärter Thiel" aufgeteilt?
Die Erzählung unterscheidet zwischen der "Außenwelt" (häusliches Milieu, Dorf) und der "psychischen Innenwelt" (Wärterhäuschen im Wald, Bahngleise).
Welche Rolle spielt die Grenze in der Novelle?
Der Fluss Spree fungiert als physische und symbolische Grenze zwischen den zwei Lebensbereichen Thiels, die er täglich überschreiten muss.
Warum ist die Grenzüberschreitung von Lene entscheidend?
Indem Lene in Thiels geschützte "Innenwelt" (den Wald/Acker) eindringt, bricht die Ordnung zusammen, was letztlich zur Katastrophe und zum Verbrechen führt.
Was ist das Hauptaugenmerk der raumsemantischen Analyse?
Ziel ist es zu zeigen, dass die tragischen Ereignisse eine direkte Folge der Verletzung der räumlichen Ordnung durch die Charaktere sind.
- Quote paper
- Malika El-Fourasi (Author), 2015, Zur Raumsemantik in Gerhart Hauptmanns Erzählung "Bahnwärter Thiel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315092