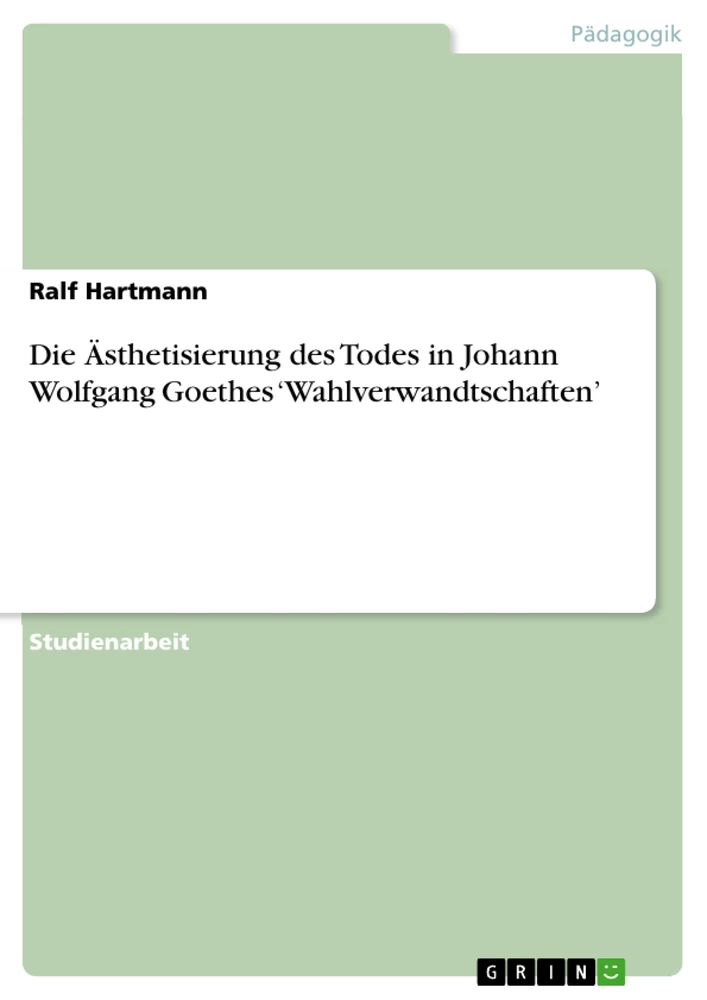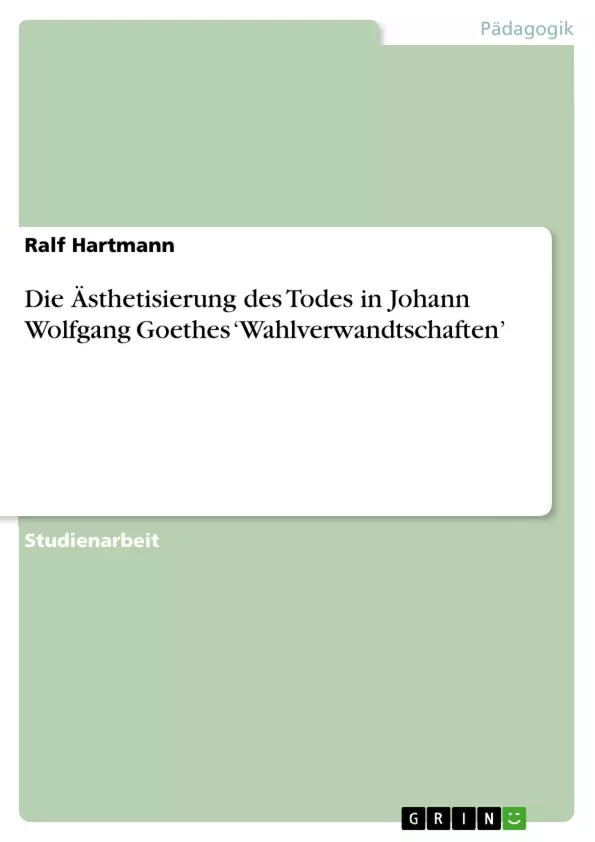Die vorliegende Arbeit versucht, wesentliche Punkte von Goethes Haltung gegenüber Tod und Jenseits herauszustellen. Dazu sollen in einem ersten Teil biographische Hinweise erarbeitet werden, so zum Beispiel, wie sich Goethe beim akuten Sterben von Verwandten und Freunden verhielt und welche anderen literarischen beziehungsweise philosophischen Einflüsse sein Todesbild geprägt haben.
In einem zweiten Schritt soll dann Goethes Todesverständnis mit der Darstellung menschlichen Sterbens in einem seiner späteren Werke, den ‘Wahlverwandtschaften’, verglichen werden. Dieser Roman, bei dem die gesamte Handlung dem Tod Ottilies entgegensteuert, erscheint für eine solche Betrachtung sehr lohnenswert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einführung
- II. Goethe und der Tod
- 1. Der Tod im Leben Goethes
- 1.1. Überwindung des Todes durch das Leben
- 1.2. Der Tod des Großherzogs - Goethes Flucht nach Dornburg
- 2. Der Genius mit der Fackel
- III. Der Tod in den 'Wahlverwandtschaften'
- 1. Der Kirchhof - Charlotte
- 2. Die Kapelle - Der Architekt
- 3. Der schöne Tod – Ottilie
- IV. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit Goethes Haltung gegenüber dem Tod und dem Jenseits, insbesondere im Kontext seiner berühmten Novelle „Wahlverwandtschaften“. Ziel ist es, die Entwicklung seiner Auseinandersetzung mit dem Tod aufzuzeigen, von der frühen Suche nach euphemistischen Bezeichnungen bis hin zur späteren Betonung des Lebens und der Verdrängung des Todes. Die Analyse des Romans soll Goethes ästhetisches und philosophisches Verständnis des Todes im Lichte seiner persönlichen Lebenserfahrungen erhellen.
- Goethes Verhältnis zum Tod in seiner Biographie
- Die ästhetische und philosophische Auseinandersetzung mit dem Tod
- Die Darstellung des Todes in „Wahlverwandtschaften“
- Die Rolle des Todes in Goethes ästhetischer Weltanschauung
- Die Einbettung des Themas Tod in die Kunst und Literatur der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in Goethes problematisches Verhältnis zum Tod ein und beleuchtet seine frühen Versuche, den Tod durch euphemistische Ausdrücke zu verdrängen. Die Arbeit zielt darauf ab, Goethes Entwicklung von der Ästhetisierung des Todes hin zur Betonung des Lebens nachzuzeichnen. Die „Wahlverwandtschaften“ werden als Beispiel für Goethes spätere Haltung zum Tod präsentiert, in der die ästhetische Gestaltung des Todes eine zentrale Rolle spielt.
Das zweite Kapitel widmet sich Goethes Auseinandersetzung mit dem Tod in seiner Biographie. Hier werden Goethes frühe Versuche, den Tod durch euphemistische Ausdrücke zu verdrängen, analysiert. Der Abschnitt beleuchtet auch die Bedeutung des Todes in Goethes Leben, seine Reaktion auf Todesfälle in seiner Familie und in seinem Freundeskreis, sowie seine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Weiterhin werden wichtige Einflüsse auf Goethes Todesbild, wie zum Beispiel die ästhetischen Arbeiten Lessings, vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Goethe, Tod, Ästhetisierung, Lebensfreude, Jenseits, “Wahlverwandtschaften”, Tod in der Literatur, Euphemismen, Tod als Thema in Kunst und Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Wie stand Goethe persönlich zum Tod?
Goethe hatte ein problematisches Verhältnis zum Tod; er neigte dazu, ihn durch Euphemismen zu verdrängen und flüchtete oft vor der Konfrontation mit dem Sterben.
Was bedeutet „Ästhetisierung des Todes“ bei Goethe?
Es beschreibt die literarische Gestaltung des Sterbens als schönen, fast künstlerischen Akt, um dem Grauen des Todes entgegenzuwirken.
Welche Rolle spielt Ottilie in den „Wahlverwandtschaften“?
Ottilies gesamtes Schicksal steuert auf einen „schönen Tod“ zu, der als ästhetischer Höhepunkt des Romans inszeniert wird.
Wie reagierte Goethe auf den Tod von Freunden?
Oft mied er Begräbnisse und suchte Trost in der Arbeit oder in der Natur, um die eigene Lebenskraft zu bewahren.
Welchen Einfluss hatte Lessing auf Goethes Todesbild?
Lessings ästhetische Schriften über die Darstellung des Todes in der Antike prägten Goethes Sichtweise auf das Sterben in der Kunst.
- Quote paper
- Ralf Hartmann (Author), 1997, Die Ästhetisierung des Todes in Johann Wolfgang Goethes ‘Wahlverwandtschaften’, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315098