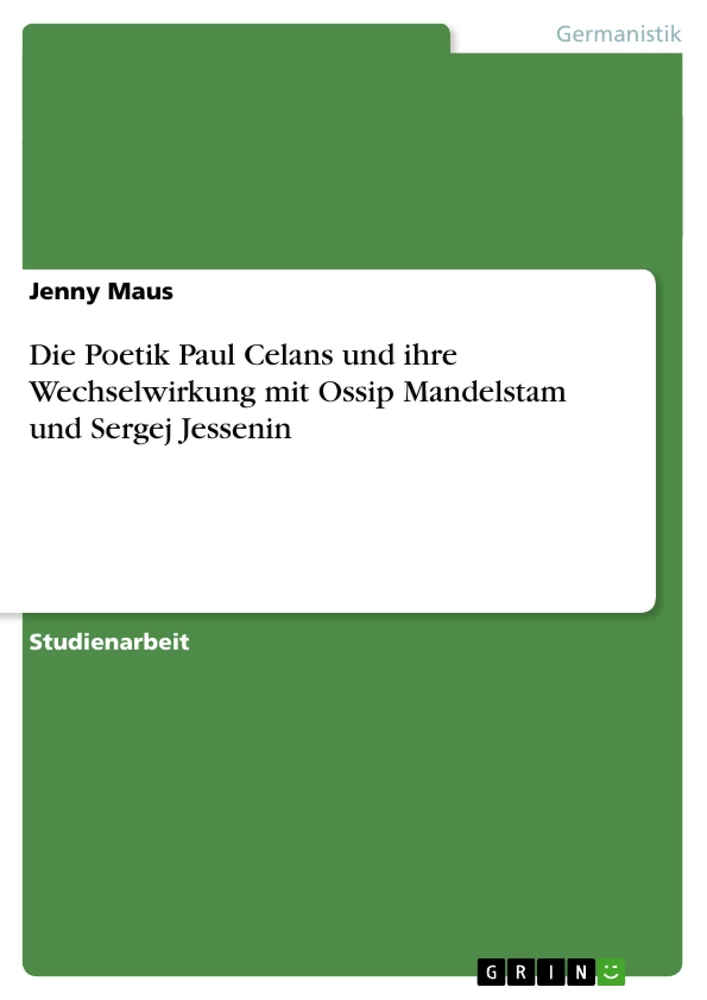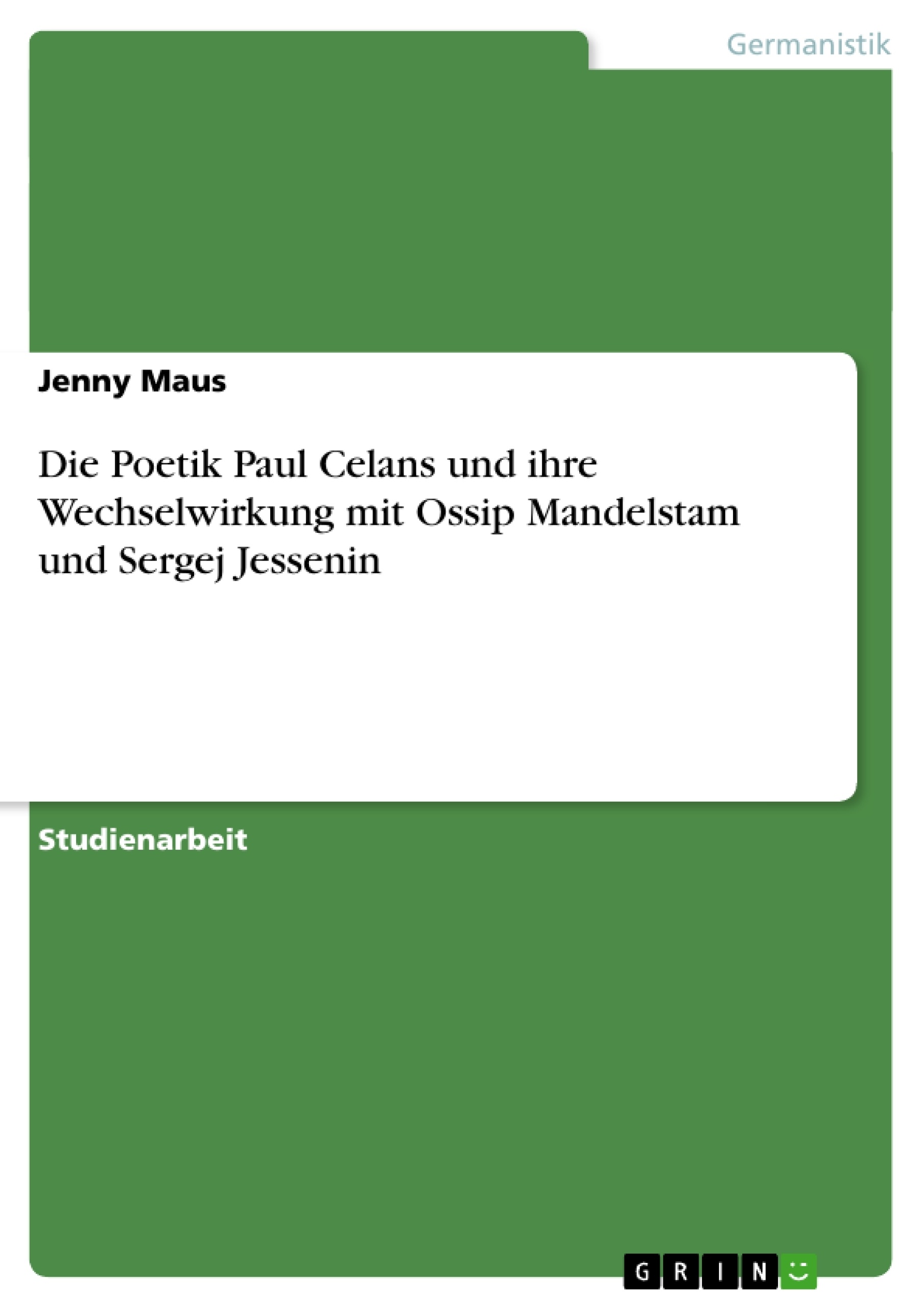Im Jahr 1957 begann Celan sich wieder intensiv mit russischen Autoren auseinander zu setzen. Er hatte bereits in seiner Jugendzeit Sergej Jessenin und andere gelesen. Während seiner Zeit in Bukarest übersetzte er für den Verlag „das russische Buch“ systemkonforme Autoren vom russischen ins rumänische. Nachdem er Bukarest verlassen hatte, befand er russische Autoren für nicht mehr wert sich mit ihnen auseinander zu setzen. In seiner Anfangszeit in Paris kämpfte er mit einer tiefen Identitätskrise. Er versuchte u.a. sein Judentum zu verleugnen, wie James K. Lyon in seinem Aufsatz „Judentum, Antisemitismus, Verfolgungswahn: Celans „Krise“ 1960-1932“ darstellt. Auf den Höhepunkt dieser Krise ab 1957 beginnt Celan sich wieder mit russischen Autoren zu beschäftigen, wieder beginnt er mit Sergej Jessenin. Neben Jessenin standen Alexander Block und Ossip Mandelstamm im Mittelpunkt von Celans Interesse. Die Gedichtübertragungen dieser Autoren erscheinen 1958 „Die Zwölf“ von Block, 1959 „Gedichte“ von Mandelstamm und 1961 die „Gedichte“ von Jessenin.
Ossip Mandelstamm wurde zu Celans großem Idol. Alexej Struve, ein Buchhändler aus Paris schrieb in einem Brief an seinen Bruder, den Slawisten Gleb Struve: „Then he ‚fell in love’ with Mandelstam...“ Für Celan war Mandelstamm nicht nur aufgrund seiner Lyrik bedeutend. Celan war sowohl von der Person Mandelstamm und von seinem Schicksal als verfolgter jüdischer Dichter fasziniert, als auch von seinen poetologischen Essays. Eben jene Essays sind auch in die Poetik Paul Celans mit eingeflossen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Einleitung
- Hauptteil
- Gespräch im Gebirg
- Der Meridian
- Die Bremer Rede
- Über die Dichtung Ossip Mandelstamms
- Jessenin Übertragungen
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Poetik Paul Celans zu untersuchen und den Einfluss von Ossip Mandelstamm auf Celans Dichtung aufzuzeigen. Zudem soll die Wechselwirkung zwischen Celans poetologischem Denken und seiner Übersetzerarbeit beleuchtet werden.
- Celans Auseinandersetzung mit russischen Autoren, insbesondere mit Mandelstamm und Jessenin
- Die Rolle von Dialog und Gespräch in Celans Poetik
- Das Motiv der Bewegung und des Unterwegsseins in Celans Werken
- Die Frage der (jüdischen) Identität in Celans Werk
- Die Beziehung zwischen Celans Lyrik und seinen poetologischen Essays
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Im Jahr 1957 begann Celan sich intensiv mit russischen Autoren wie Sergej Jessenin, Alexander Blok und Ossip Mandelstamm auseinanderzusetzen. Diese Beschäftigung mündete in die Übersetzung von Werken dieser Autoren. Mandelstamm wurde zu einem großen Idol für Celan, sowohl aufgrund seiner Lyrik als auch seiner Person und seines Schicksals als verfolgter jüdischer Dichter. Celans eigene poetologische Texte wie "Gespräch im Gebirg", "Der Meridian" und die Bremer Rede entstanden parallel zu seiner Beschäftigung mit den russischen Autoren.
Gespräch im Gebirg
Der Prosatext "Gespräch im Gebirg" ist Celans einziger erzählerischer Text und spielt im August 1959, während Celans intensiver Beschäftigung mit russischen Autoren. Der Titel verweist auf den Dialog als zentrales Element in Celans Poetik. Der Text thematisiert die Bewegung, das Unterwegssein und die Frage der (jüdischen) Identität. Ein Bezug zu Büchners Lenz-Fragment wird deutlich.
Der Meridian
Die Rede "Der Meridian" thematisiert die Bedeutung von Gedicht und Bewegung. Der Text stellt eine Parallele zwischen Celans eigener Suche und der eines "Juden", der durchs Gebirge geht, her. Die Frage nach der Identität und die Suche nach Sprache stehen im Zentrum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Poetik Paul Celans, insbesondere im Kontext seiner Beschäftigung mit russischen Autoren wie Ossip Mandelstamm und Sergej Jessenin. Die zentralen Themen sind Dialog, Bewegung, Identität, poetologische Essays und die Wechselwirkung zwischen Übersetzen und originärem Werk.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Ossip Mandelstamm auf Paul Celan?
Mandelstamm war Celans großes Idol. Celan war fasziniert von seiner Lyrik, seinem Schicksal als verfolgter jüdischer Dichter und seinen poetologischen Essays, die stark in Celans eigenes Denken einflossen.
Was thematisiert Celans Text „Gespräch im Gebirg“?
Dieser einzige erzählerische Prosatext Celans behandelt den Dialog, das Unterwegssein und die Suche nach der (jüdischen) Identität, mit Bezügen zu Büchners Lenz-Fragment.
Worum geht es in Celans Rede „Der Meridian“?
In dieser bedeutenden Rede thematisiert Celan das Gedicht als Ort der Begegnung und Bewegung sowie die existenzielle Suche nach einer Sprache der Identität.
Warum beschäftigte sich Celan ab 1957 wieder intensiv mit russischen Autoren?
Nach einer tiefen Identitätskrise in Paris suchte Celan durch die Übersetzung und Auseinandersetzung mit Autoren wie Jessenin, Blok und Mandelstamm nach neuen poetischen Anknüpfungspunkten.
Welche Rolle spielt das Übersetzen in Celans Werk?
Das Übersetzen war für Celan kein bloßes Handwerk, sondern eine intensive Wechselwirkung mit seinem eigenen Schaffen, die ihm half, seine poetologische Position zu festigen.
- Quote paper
- Jenny Maus (Author), 2004, Die Poetik Paul Celans und ihre Wechselwirkung mit Ossip Mandelstam und Sergej Jessenin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31511