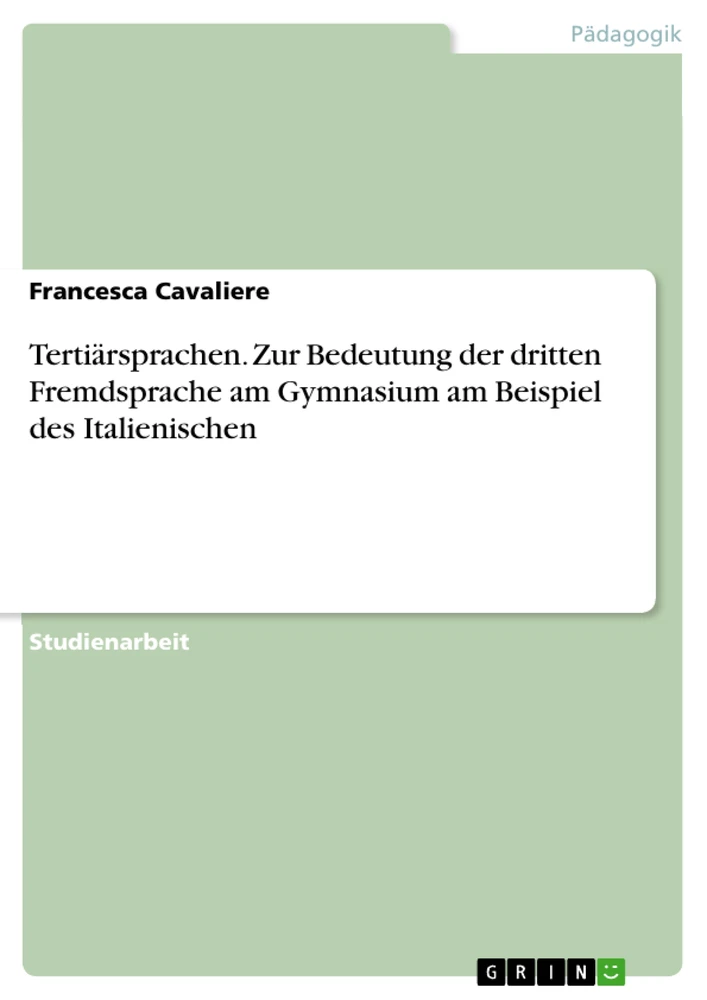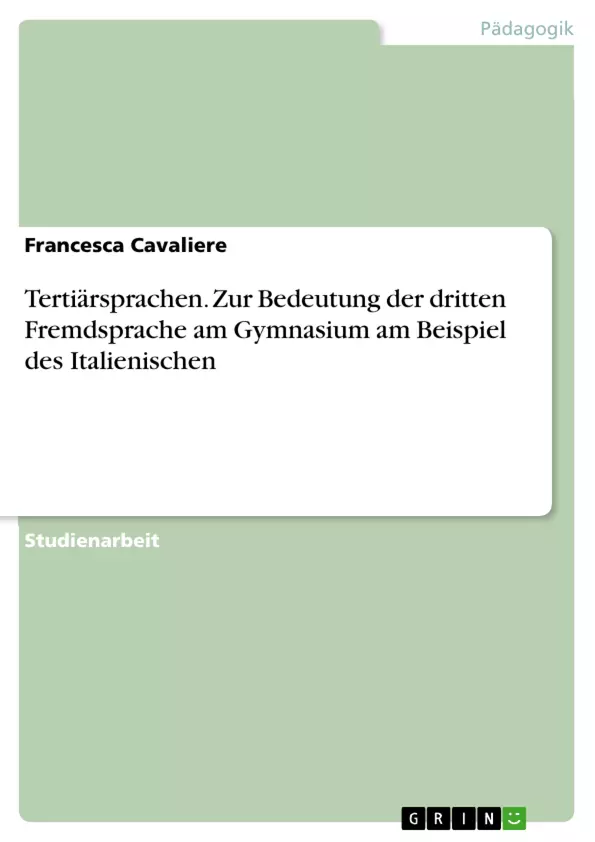Das Fremdsprachenlernen gilt heute als wesentlicher Bestandteil der europäischen Bildungspolitik. Im Aktionsplan 2004-2006 wurden explizit die Leitlinien für das lebenslange Sprachenlernen und den Erhalt der Sprachenvielfalt formuliert. Jeder europäische Bürger soll demnach neben seiner Muttersprache zwei weitere Gemeinschaftssprachen beherrschen. Im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen wird dabei vor allem die Gleichwertigkeit aller europäischen Sprachen betont, denn das ausdrückliche Ziel ist es:
"durch vermehrte Kenntnis nationaler und regionaler Sprachen - auch solcher, die nicht so häufig gelehrt werden - den Reichtum und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Europa zu erhalten und weiterzuentwickeln".
Diese Position des Referenzrahmens macht deutlich, dass der moderner Fremdsprachenunterricht die mehrsprachige Kompetenz der Schüler entwickeln, d.h. Möglichkeiten zum sprachübergreifenden, vernetzenden Lernen schaffen muss. Dies gilt in besonderem Maße für den in der gymnasialen Oberstufe spät einsetzenden FU in den so genannten Tertiärsprachen. Das große Potenzial dieses Unterrichts liegt in der Anknüpfung an die Sprach(lern)erfahrungen der Schüler/innen, die Einbeziehung des positiven wie negativen Sprachtransfers als auch die Behandlung sprachübergreifender Lerntechniken und -strategien. Ziel der folgenden Arbeit ist es deshalb aufzuzeigen, wie das vernetzte und sprachübergreifende Lernen für den in der gymnasialen Oberstufe beginnenden Italienischunterricht nutzbar gemacht werden kann. Den Schlüssel hierfür liefert die Interkomprehensions- und Mehrsprachigkeitsdidaktik.
Im ersten Kapitel soll zunächst definiert werden, was in der Fremdsprachendidaktik unter dem Begriff Tertiärsprachen zu verstehen ist. Aufbauend dazu soll am Beispiel des Fachs Italienisch deutlich gemacht werden, welche Stellung die Tertiärsprachen derzeit innerhalb der Schulsprachenpolitik einnehmen. Im zweiten Kapitel werden schließlich die Charakteristika des schulischen Tertiärsprachenunterrichts näher beleuchtet. Besondere Berücksichtigung finden hierbei das fortgeschrittene Alter der Lernenden, ihre besonderen motivationalen Voraussetzungen sowie ihre heterogenen Vorkenntnisse. Im letzten Kapitel soll das Konzept der EuroComRom-Methode zunächst vorgestellt und weiterführend an einem konkreten Beispieltext aufgezeigt werden, wie die Förderung der rezeptiven Fähigkeiten im schulischen Tertiärsprachenunterricht genutzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Präliminarien: Die normative Gleichwertigkeit aller Sprachen
- 2 Bedeutung der Tertiärsprachen
- 2.1 Definition: Tertiärsprachen
- 2.2 Der Status des Italienischen als Tertiärsprache im Schulsystem
- 3 Spezifika des Italienischunterrichts als 3. Fremdsprache
- 3.1 Alter der Schüler
- 3.2 Einstellung und Erwartungshaltung
- 3.3 Heterogene Vorkenntnisse der Lerner
- 4 Förderung von funktionaler Mehrsprachigkeit im FSU
- 4.1 Die Methode EuroComRom
- 4.2 Ideen zur Implementation von EuroComRom im schulischen Kontext
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bedeutung der dritten Fremdsprache im Gymnasium, insbesondere am Beispiel des Italienischen. Sie beleuchtet die didaktischen Spezifika dieser Sprache im schulischen Kontext und untersucht, wie die Förderung von funktionaler Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht (FSU) gelingen kann.
- Die normative Gleichwertigkeit aller Sprachen im europäischen Bildungssystem
- Die Definition und Bedeutung von Tertiärsprachen, insbesondere des Italienischen
- Spezifische Herausforderungen im Italienischunterricht als dritte Fremdsprache
- Die Förderung von funktionaler Mehrsprachigkeit durch die Methode EuroComRom
- Die Integration von EuroComRom-Prinzipien in den schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die normative Gleichwertigkeit aller Sprachen im europäischen Bildungssystem und stellt den Fokus auf die Bedeutung der Tertiärsprachen. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Tertiärsprache definiert und der Status des Italienischen als Tertiärsprache im schulischen System beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich den didaktischen Spezifika des Italienischunterrichts, wobei das Alter der Schüler, ihre Einstellung, Erwartungen und heterogenen Vorkenntnisse im Vordergrund stehen. Schließlich wird im vierten Kapitel die EuroComRom-Methode vorgestellt und ihr Potenzial für die Förderung der rezeptiven Fähigkeiten im Tertiärsprachenunterricht diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Tertiärsprachen, Italienischunterricht, didaktische Spezifika, Fremdsprachenlernen, Mehrsprachigkeit, EuroComRom-Methode, rezeptive Fähigkeiten und funktionaler Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Tertiärsprache?
Eine Tertiärsprache ist die dritte Fremdsprache, die ein Schüler lernt, meist beginnend in der gymnasialen Oberstufe nach Englisch und einer zweiten Fremdsprache.
Warum ist Italienisch ein klassisches Beispiel für eine Tertiärsprache?
Italienisch wird oft als spät einsetzende Fremdsprache gewählt, da Schüler von ihren Vorkenntnissen aus dem Lateinischen oder Französischen profitieren können.
Was ist die EuroComRom-Methode?
Es ist ein didaktisches Konzept zur Förderung der Interkomprehension zwischen romanischen Sprachen, das Schülern hilft, Texte in einer neuen Sprache schneller zu verstehen.
Welche Vorteile haben ältere Schüler beim Lernen einer dritten Fremdsprache?
Sie verfügen über ausgereiftere Lernstrategien, eine höhere Motivation und können sprachübergreifende Vernetzungen (Transfer) effektiver nutzen.
Was bedeutet „mehrsprachige Kompetenz“ im Bildungskontext?
Das Ziel ist nicht nur die perfekte Beherrschung einer Einzelsprache, sondern die Fähigkeit, verschiedene Sprachen vernetzt zu nutzen und zu verstehen.
- Quote paper
- Francesca Cavaliere (Author), 2014, Tertiärsprachen. Zur Bedeutung der dritten Fremdsprache am Gymnasium am Beispiel des Italienischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315223