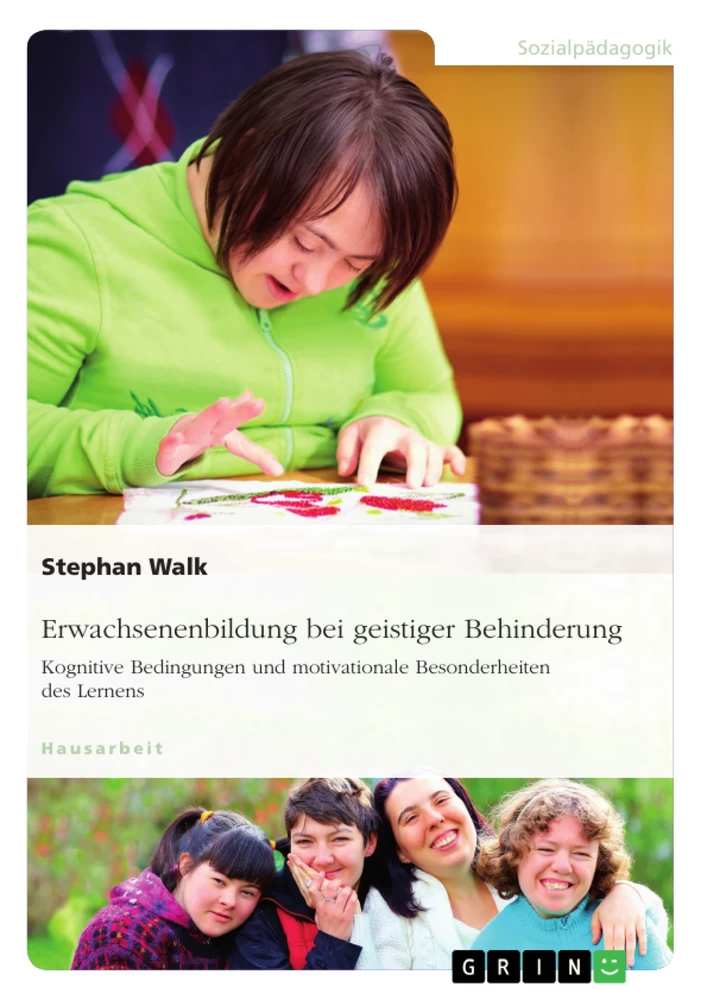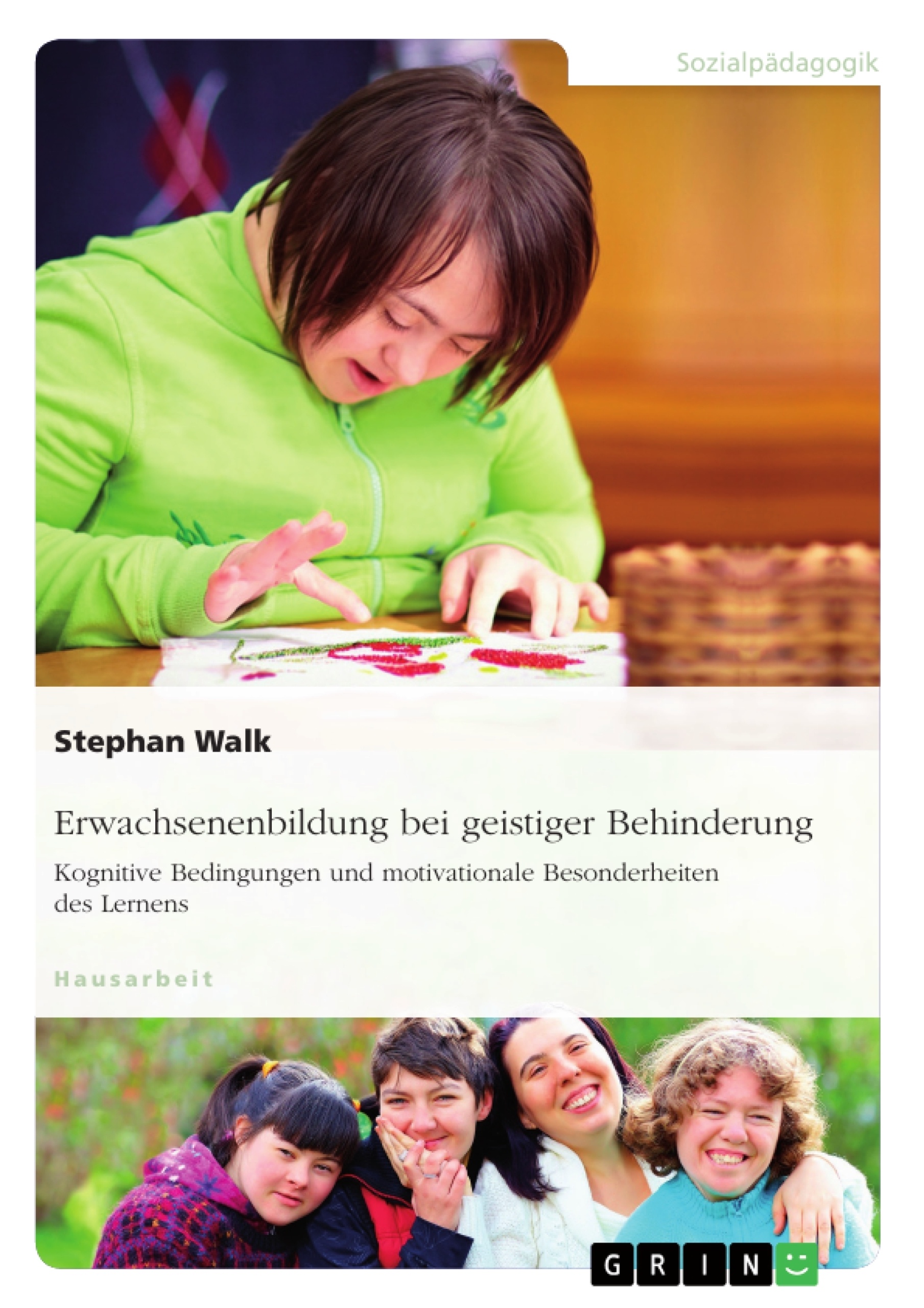In dieser Hausarbeit geht es thematisch zunächst darum, welche motivationalen und erkenntnismäßigen Bedingungen des Lernens bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung im Erwachsenenalter vorliegen. Es macht daher Sinn, den Versuch zu unternehmen, die Beeinträchtigung im Rahmen einer begrifflichen Diskussion zu definieren, um in der Folge auf die Besonderheiten der kognitiven Prozesse und motivationale Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung einzugehen.
Des Weiteren wird mit Hilfe der daraus gewonnen Erkenntnisse, darauf eingegangen, wie eine Bildungsmaßnahme der Erwachsenenbildung beschaffen sein muss, welche Ziele sie unter welchen Rahmenbedingungen zu erfüllen hat, wenn sie aus pädagogischer Sicht als erfolgreich bezeichnet werden soll. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass nur neutrale oder männliche Formen des Sprachgebrauchs Eingang in diese Ausarbeitung finden, was sich in der einfacheren Lesbarkeit der Ausführungen begründet und nichts mit einer diskriminierenden Haltung des Verfassers, gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu tun hat. Der Begriff der geistigen Behinderung wird synonym mit dem Begriff der kognitiven Beeinträchtigung verwendet, um im Verlauf meiner Ausführungen sprachlicher Monotonie vorzubeugen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Einleitung
- 2.0. Das Problem einer Begriffsbestimmung der geistigen Behinderung
- 2.1. Begriffsdiskussion rund um einen problematischen Terminus
- 3.0. Intellektuelle Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 3.1. Die Komponenten mentaler Verarbeitungsprozesse im Einzelnen
- 3.2. Motivationale Besonderheiten bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
- 4.0. Ziele und Rahmenbedingungen von Erwachsenenbildung bei Menschen mit geistiger Behinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die motivationalen und kognitiven Bedingungen des Lernens bei erwachsenen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von geistiger Behinderung, analysiert die Besonderheiten kognitiver Prozesse und motivationaler Aspekte bei Betroffenen und schließlich die Gestaltung erfolgreicher Erwachsenenbildungsmaßnahmen für diese Personengruppe.
- Begriffsbestimmung und Problematik der Definition geistiger Behinderung
- Kognitive Prozesse und ihre Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Motivationale Aspekte des Lernens bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
- Ziele und Rahmenbedingungen erfolgreicher Erwachsenenbildung
- Der Einfluss sozialer Faktoren auf die Definition und den Umgang mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1.0. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf motivationale und kognitive Lernbedingungen bei erwachsenen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie kündigt die begriffliche Diskussion um geistige Behinderung, die Analyse kognitiver Prozesse und motivationaler Besonderheiten sowie die Betrachtung der Gestaltung erfolgreicher Erwachsenenbildung an. Die Verwendung neutraler Sprachformen wird begründet. Der Begriff „geistige Behinderung“ wird synonym mit „kognitive Beeinträchtigung“ verwendet.
2.0. Das Problem einer Begriffsbestimmung der geistigen Behinderung: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Definition von geistiger Behinderung. Es betont die Notwendigkeit, subjektive Kategorisierungen zu überwinden und die Andersartigkeit der Betroffenen anzuerkennen. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit einer objektiven Klassifikation für sozialrechtliche Hilfestellungen hervorgehoben. Verschiedene Klassifizierungsversuche werden erwähnt, wobei betont wird, dass diese das Wesen des Menschen niemals vollständig erfassen können und die Gefahr besteht, der Persönlichkeit nicht gerecht zu werden. Die eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten der Betroffenen werden als Grund für alternative Kommunikationsformen und speziell geschultes Personal genannt, um Teilhabe an Bildungsprozessen zu ermöglichen.
2.1. Begriffsdiskussion rund um einen problematischen Terminus: Dieser Abschnitt vertieft die Problematik der Begriffsbestimmung von geistiger Behinderung. Er beleuchtet die abwertende historische Verwendung des Begriffs und die problematischen Ansätze des 19. und 20. Jahrhunderts, wie die Einstufung als „lebensunwertes Leben“. Die Entwicklung der Begrifflichkeit von „Schwachsinn“ zur „geistigen Behinderung“ wird nachgezeichnet, ebenso die Rolle von Intelligenztests und der IQ-Wert bei der Diagnose. Kritische Punkte bezüglich der alleinigen Verwendung von IQ-Werten werden angesprochen und alternative, umfassendere Definitionen, wie die der AAMR, werden vorgestellt, die auch adaptive Fähigkeiten berücksichtigen. Der Einfluss sozialer Faktoren auf die Definition und die Bedeutung von Inklusion werden hervorgehoben. Die verschiedenen Klassifizierungen (F70-F73) nach ICD-10 werden erläutert.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, kognitive Beeinträchtigung, Begriffsbestimmung, Intelligenzminderung, IQ, adaptive Fähigkeiten, Inklusion, Erwachsenenbildung, Motivation, kognitive Prozesse, WHO-Klassifikation, ICD-10, AAMR-Definition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Motivationale und Kognitive Lernbedingungen bei Erwachsenen mit Kognitiver Beeinträchtigung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die motivationalen und kognitiven Bedingungen des Lernens bei erwachsenen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von geistiger Behinderung, analysiert die Besonderheiten kognitiver Prozesse und motivationaler Aspekte bei Betroffenen und schließlich die Gestaltung erfolgreicher Erwachsenenbildungsmaßnahmen für diese Personengruppe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Begriffsbestimmung und Problematik der Definition geistiger Behinderung, die Analyse kognitiver Prozesse und ihrer Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung, motivationale Aspekte des Lernens bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die Ziele und Rahmenbedingungen erfolgreicher Erwachsenenbildung und den Einfluss sozialer Faktoren auf die Definition und den Umgang mit geistiger Behinderung.
Wie wird der Begriff „geistige Behinderung“ in der Arbeit verwendet?
Der Begriff „geistige Behinderung“ wird synonym mit „kognitive Beeinträchtigung“ verwendet. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, subjektive Kategorisierungen zu überwinden und die Andersartigkeit der Betroffenen anzuerkennen, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer objektiven Klassifikation für sozialrechtliche Hilfestellungen hervorgehoben wird.
Welche Schwierigkeiten bei der Definition von geistiger Behinderung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen bei der Definition von geistiger Behinderung, die abwertende historische Verwendung des Begriffs und die problematischen Ansätze des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Entwicklung der Begrifflichkeit von „Schwachsinn“ zur „geistigen Behinderung“, die Rolle von Intelligenztests und den IQ-Wert bei der Diagnose und kritische Punkte bezüglich der alleinigen Verwendung von IQ-Werten. Alternative, umfassendere Definitionen, wie die der AAMR, die auch adaptive Fähigkeiten berücksichtigen, werden vorgestellt.
Welche Klassifizierungssysteme werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt verschiedene Klassifizierungsversuche, betont aber, dass diese das Wesen des Menschen niemals vollständig erfassen können. Die verschiedenen Klassifizierungen (F70-F73) nach ICD-10 werden erläutert. Der Einfluss sozialer Faktoren auf die Definition und die Bedeutung von Inklusion werden hervorgehoben.
Welche Aspekte kognitiver Prozesse und Motivation werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Besonderheiten kognitiver Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung und deren Komponenten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf motivationalen Besonderheiten beim Lernen dieser Personengruppe.
Welche Ziele und Rahmenbedingungen erfolgreicher Erwachsenenbildung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Ziele und Rahmenbedingungen von Erwachsenenbildung bei Menschen mit geistiger Behinderung, unter Berücksichtigung der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten und der Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und speziell geschultem Personal, um Teilhabe an Bildungsprozessen zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, kognitive Beeinträchtigung, Begriffsbestimmung, Intelligenzminderung, IQ, adaptive Fähigkeiten, Inklusion, Erwachsenenbildung, Motivation, kognitive Prozesse, WHO-Klassifikation, ICD-10, AAMR-Definition.
- Quote paper
- Stephan Walk (Author), 2015, Erwachsenenbildung bei geistiger Behinderung. Kognitive Bedingungen und motivationale Besonderheiten des Lernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315244