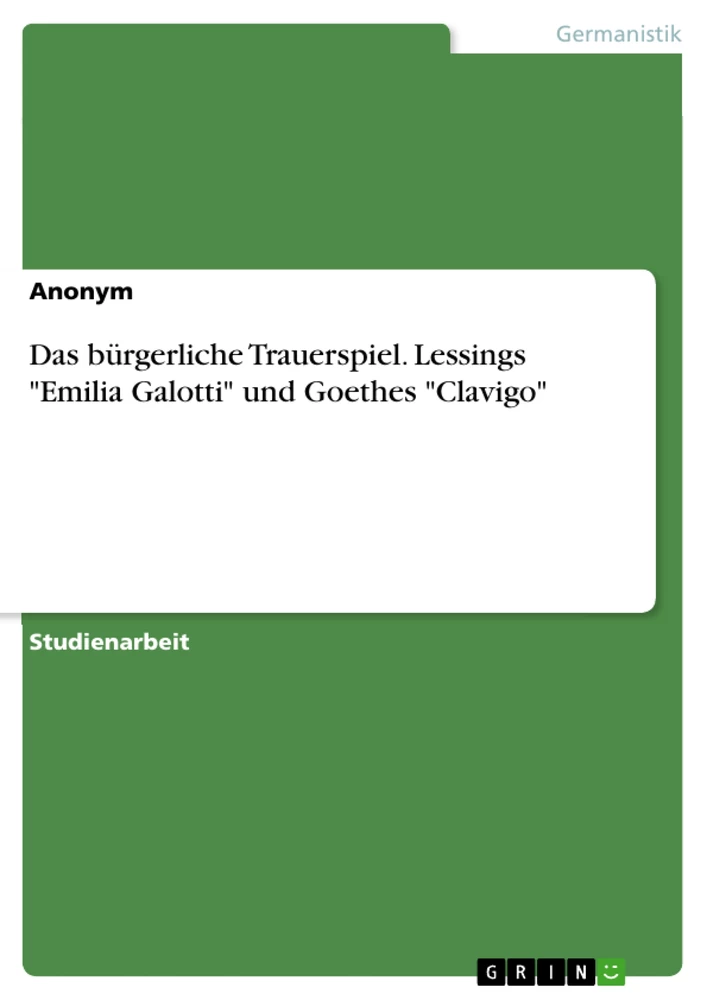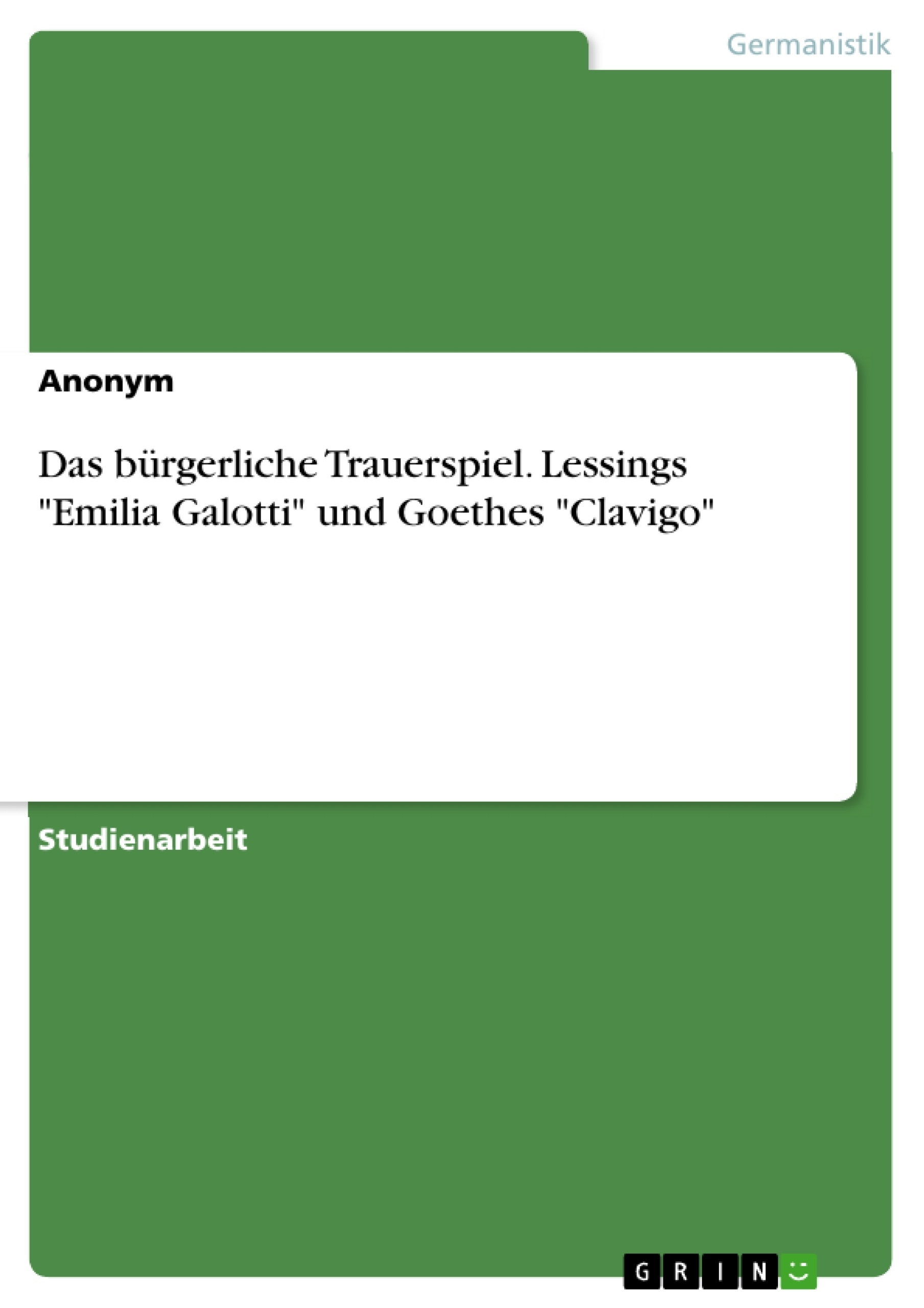Lessings "Emilia Galotti" gilt als der Prototyp des bürgerlichen Trauerspiels. Inwieweit jedoch ist es möglich, das Schema des Trauerspiels auch auf Goethes "Clavigo" anzuwenden?
Dazu soll zunächst erläutert werden, was unter einem bürgerlichen Trauerspiel zu verstehen ist und welche Entwicklungen es vollzogen hat. Anschließend soll das Drama "Emilia Galotti" in seiner Qualität als bürgerliches Trauerspiel untersucht werden, um abschließend die eingangs gestellte Frage zu beantworten.
Der Name des bürgerlichen Trauerspiels ist Programm: ‚bürgerlich‘ sind die Protagonisten und die Probleme, die in tragischer Form dargestellt werden. Bislang war die Tragödie für den Adel reserviert, für die Darstellung der Bürger war die Komödie vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem aufstrebenden Bürgertum im 18. Jahrhundert sollte sich dies nun ändern. In dieser ersten Phase war das bürgerliche Trauerspiel geprägt von der moralischen Selbstvergewisserung des Bürgertums, von bürgerlichen Tugendproklamationen und der Darstellung adliger Willkür. Die zweite Phase wandte sich mehr den Konflikten innerhalb des Bürgertums selbst zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels
- 2.1. Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels
- 2.2 Die Dramentheorie Lessings
- 2.3. Definition des Begriffs „Bürgerlich“
- 2.4 Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels
- 3. Lessings Emilia Galotti
- 3.1. Der Ständekonflikt: „Bürgerlich versus Adlig“
- 3.2. Der Ständekonflikt anhand der Figurenkonstellation
- 3.2. Der Ständekonflikt anhand der Handlungsorte
- 4. Goethes Clavigo
- 4.1. Die Figurenkonstellationen im Vergleich zu Emilia Galotti
- 4.2. Clavigo und dessen innerer Konflikt
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lessings Emilia Galotti und Goethes Clavigo im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels. Ziel ist es, die Anwendbarkeit des Schemas des bürgerlichen Trauerspiels auf beide Dramen zu erörtern und die Frage zu beantworten, inwieweit Clavigo den Kriterien dieses Genres entspricht. Hierzu wird zunächst die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels beleuchtet, bevor Emilia Galotti als Prototyp analysiert wird.
- Entstehung und Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels
- Lessings Dramentheorie und ihre Auswirkungen auf das Genre
- Definition und Charakteristika des „Bürgerlichen“ im Kontext des Trauerspiels
- Der Ständekonflikt in Emilia Galotti und Clavigo
- Vergleich der Figurenkonstellationen und Konflikte in beiden Dramen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit des Schemas des bürgerlichen Trauerspiels auf Goethes Clavigo im Vergleich zu Lessings Emilia Galotti. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Erörterung der Theorie des bürgerlichen Trauerspiels, die Analyse von Emilia Galotti und die abschließende Beantwortung der Forschungsfrage umfasst.
2. Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels. Es beleuchtet die Entstehung des Genres im Kontext des aufstrebenden Bürgertums des 18. Jahrhunderts, das sich nun auch in der Tragödie repräsentiert sehen wollte. Die Entwicklung des Genres wird in verschiedene Phasen unterteilt, die sich durch unterschiedliche Schwerpunkte (moralische Selbstvergewisserung, Konflikte innerhalb des Bürgertums) auszeichnen. Der Einfluss ausländischer Autoren wie Diderot und Lillo wird ebenso thematisiert wie die Rolle Lessings als Gründungsvater einer neuen Theaterkultur.
3. Lessings Emilia Galotti: Dieses Kapitel analysiert Lessings Emilia Galotti als paradigmatisches Beispiel des bürgerlichen Trauerspiels. Die Analyse konzentriert sich auf den Ständekonflikt zwischen Bürgertum und Adel, der sowohl auf der Ebene der Figurenkonstellation als auch der Handlungsorte untersucht wird. Es wird gezeigt, wie Lessing die Konventionen des Trauerspiels adaptiert und die moralischen und gesellschaftlichen Fragen des Bürgertums thematisiert. Die Analyse beleuchtet die tragischen Konsequenzen des Konflikts und die moralischen Dilemmata der Figuren.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Lessing, Goethe, Emilia Galotti, Clavigo, Ständekonflikt, Dramentheorie, bürgerliche Moral, Figurenkonstellation, Mitleid, Rührung, Identifikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse von Lessings *Emilia Galotti* und Goethes *Clavigo* im Kontext des Bürgerlichen Trauerspiels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti und Johann Wolfgang von Goethes Clavigo im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels. Der Fokus liegt auf der Anwendbarkeit des Schemas des bürgerlichen Trauerspiels auf beide Dramen und der Frage, inwieweit Clavigo den Kriterien dieses Genres entspricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels, Lessings Dramentheorie, die Definition und Charakteristika des „Bürgerlichen“ im Kontext des Trauerspiels, den Ständekonflikt in beiden Dramen, sowie einen Vergleich der Figurenkonstellationen und Konflikte in Emilia Galotti und Clavigo.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie des bürgerlichen Trauerspiels, eine Analyse von Lessings Emilia Galotti, eine Analyse von Goethes Clavigo und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen. Die Kapitel drei und vier analysieren die jeweiligen Dramen. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Welche Rolle spielt Lessings Dramentheorie?
Lessings Dramentheorie spielt eine zentrale Rolle, da sie maßgeblich die Entwicklung und die Definition des bürgerlichen Trauerspiels beeinflusst hat. Die Arbeit untersucht den Einfluss seiner Theorie auf das Genre und seine Auswirkungen auf die in den Dramen dargestellten Konflikte und moralischen Fragen.
Wie wird der Ständekonflikt behandelt?
Der Ständekonflikt zwischen Bürgertum und Adel wird als zentrales Thema in Emilia Galotti und Clavigo analysiert. Die Arbeit untersucht diesen Konflikt sowohl auf der Ebene der Figurenkonstellation als auch der Handlungsorte und beleuchtet die tragischen Konsequenzen und moralischen Dilemmata, die daraus entstehen.
Welchen Vergleich zieht die Arbeit zwischen *Emilia Galotti* und *Clavigo*?
Die Arbeit vergleicht die Figurenkonstellationen und Konflikte in beiden Dramen, um die Anwendbarkeit des Schemas des bürgerlichen Trauerspiels auf Clavigo zu untersuchen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Stücken aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bürgerliches Trauerspiel, Lessing, Goethe, Emilia Galotti, Clavigo, Ständekonflikt, Dramentheorie, bürgerliche Moral, Figurenkonstellation, Mitleid, Rührung, Identifikation.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine Literaturrecherche zur Theorie des bürgerlichen Trauerspiels mit einer detaillierten Analyse der beiden Dramen. Der Vergleich beider Stücke dient der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Das bürgerliche Trauerspiel. Lessings "Emilia Galotti" und Goethes "Clavigo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315270