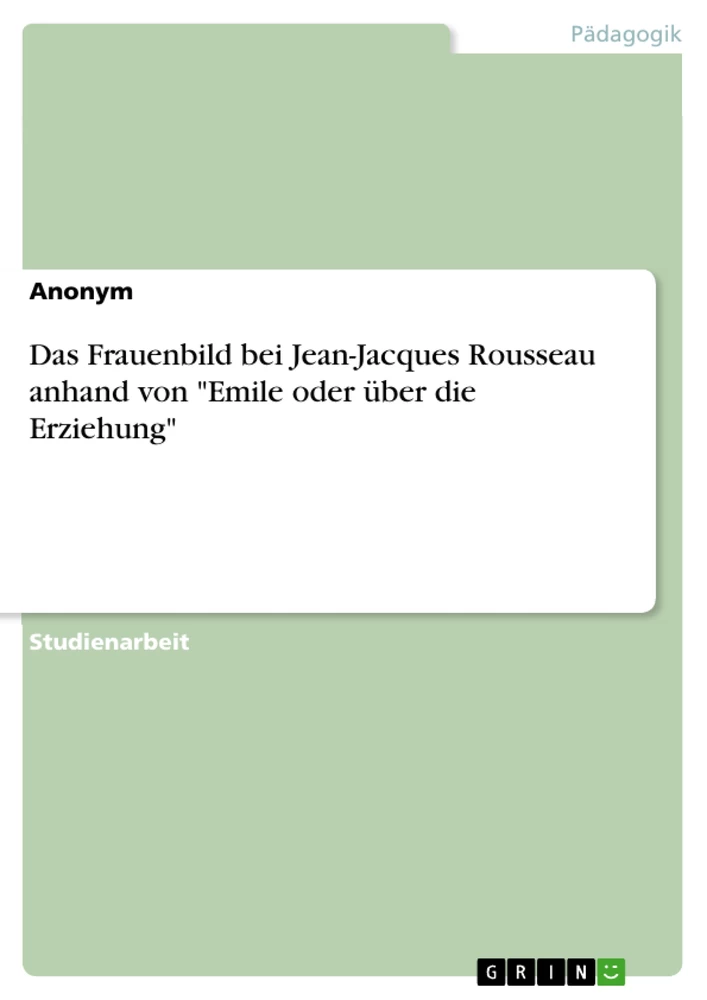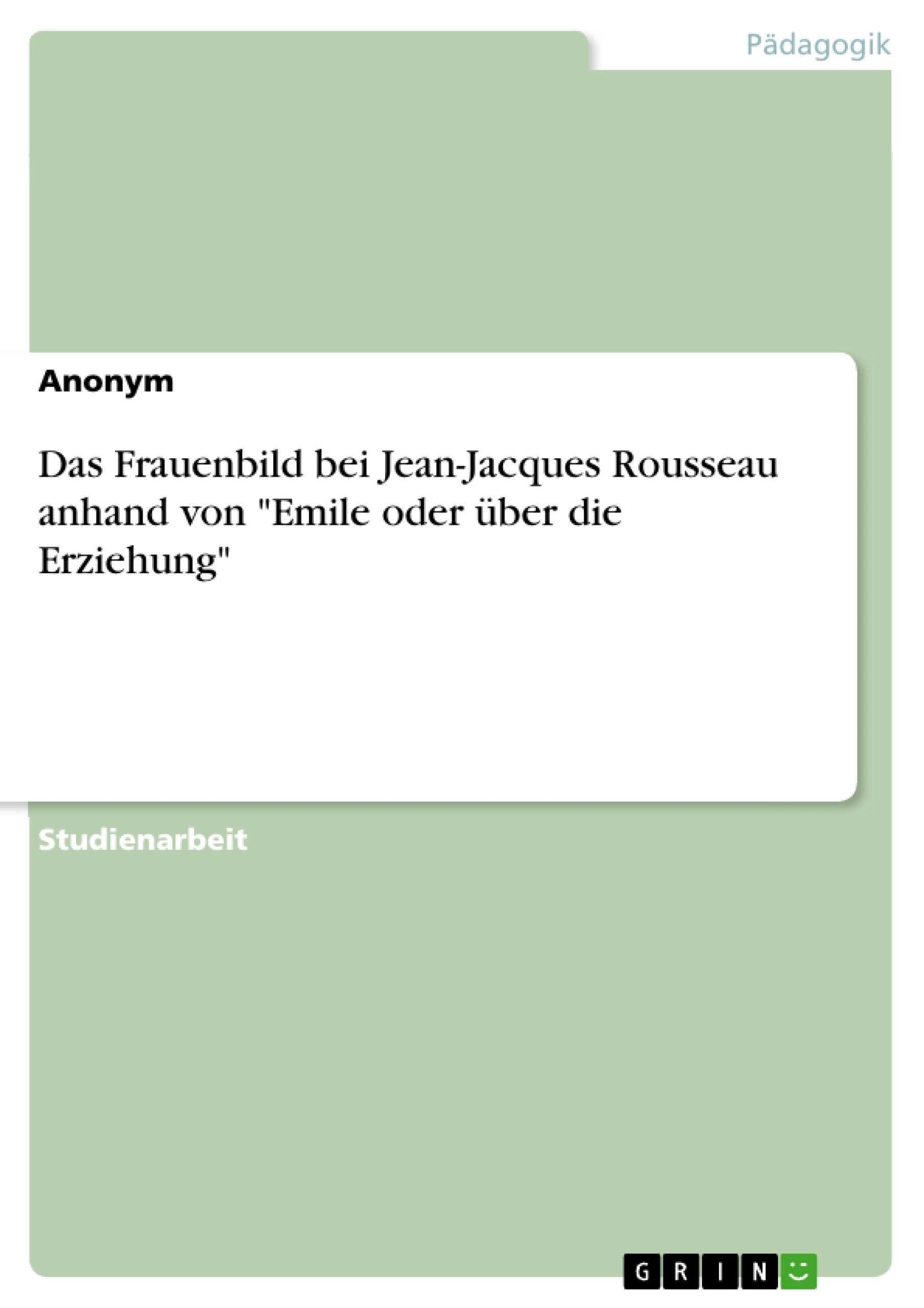Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Frauenbild Rousseaus am Beispiel der Figur der Sophie aus dem Werk „Emil oder über die Erziehung“. Auf der Grundlage des fünften Buches sollen zunächst die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geschlechter aufgezeigt werden, indem Bezug auf die Natur, Religion und die Eigenschaften der Geschlechter genommen wird. Daran anschließend wird die Abhängigkeit der Geschlechter voneinander thematisiert und erklärt.
In einem nächsten Punkt werden die Eigenschaften einer Frau vorgestellt, die nach Auffassung Rousseaus jede Frau besitzt, wobei das besondere Augenmerk auf ihren Bedürfnissen liegt, die wiederum mit der Natur zu erklären sind. Anschließend werden die Aufgaben und Pflichten der Frau erläutert, zu denen die Pflichten als Mutter, Gattin und Hausfrau zu zählen sind. Darauf aufbauend soll die Erziehung des weiblichen Geschlechts, zunächst im Kindesalter und anschließend im heiratsfähigen Alter, beschrieben werden. Es folgt die Charakterisierung von Sophie, welche Rousseau als ideale Frau konstruiert hat. In einem weiteren Schritt werden die Gründe Rousseaus, dieses Werk zu verfassen, und die Wirkung des Werkes auf die Leser untersucht. Abschließend wird das Frauenbild Rousseaus auf der Grundlage der Ergebnisse der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Themen vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Mann und Frau - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Die Abhängigkeit der Geschlechter
- Das weibliche Geschlecht
- Die Eigenschaften der Frau
- Aufgaben und Pflichten der Frau
- Die Erziehung der Frau
- Sophie, die ideale Frau
- Wirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert das Frauenbild von Jean-Jacques Rousseau am Beispiel der Figur Sophie aus seinem Werk „Emil oder über die Erziehung“. Das fünfte Buch des Werkes steht dabei im Fokus, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geschlechter aufzuzeigen, indem Rousseau auf Natur, Religion und Eigenschaften der Geschlechter Bezug nimmt.
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mann und Frau
- Die Abhängigkeit der Geschlechter voneinander
- Die Eigenschaften, Aufgaben und Pflichten der Frau
- Die Erziehung des weiblichen Geschlechts
- Die Konstruktion der idealen Frau durch Rousseau
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mann und Frau aus Rousseaus Sicht. Er argumentiert, dass die Geschlechter trotz vieler Gemeinsamkeiten durch die Natur unterschiedliche Eigenschaften und Rollen erhalten. Die Frau wird als das schwächere Geschlecht dargestellt, das sich dem Mann unterordnen soll. Im zweiten Kapitel wird die Abhängigkeit der Geschlechter voneinander beleuchtet. Rousseau argumentiert, dass die Frau stärker vom Mann abhängig ist, da ihre Bedürfnisse ohne ihn nicht gestillt werden können. Das dritte Kapitel beschreibt die Eigenschaften, Aufgaben und Pflichten der Frau, die sich aus Rousseaus Sicht aus der Natur ableiten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Das Frauenbild Rousseaus, Geschlechterdifferenz, Natur, Abhängigkeit, Erziehung, Sophie, ideale Frau, „Emil oder über die Erziehung“
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Das Frauenbild bei Jean-Jacques Rousseau anhand von "Emile oder über die Erziehung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315356