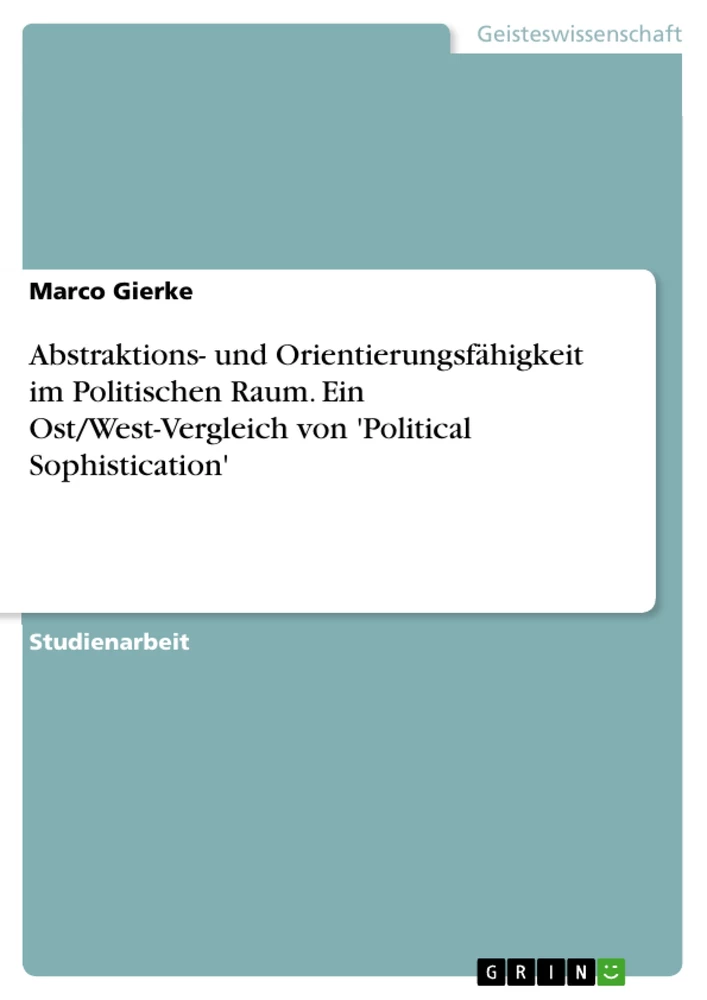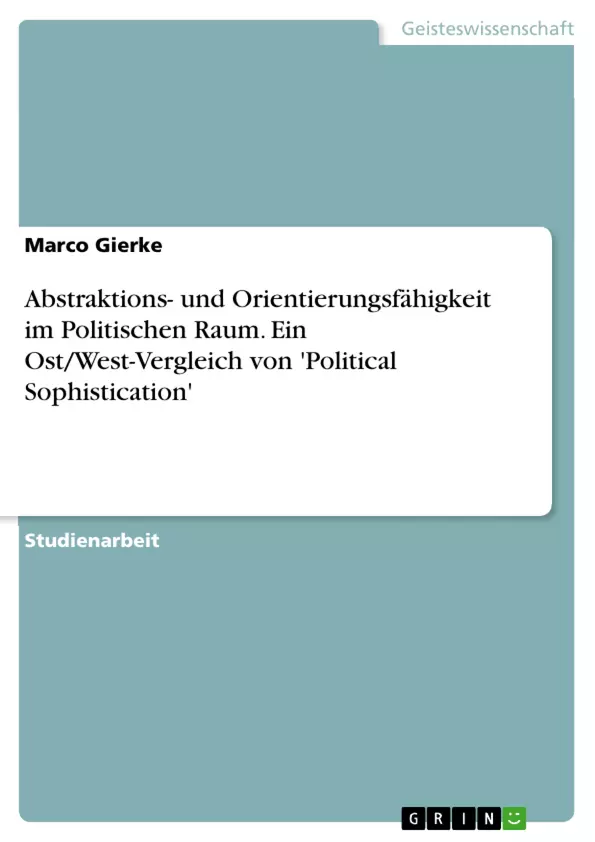Auch nach über 25 Jahren der Wiedervereinigung werden noch immer erkennbare Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern angeführt. Lohnunterschiede, Arbeitslosigkeit und auch im Wahlverhalten sind Unterschiede nicht abzustreiten.
Doch woher kommen diese Unterschiede? Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe, anhand von Befragungsdaten der Bundestagswahl 2013 diesem Unterschied zwischen „Ost“ und „West“ nachzugehen und grundlegende Differenzen im politischen Denken zu identifizieren und zu erklären. Die Hoffnung dabei ist, durch den Nachweis nachhaltiger Auswirkungen der unterschiedlichen Sozialisation für die weder sichtbaren noch intendierten und auch nicht aktuellen Beeinflussungen der politischen Wahrnehmungs- und Bewertungsfähigkeit von Individuen zu sensibilisieren, um diese als weitere mögliche Variable in Ost/West-Untersuchungen der aktuellen Forschung miteinzubeziehen.
In der Wahl- und Einstellungsforschung gibt es schon seit langem Bestrebungen, diese Frage zu klären. Dabei werden unter anderem soziostrukturelle oder auch sozialpsychologische Erklärungsansätze verfolgt, um Gründe für die Unterschiede zu elaborieren. Diese beziehen sich aber vor allem auf den aktuellen Kontext, in welche die Individuen eingebettet sind. Wodurch wurden die unterschiedlichen Gegebenheiten aber bedingt? Die Teilung Deutschlands in zwei sich gegenüberstehende Staaten mit unterschiedlichen Vorstellungen, Ideologien und politischen Rahmenbedingungen kann kaum folgenlos sein für die politische Wahrnehmung der Individuen heutzutage, zumindest jedenfalls solcher, welche in einem der beiden Systeme aufgewachsen sind. Und ist es nicht denkbar, dass neben dem Wahlverhalten noch wesentlich grundlegende Unterschiede der heutigen Individuen durch die unterschiedlichen Sozialisationsrahmen induziert sind?
Theoretisch wird hierbei auf die Arbeit von Philip E. Converse zur „nature of belief systems in mass publics“ aufgebaut. Converse befasst sich dort mit ebenjenen grundlegenden Strukturen des politischen Bewusstseins und entwickelt ein Konzept von political sophistication. Dieses theoretische Konzept wird in messbare Indikatoren umgesetzt, um Unterschiede zwischen "Ost" und "West" nachweisen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen und Hypothesen
- 2.1 Political Sophistication und die Entstehung von Belief Systems
- 2.2 Sozialisationsprozesse
- 2.3 Black and White-Modell
- 2.4 Orientierung im politischen Raum: Links/Rechts-Schema
- 3. Hypothesen
- 4. Methodisches Vorgehen: Operationalisierung und Durchführung
- 5. Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Unterschiede im politischen Denken zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung. Sie analysiert, ob die unterschiedlichen Sozialisationsprozesse in der DDR und der BRD nachhaltige Auswirkungen auf die politische Versiertheit (political sophistication) der Bevölkerung haben. Die Arbeit konzentriert sich auf die grundlegenden Strukturen des politischen Bewusstseins (belief systems) und deren Entstehung.
- Der Einfluss unterschiedlicher Sozialisationsprozesse auf das politische Denken.
- Die Entwicklung und Struktur von Belief Systems im Ost-West-Vergleich.
- Der Zusammenhang zwischen Political Sophistication und dem Abstraktions- und Orientierungsvermögen im politischen Raum.
- Die Rolle des Parteiensystems in der Bildung politischer Einstellungen.
- Die Überprüfung von Hypothesen zur Erklärung von Ost-West-Differenzen im politischen Denken.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den anhaltenden Unterschieden im politischen Denken zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung. Sie verortet die Arbeit im Kontext bestehender soziostruktureller und sozialpsychologischer Erklärungsansätze für Ost-West-Unterschiede und argumentiert, dass die unterschiedlichen Sozialisationssysteme der DDR und der BRD einen nachhaltigen Einfluss auf die politische Wahrnehmung und Bewertungsfähigkeit von Individuen haben könnten. Die Arbeit verwendet den Begriff der "political sophistication" (Converse) als zentralen Analysefokus, um die Unterschiede im politischen Denken zu untersuchen, und betont die Bedeutung des Verständnisses von "belief systems" als Grundlage für diese Analyse. Die Arbeit kündigt ihren methodischen Ansatz und die Struktur der folgenden Kapitel an.
2. Theoretischer Rahmen und Hypothesen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es spezifiziert den Begriff der "political sophistication" im Kontext der Entstehung von "belief systems" nach Converse. Es diskutiert verschiedene Sozialisationsmodelle und deren Relevanz für die Entstehung von Unterschieden im politischen Denken zwischen Ost und West. Es wird das "Black and White-Modell" von Converse kurz vorgestellt, sowie das Links/Rechts-Schema als Orientierungssystem im politischen Raum. Das Kapitel mündet in die Formulierung von Hypothesen, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden.
Schlüsselwörter
Political Sophistication, Belief Systems, Sozialisation, Ost-West-Vergleich, Politisches Denken, Wahlverhalten, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Parteisystem, Abstraktion, Orientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Unterschiede im politischen Denken zwischen Ost- und Westdeutschland
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht Unterschiede im politischen Denken zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung. Sie analysiert, ob die unterschiedlichen Sozialisationsprozesse in der DDR und der BRD nachhaltige Auswirkungen auf die politische Versiertheit (political sophistication) der Bevölkerung haben. Der Fokus liegt auf den Strukturen des politischen Bewusstseins (belief systems) und deren Entstehung.
Welche zentralen Konzepte werden verwendet?
Zentrale Konzepte sind "political sophistication" (nach Converse), "belief systems", verschiedene Sozialisationsmodelle (inkl. dem Black and White-Modell von Converse), und das Links/Rechts-Schema als Orientierungssystem im politischen Raum.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Gibt es nach der Wiedervereinigung anhaltende Unterschiede im politischen Denken zwischen Ost- und Westdeutschland, und wenn ja, wie lassen sich diese erklären? Die Studie untersucht den Einfluss unterschiedlicher Sozialisationsprozesse auf die politische Wahrnehmung und Bewertungsfähigkeit.
Welche Hypothesen werden aufgestellt und geprüft?
Die konkreten Hypothesen werden im Kapitel "Theoretischer Rahmen und Hypothesen" formuliert und im empirischen Teil der Arbeit überprüft. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Political Sophistication und dem Abstraktions- und Orientierungsvermögen im politischen Raum sowie die Rolle des Parteiensystems in der Bildung politischer Einstellungen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Studie beschreibt ihr methodisches Vorgehen, die Operationalisierung der Konzepte und die Durchführung der empirischen Untersuchung im Kapitel "Methodisches Vorgehen: Operationalisierung und Durchführung". Nähere Details zur Methodik werden in der vollständigen Arbeit erläutert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen und Hypothesen (inkl. Political Sophistication, Sozialisationsprozesse, Black and White-Modell, Links/Rechts-Schema), Hypothesen, Methodisches Vorgehen, Ergebnisse und Fazit.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die bereitgestellte Vorschau enthält Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels "Theoretischer Rahmen und Hypothesen". Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Kontext dar. Das zweite Kapitel spezifiziert die zentralen Konzepte und formuliert die zu prüfenden Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Studie?
Schlüsselwörter sind: Political Sophistication, Belief Systems, Sozialisation, Ost-West-Vergleich, Politisches Denken, Wahlverhalten, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Parteisystem, Abstraktion, Orientierung.
- Quote paper
- Marco Gierke (Author), 2015, Abstraktions- und Orientierungsfähigkeit im Politischen Raum. Ein Ost/West-Vergleich von 'Political Sophistication', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315492