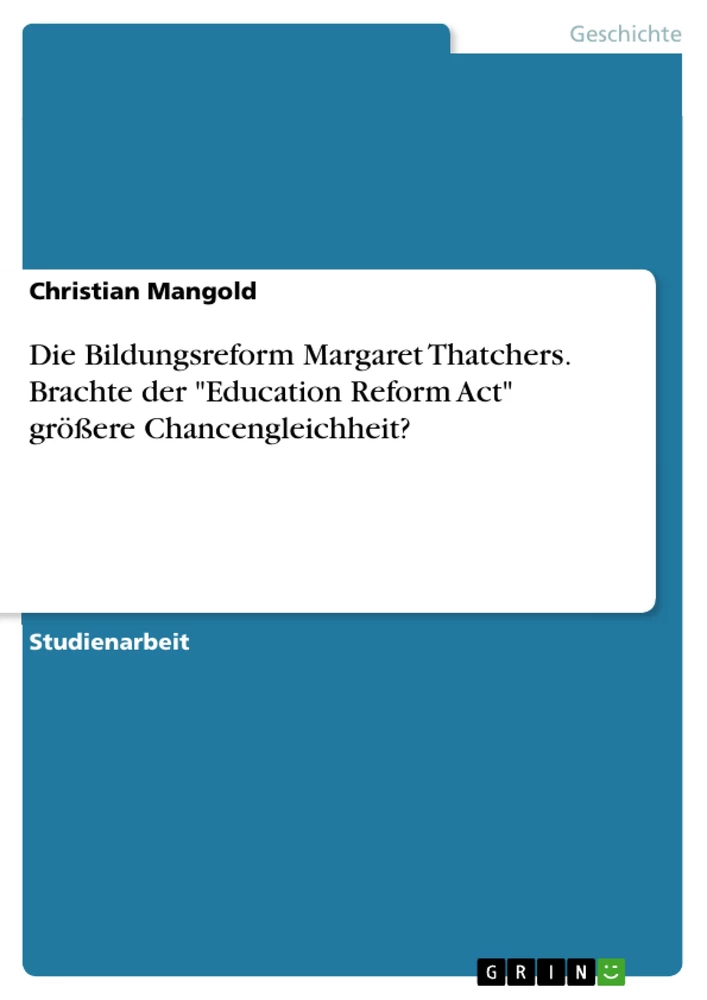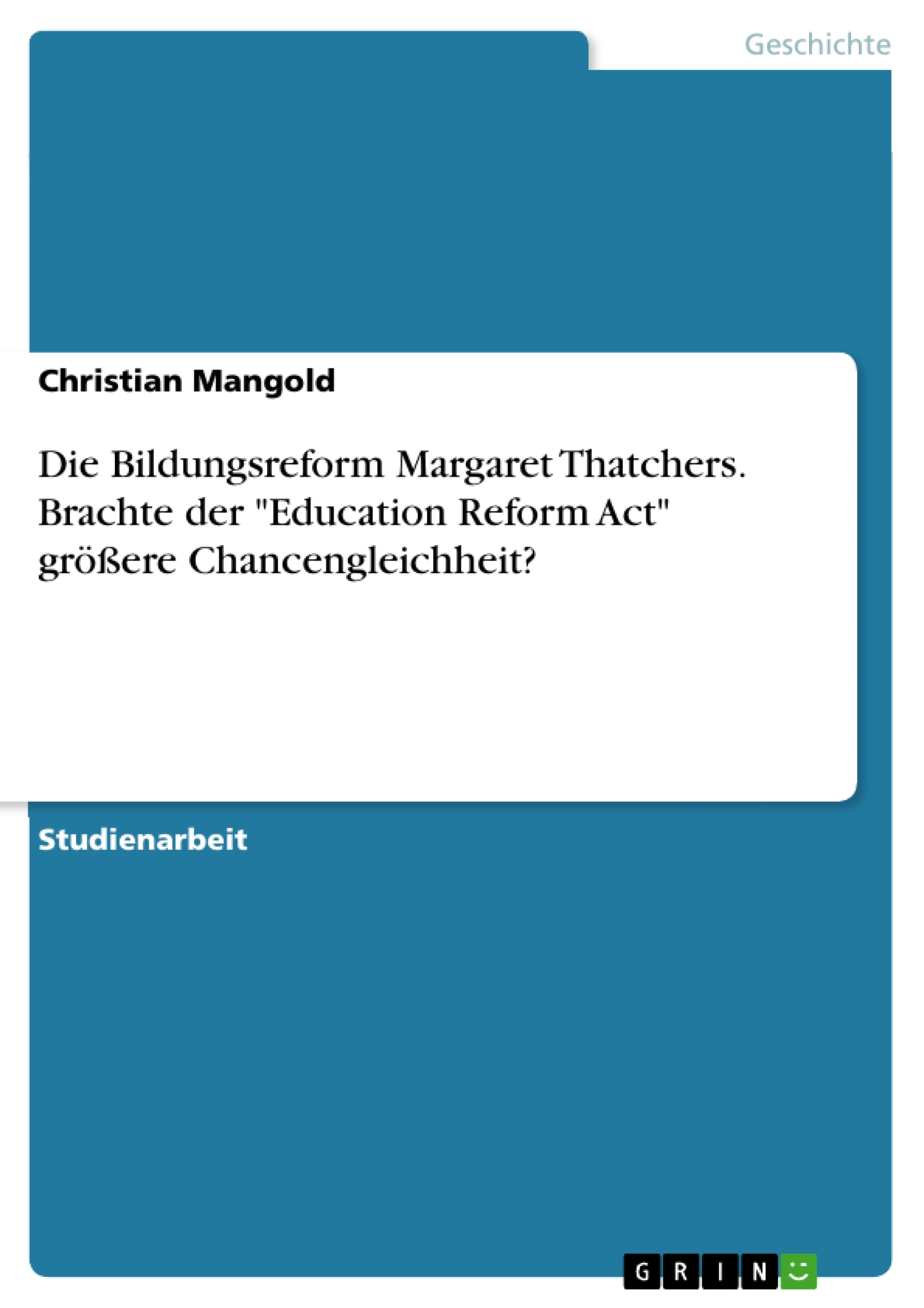Wurde die Qualität der Schulbildung sowie die Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler durch die Reformierung des englischen Bildungssystems unter Margaret Thatcher verbessert? Vorliegende Hausarbeit untersucht den "Education Reform Act" von 1988 im Hinblick auf diese Fragestellung, insbesondere die Einführung des "National Curriculums", die Mitsprache der Eltern und die Privatisierung der Schulen.
Das britische Bildungssystem besitzt eine lange Tradition und bis ins zwanzigste Jahrhundert hat es nur wenige große Reformen erfahren. Dies änderte sich unter der Regierung von Margaret Thatcher. Während ihrer Amtszeit hat es tiefgreifende Veränderungen in der Bildungspolitik von England gegeben.
Peter Wilby hat im Guardian das Thema aufgegriffen und titelte „Margaret Thatcher’s education legacy is still with us – driven on by Gove“. Er geht in dem Artikel näher auf den Widerspruch ein, dass Thatcher während ihrer Regierungszeit das Ziel hatte, den Staat aus dem Leben der Menschen herauszunehmen, aber in der Bildungspolitik scheinbar das Gegenteil tat, indem sie engere Kontrollen der Schulen durch den Staat einführte und auch den Lehrplan vorgab.
Diese Punkte wurden in der größten Bildungsreform Englands seit Ende des Zweiten Weltkrieges, den "Education Reform Act" von 1988, umgesetzt. Ziel war es, auch auf Bildungsebene einen Markt und einen damit einhergehenden Wettbewerb zu schaffen, dem sich alle Schulen stellen müssen. Damit wollte Thatcher und speziell ihr Bildungsminister Baker die Qualität der Bildung erhöhen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Geschichte des englischen Schulsystems
- Von den Anfängen bis in die 1970er Jahre
- Die Struktur des englischen Schulsystems
- Primary Schools
- Secondary Schools
- Privatschulen
- Abschlüsse
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Die Reformen unter Margaret Thatcher
- Ansichten der Parteien zum Schulsstem
- Einfluss des Thatcherismus
- Der Education Reform Act von 1988
- National Curriculum
- Mitsprache der Eltern
- Demokratisierung und Privatisierung
- Folgend und Konsequenzen der Reformen
- Umsetzung der Reformen
- Chancengleichheit
- Freie Schulwahl
- Neue Schulformen
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit analysiert die Reformen des englischen Bildungssystems unter Margaret Thatcher, insbesondere den Education Reform Act von 1988, und untersucht, inwiefern diese Reformen zu größerer Chancengleichheit im Bildungswesen geführt haben. Sie setzt sich mit der historischen Entwicklung des englischen Schulsystems auseinander und beleuchtet die Strukturen und wichtigen Akteure. Dabei werden die Ziele und Strategien der Thatcher-Regierung im Bereich der Bildung und die Auswirkungen des Thatcherismus auf das Schulwesen beleuchtet.
- Historische Entwicklung des englischen Schulsystems
- Einfluss des Thatcherismus auf die Bildungspolitik
- Einführung des National Curriculum
- Demokratisierung und Privatisierung des Schulwesens
- Chancengleichheit im englischen Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Reformen des englischen Bildungssystems unter Margaret Thatcher ein und beleuchtet die Intentionen und Ziele dieser Reformen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des englischen Schulsystems, beginnend mit den Anfängen im 6. Jahrhundert bis hin zu den Reformen des 20. Jahrhunderts. Es beschreibt die Struktur des Schulsystems mit seinen verschiedenen Schulformen, Abschlüssen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Das dritte Kapitel widmet sich den Reformen unter Margaret Thatcher und betrachtet die Ansichten der Parteien zum Schulsystem, den Einfluss des Thatcherismus auf die Bildungspolitik und den Education Reform Act von 1988. Es behandelt die Einführung des National Curriculums, die Mitsprache der Eltern und die Demokratisierung und Privatisierung des Schulwesens.
Das vierte Kapitel analysiert die Folgen und Konsequenzen der Thatcher-Reformen, insbesondere die Umsetzung der Reformen und die Frage der Chancengleichheit im englischen Bildungssystem. Es betrachtet die freie Schulwahl, die neuen Schulformen und die resultierende Chancengleichheit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: Englische Bildungspolitik, Margaret Thatcher, Education Reform Act 1988, National Curriculum, Chancengleichheit, Schulsystem, Thatcherismus, Privatisierung, Demokratisierung, Grammar Schools, Comprehensive Schools.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Education Reform Act“ von 1988?
Es war die umfassendste Bildungsreform in England seit 1945, die unter Margaret Thatcher eingeführt wurde, um Wettbewerb und Marktmechanismen im Schulwesen zu etablieren.
Was ist das „National Curriculum“?
Das National Curriculum ist ein staatlich vorgegebener Lehrplan, der unter Thatcher eingeführt wurde, um die Kontrolle des Staates über die Bildungsinhalte zu erhöhen.
Brachte die Reform größere Chancengleichheit?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob freie Schulwahl und Privatisierung tatsächlich die Chancengleichheit verbesserten oder ob sie eher bestehende soziale Unterschiede verstärkten.
Wie hat Margaret Thatcher das Schulsystem privatisiert?
Durch die Einführung neuer Schulformen und die Stärkung der Mitsprache von Eltern wurde versucht, Schulen wie Unternehmen im Wettbewerb agieren zu lassen.
Welche Rolle spielten Comprehensive Schools und Grammar Schools?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung dieser Schulformen und wie die Reformen unter Thatcher deren Struktur und Bedeutung veränderten.
- Quote paper
- Christian Mangold (Author), 2014, Die Bildungsreform Margaret Thatchers. Brachte der "Education Reform Act" größere Chancengleichheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315560