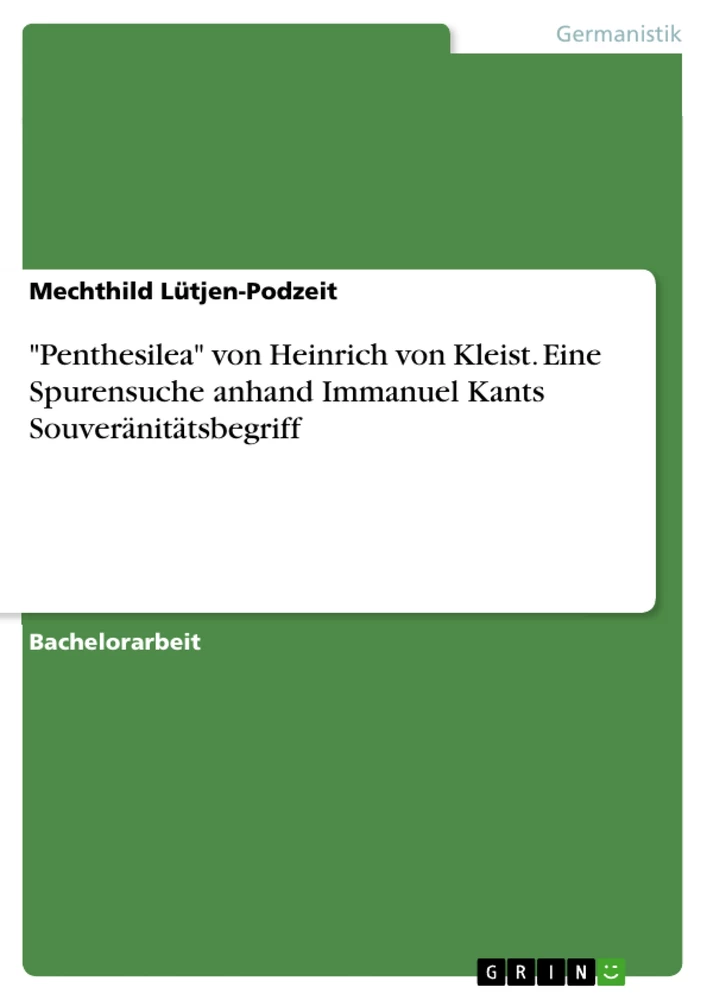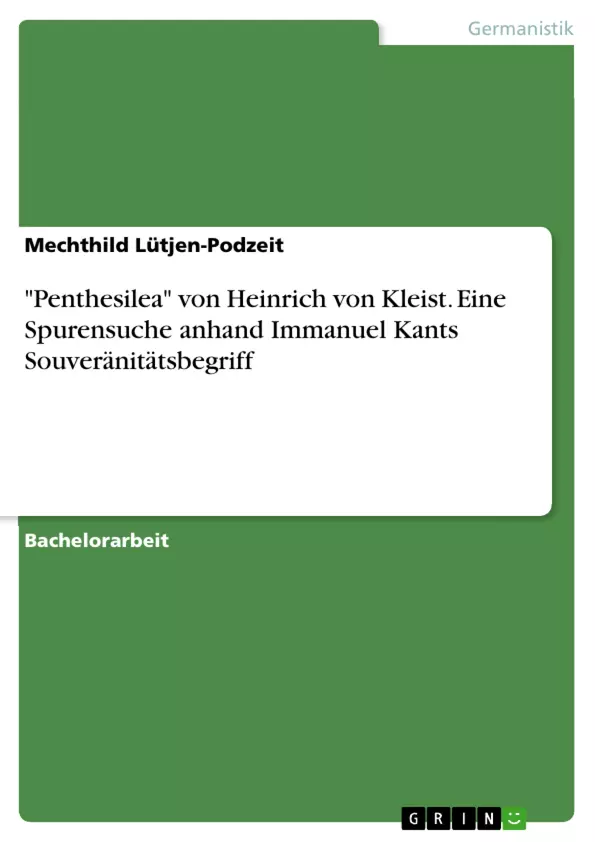"Entsetzlich" nannte Thomas Mann das Stück "Penthesilea" und sprach damit nur das Offensichtlichste aus. Schon Kleist selber schrieb in einem Brief, dass es zwangsläufig Entsetzen hervorrufen müsse und genau dies ist auch das Wort, das die Oberpriesterin ausruft, als sie vom kannibalistischen Blutrausch der Amazonenkönigin Penthesilea erfährt.
Entsetzen ist also nicht nur das Leitmotiv der Rezeption des Stückes, angefangen bei Goethe, dem es Kleist zu Füßen legte und der sich schaudernd abwandte, es ist auch ein immanentes Motiv des Stückes selbst.
Doch was geht da vor? Was ist das für eine Dynamik, die hier in Gang gesetzt wird und solch Entsetzen auslöst?
Kleists 1806/1807 entstandenes Drama ist ein gesellschaftskritisches Stück. Er zeigt exemplarisch anhand der Protagonistin Penthesilea, wie unvereinbar staatliches Pflichtbewusstsein mit Individualität sein kann. Penthesileas ausbrechender persönlicher innerer Konflikt wird durch das System ihres Amazonenstaates ausgelöst. Aus der Konfrontation der natürlichen Gefühle mit der kollektiven Ordnung entsteht das Tragische.
Bis heute ist rätselhaft, ob der Trojanische Krieg so stattfand, wie ihn Homer schildert oder ob es das Volk der Amazonen tatsächlich gegeben hat. Wahrscheinlich ist, dass es sich dabei um eine Essenz aus Geschichten und Konstellationen handelt, die so oder so ähnlich tatsächlich zu verschiedenen Zeiten und sich gewissermaßen zu mythischen Geschichten kristallisiert haben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Der entworfene Mensch....
- 2 Souveränität...
- 3 Moralisches Handeln und sinnliche Neigung ....
- 4 Der geschaffene Mensch.
- 5 Kern oder Knoten?
- 6 Entgrenztes Handeln. Überwindung der Norm..
- 7 Schmelzen und Schmieden
- 8 Erz und Begehren
- 9 Küsse. Bisse. (V 2981) Totküssen.
- 10 Fluchtgewog (V 251)..
- 11 Aphrodisiakum
- 12 In starken Armen hebt er mich empor, und jeder Griff nach diesem Dolch versagt mir, (V 1569).....
- 13 Hinweg die Luft trinkt lechzend, die sie hemmt! (V 398) Paradoxe Souveränität!..
- 14 Nackt unter den Worten: „War je ein Traum so bunt, als was hier wahr ist?\" (V 986)...
- 15 Bogenschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit analysiert Kleists „Penthesilea" unter dem Aspekt der Souveränität. Die Analyse erfolgt anhand Kants Souveränitätsbegriff und untersucht die Spannungsfelder zwischen individueller Freiheit, gesellschaftlicher Norm und dem Einfluss von Emotionen auf das menschliche Handeln.
- Die Herausforderungen der individuellen Freiheit im Spannungsfeld zur gesellschaftlichen Ordnung
- Der Einfluss von Emotionen auf das menschliche Handeln und die Fähigkeit zur moralischen Selbstbestimmung
- Die Rolle der Liebe und des Begehrens in der Tragödie
- Die Paradoxien von Gewalt und Vernunft
- Die Konstruktion von Identität und die Frage nach dem „wahren" Selbst
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Der entworfene Mensch: Dieses Kapitel analysiert die Figur der Penthesilea im Kontext des Amazonenstaates. Es untersucht den Konflikt zwischen Penthesileas individueller Freiheit und den Zwängen der gesellschaftlichen Ordnung.
- Kapitel 2: Souveränität: Dieses Kapitel erörtert Kants Souveränitätsbegriff und seine Relevanz für das Verständnis von Penthesileas Handeln. Es beleuchtet die Herausforderungen der Selbstbestimmung in einem autoritären Kontext.
- Kapitel 3: Moralisches Handeln und sinnliche Neigung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Penthesileas sinnliche Neigung zu Achilles ihre moralischen Entscheidungen beeinflusst. Es untersucht den Konflikt zwischen Vernunft und Emotionen im Kontext des menschlichen Handelns.
- Kapitel 4: Der geschaffene Mensch: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Amazonenstaates in der Konstruktion von Penthesileas Identität. Es untersucht, wie die gesellschaftliche Norm die individuelle Freiheit und das Selbstverständnis der Protagonistin prägt.
- Kapitel 5: Kern oder Knoten?: Dieses Kapitel erforscht die zentralen Konflikte in „Penthesilea" und untersucht die Rolle des Begehrens in der Tragödie. Es analysiert die Auswirkungen der Liebe auf Penthesileas Selbstbild und ihre Handlungsfreiheit.
- Kapitel 6: Entgrenztes Handeln. Überwindung der Norm: Dieses Kapitel beleuchtet Penthesileas Rebellion gegen die gesellschaftliche Ordnung und untersucht die Grenzen des menschlichen Handelns im Angesicht von Emotionen.
- Kapitel 7: Schmelzen und Schmieden: Dieses Kapitel analysiert die Metaphorik von „Schmelzen" und „Schmieden" in „Penthesilea" und untersucht die Verbindung von Liebe, Gewalt und Transformation in der Tragödie.
- Kapitel 8: Erz und Begehren: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Symbolkraft von „Erz" in der Tragödie. Es untersucht die Verbindung zwischen Penthesileas Begehren und dem unbezwingbaren Willen des „Erzes".
- Kapitel 9: Küsse. Bisse. (V 2981) Totküssen.: Dieses Kapitel analysiert die ambivalenten Beziehungsdynamiken zwischen Penthesilea und Achilles. Es untersucht die Paradoxien der Liebe und Gewalt in der Tragödie.
- Kapitel 10: Fluchtgewog (V 251).: Dieses Kapitel beleuchtet die Darstellung von Penthesileas innerem Konflikt und der Suche nach Befreiung von den gesellschaftlichen Zwängen.
- Kapitel 11: Aphrodisiakum: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Begehrens und der sexuellen Begierde in der Tragödie. Es untersucht die Verbindung zwischen Liebe und Gewalt in der Beziehung von Penthesilea und Achilles.
- Kapitel 12: In starken Armen hebt er mich empor, und jeder Griff nach diesem Dolch versagt mir, (V 1569).....: Dieses Kapitel untersucht die Machtverhältnisse zwischen Penthesilea und Achilles. Es analysiert die Rolle der Gewalt und des Gehorsams in der tragischen Beziehung.
- Kapitel 13: Hinweg die Luft trinkt lechzend, die sie hemmt! (V 398) Paradoxe Souveränität!..: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Paradox der Souveränität in „Penthesilea". Es analysiert die Spannungsfelder zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung in der Figur von Penthesilea.
- Kapitel 14: Nackt unter den Worten: „War je ein Traum so bunt, als was hier wahr ist?\" (V 986)...: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Traums und der Imagination in „Penthesilea". Es untersucht die Verbindung zwischen Liebe, Gewalt und Illusion in der Tragödie.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter in der Bachelorarbeit sind: Penthesilea, Kleist, Souveränität, Kant, Individualität, Gesellschaft, Liebe, Gewalt, Begehren, Emotion, Vernunft, Traurigkeit, Tragödie, Amazonen, Achilles.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Motiv in Kleists "Penthesilea"?
Das Motiv des „Entsetzens“ zieht sich sowohl durch die Handlung als auch durch die Rezeptionsgeschichte des Stückes.
Wie wird Kants Souveränitätsbegriff in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit nutzt Kants Begriffe, um das Spannungsfeld zwischen staatlichem Pflichtbewusstsein (Amazonenstaat) und individueller Freiheit bzw. Gefühlswelt zu analysieren.
Welchen Konflikt durchlebt die Protagonistin Penthesilea?
Sie steht im tragischen Konflikt zwischen ihrer Liebe zu Achilles und den strengen Gesetzen ihres Staates, die persönliche Bindungen verbieten.
Was symbolisiert das "Erz" in der Tragödie?
Erz steht für den unbezwingbaren Willen und die Härte der gesellschaftlichen Normen, die im Kontrast zum menschlichen Begehren stehen.
Warum wird das Stück oft als gesellschaftskritisch bezeichnet?
Weil Kleist zeigt, wie ein kollektives Ordnungssystem die Individualität und die natürlichen Gefühle des Menschen zerstören kann.
- Citation du texte
- Mechthild Lütjen-Podzeit (Auteur), 2013, "Penthesilea" von Heinrich von Kleist. Eine Spurensuche anhand Immanuel Kants Souveränitätsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315618