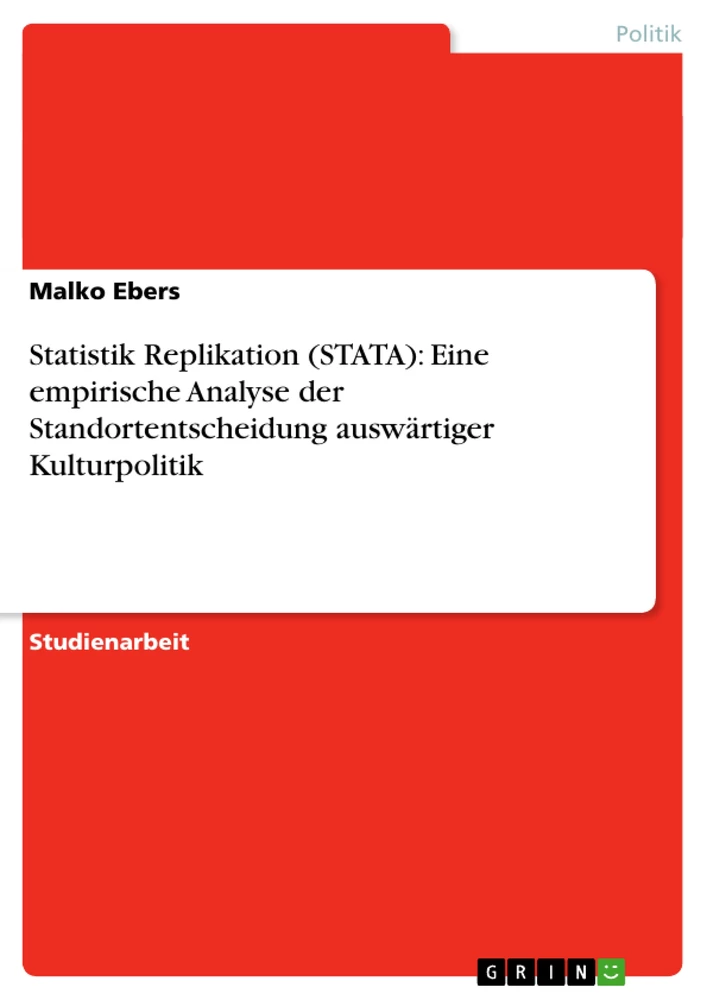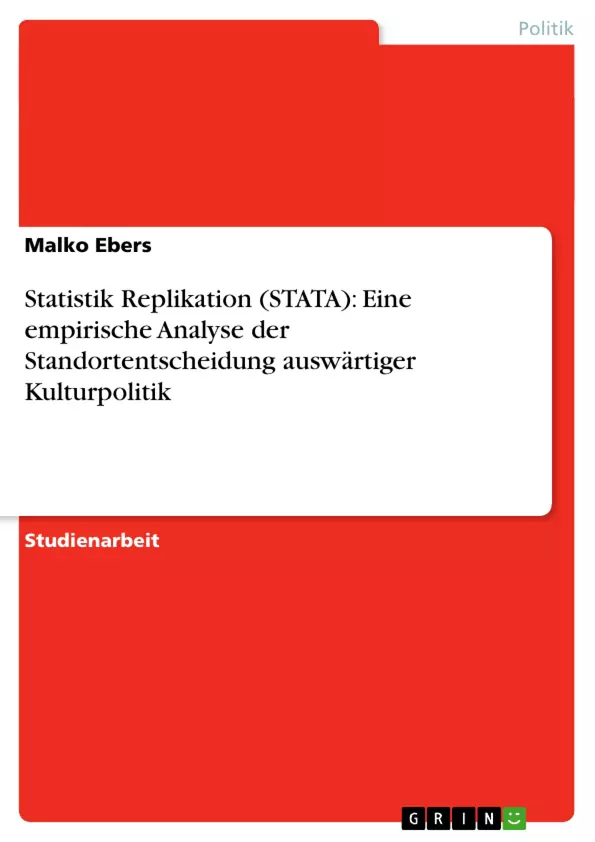Dieser Artikel untersucht mittels einer Statistik Replikation kritisch die Hauptthese der Autoren G. Schneider und J. Schiller, dass „vor allem machtpolitische und wirtschaftliche Erwägungen die weltweite Präsenz der zentralen Mittlerorganisation der Auswärtigen Kulturpolitik [das Goethe-Institut Anmerkung der Autor] leiten“ (ebd.: 5).
Dieser Hauptthese liegen drei Fragestellungen zugrunde, die jeweils ähnliche Aspekte der Verteilung von Goethe- Instituten erfassen:
1. Welche Faktoren erklären die Standortverteilung?
2. Welchen Kriterien gehorcht die unterschiedliche Personal- /Ressourcenausstattung?
3. Welche Faktoren erklären die partielle Filialreduktion?
Diese drei Fragestellungen werden jeweils mit speziell operationalisierten Makro- Modellen untersucht. Die drei Modelle einer machtorientierten oder handelsorientierten oder entwicklungsfördernden Außen (Kultur-) politik werden dann jeweils mit einem “Idealtypus“ auswärtiger Kulturpolitik, dem Auftragsmodell verglichen.
Dieses Auftragsmodell macht die Verteilung von Goethe- Instituten und des mobileren Faktors der Ressourcenausstattung (gemessen in Personalstärke) abhängig von einer reinen Nachfrageorientierung nach deutscher Kultur.
Der vorliegende Artikel hinterfragt hierbei Kritik das Forschungsdesign also insbesondere die Prämissen, sowie die Methodik der Autoren G. Schneider und J. Schiller.
Inhaltsverzeichnis
- Explanandum und Zielsetzung der Autoren
- Theoretische Modellfundierung
- Generelle methodische Einwände
- Ergebnisse des statistischen Hypothesentests
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Schneider und Schiller analysiert die Standortentscheidung von Goethe-Instituten im Kontext der Auswärtigen Kulturpolitik. Die Autoren wollen die Faktoren hinter der Verteilung der Institute und die Ressourcenallokation untersuchen. Dabei setzen sie sich kritisch mit dem "Auftragsmodell" auseinander, das eine Nachfrageorientierung nach deutscher Kultur postuliert.
- Analyse der Faktoren, die die Standortverteilung von Goethe-Instituten beeinflussen
- Untersuchung der Kriterien für die personelle und finanzielle Ausstattung der Institute
- Kritische Auseinandersetzung mit dem "Auftragsmodell" und dessen theoretischen Grundlagen
- Statistisch-methodische Analyse der verwendeten Daten und der Hypothesentests
- Beurteilung der methodischen Validität und des Erklärungsanspruchs der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Explanandum und Zielsetzung der Autoren
In diesem Kapitel stellen die Autoren ihre Hauptthese vor, wonach vor allem machtpolitische und wirtschaftliche Erwägungen die Präsenz des Goethe-Instituts bestimmen. Sie entwickeln drei Fragestellungen, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Standortverteilung und Ressourcenausstattung beleuchten. Diese Fragestellungen werden mit Hilfe von speziell operationalisierten Makro-Modellen untersucht.
2. Theoretische Modellfundierung
Die Autoren präsentieren drei unterschiedliche Modelle: ein machtorientiertes, ein handelsorientiertes und ein entwicklungsorientiertes Modell. Diese Modelle werden jeweils aus einer anderen Theorierichtung abgeleitet und dienen als Grundlage für die Hypothesenbildung.
3. Generelle methodische Einwände
Der Text diskutiert die methodischen Herausforderungen der Studie, insbesondere in Bezug auf die Auswahl der Indikatoren für die Nachfrage nach deutscher Kultur. Es wird kritisiert, dass die Studie den Einfluss anderer Quellen deutscher Kultur nicht ausreichend berücksichtigt.
4. Ergebnisse des statistischen Hypothesentests
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Hypothesentests präsentiert und analysiert. Es werden die Ergebnisse der einzelnen Modelle im Hinblick auf die Präsenz und Ausstattung von Goethe-Instituten diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Auswärtige Kulturpolitik, Goethe-Institut, Standortentscheidung, Ressourcenallokation, Machtpolitik, Wirtschaftspolitik, "Auftragsmodell", Nachfrageorientierung, statistische Analyse, Hypothesentests, methodische Validität, Forschungsdesign.
Häufig gestellte Fragen
Was bestimmt die Standortverteilung von Goethe-Instituten weltweit?
Laut Schneider und Schiller leiten vor allem machtpolitische und wirtschaftliche Erwägungen die Präsenz der Institute.
Was ist das "Auftragsmodell" der auswärtigen Kulturpolitik?
Es postuliert, dass die Verteilung der Institute rein von der Nachfrage nach deutscher Kultur im Gastland abhängen sollte.
Welche Faktoren erklären die unterschiedliche Ressourcenausstattung der Institute?
Neben politischen Interessen spielen auch Handelsbeziehungen und entwicklungspolitische Ziele eine Rolle bei der Zuweisung von Personal und Finanzen.
Welche Kritik wird am Forschungsdesign von Schneider und Schiller geübt?
Der Artikel hinterfragt die Operationalisierung der Modelle und kritisiert, dass andere kulturelle Einflüsse nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Warum kommt es zur partiellen Filialreduktion bei Goethe-Instituten?
Schließungen werden oft durch veränderte machtpolitische Prioritäten oder eine Neuausrichtung der Außenpolitik begründet.
- Quote paper
- Malko Ebers (Author), 2003, Statistik Replikation (STATA): Eine empirische Analyse der Standortentscheidung auswärtiger Kulturpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31562