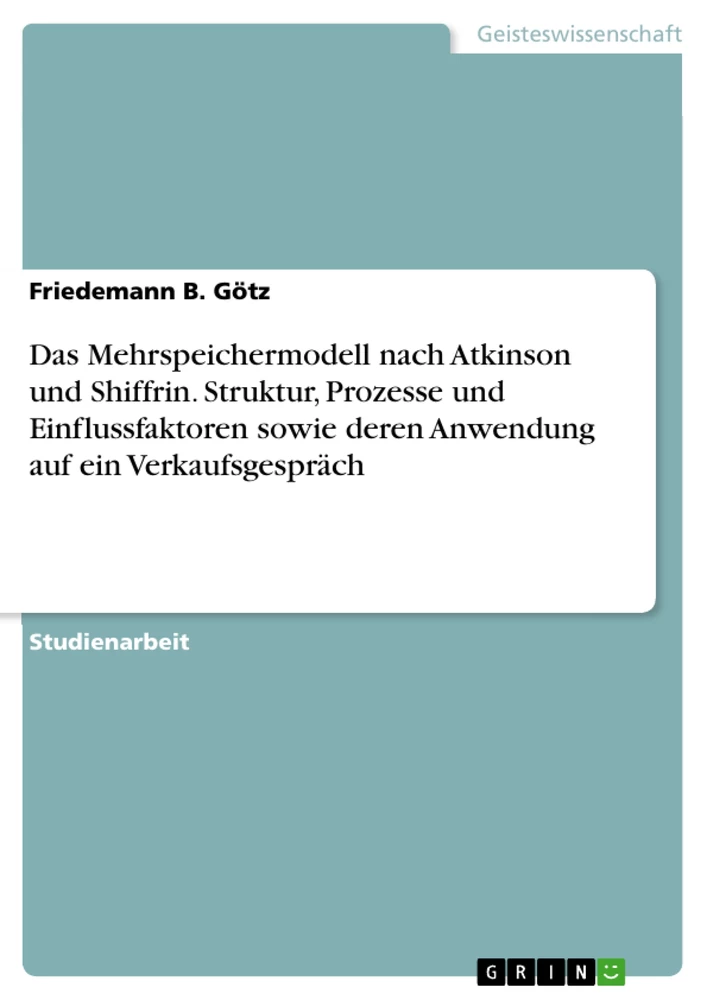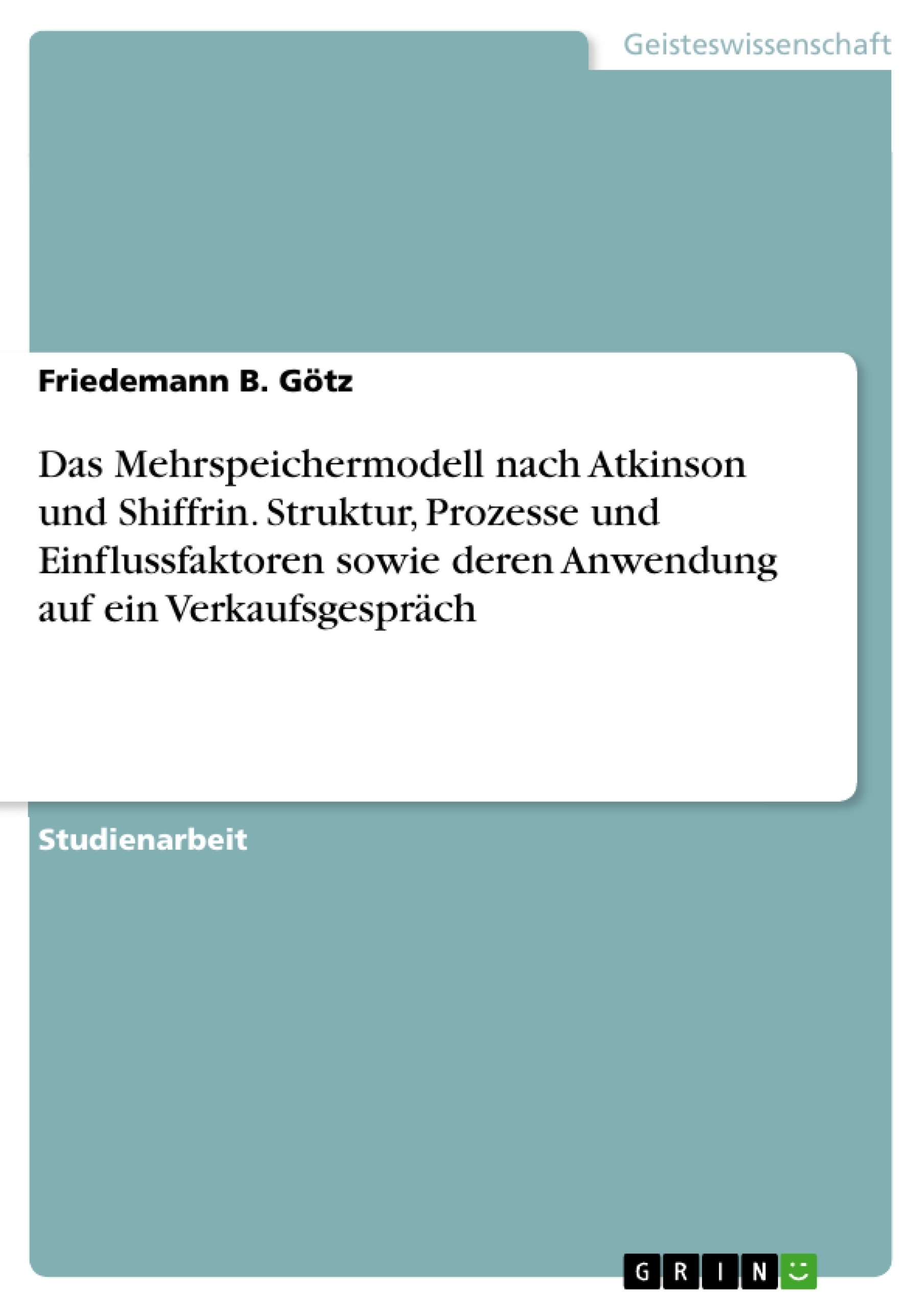Die zentrale Rolle in der vorliegenden Arbeit im Fach „Allgemeine Psychologie 1“ spielt das Gedächtnismodell der Forscher Atkinson und Shiffrin aus dem Jahr 1968. Es bildet ab, auf welche Weise das menschliche Gehirn Informationen aufnimmt, diese verarbeitet, abruft und speichert.
Ausgehend von der ursprünglichen Fassung des Modells aus dem Jahr 1968 soll auf die Struktur des menschlichen Gedächtnisses (Kapitel 2) eingegangen und dessen Funktionsweise und inhärenten Prozesse (Kapitel 3) vorgestellt werden.
Es werden Einflussfaktoren vorgestellt und diskutiert, die die Gedächtnisleistung entweder mindern oder verhindern und somit zu einer fehlerhaften Erinnerung führen (Kapitel 4) oder die Gedächtnisleistung begünstigen (Kapitel 5).
Die Diskussion der positiven Einflussfaktoren auf die Gedächtnisleistung zielt auf die Anwendung und Nutzung ebendieser Einflussfaktoren in einem wirtschaftspsychologischen Kontext, dem Verkaufsgespräch, ab. Im abschließenden Kapitel 6 werden die Fakten rekapituliert und ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Gedächtnisstruktur nach dem Mehrspeichermodell von Atkinson & Shiffrin 1968
- 2.1. Das Sensorische Gedächtnis
- 2.2. Der Kurzzeitspeicher
- 2.3. Der Langzeitspeicher
- 3. Die Gedächtnisprozesse nach Atkinson & Shiffrin 1968
- 3.1. Transfer vom Sensorischen Gedächtnis
- 3.2. Zerfall und Rehearsal
- 3.3. Transfer zwischen KZS und LZS
- 3.4. Speichern und Suchen im LZS
- 4. Negative Einflussfaktoren auf die Gedächtnisleistung
- 4.1. Fehlerhafte Speicherung
- 4.2. Fehlerhafter Abruf
- 5. Positive Einflussfaktoren auf die Gedächtnisleistung und deren Anwendung auf ein Verkaufsgespräch
- 5.1. Das Konstruktive Gedächtnis
- 5.2. Rehearsal
- 5.3. Der Primacy-Recency-Effekt
- 5.4. Codierung
- 5.5. Emotionale Faktoren
- 6. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit untersucht das Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin aus dem Jahr 1968 und betrachtet dessen Struktur, Prozesse sowie positive und negative Einflussfaktoren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Anwendung der Erkenntnisse in einem wirtschaftspsychologischen Kontext, insbesondere im Verkaufsgespräch.
- Struktur des menschlichen Gedächtnisses gemäß dem Mehrspeichermodell
- Prozesse, die bei der Speicherung und Verarbeitung von Informationen im Gedächtnis stattfinden
- Negative Einflussfaktoren, die die Gedächtnisleistung beeinträchtigen können
- Positive Einflussfaktoren, die die Gedächtnisleistung fördern und deren Anwendung im Verkaufsgespräch
- Relevanz des Mehrspeichermodells für die Wirtschaftspsychologie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des Gedächtnisses für den Menschen und den Schwerpunkt der Arbeit auf das Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin 1968 erklärt. Kapitel 2 widmet sich der Gedächtnisstruktur und beschreibt die drei Hauptkomponenten des Modells: das sensorische Gedächtnis, den Kurzzeitspeicher und den Langzeitspeicher. Kapitel 3 beleuchtet die Prozesse, die im Rahmen des Modells ablaufen, wie den Transfer von Informationen zwischen den Speicherstufen, den Zerfall von Informationen im Kurzzeitspeicher und den Einfluss von Rehearsal-Techniken. Kapitel 4 geht auf negative Einflussfaktoren auf die Gedächtnisleistung ein, wie fehlerhafte Speicherung und Abruf. Kapitel 5 fokussiert auf positive Einflussfaktoren und deren Anwendung im Verkaufsgespräch, wie das konstruktive Gedächtnis, Rehearsal, den Primacy-Recency-Effekt, Codierung und emotionale Faktoren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Mehrspeichermodell, Atkinson & Shiffrin, Gedächtnisstruktur, Gedächtnisprozesse, Sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, Rehearsal, Primacy-Recency-Effekt, Codierung, Emotionale Faktoren, Verkaufsgespräch, Wirtschaftspsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin?
Es ist ein psychologisches Modell aus dem Jahr 1968, das beschreibt, wie Informationen im menschlichen Gehirn über das sensorische Gedächtnis, den Kurzzeitspeicher und den Langzeitspeicher verarbeitet werden.
Was versteht man unter dem Primacy-Recency-Effekt?
Dieser Effekt besagt, dass Informationen am Anfang (Primacy) und am Ende (Recency) einer Liste oder eines Gesprächs am besten im Gedächtnis behalten werden.
Welche Rolle spielt „Rehearsal“ im Gedächtnisprozess?
Rehearsal bezeichnet das bewusste Wiederholen von Informationen im Kurzzeitspeicher, um deren Transfer in den Langzeitspeicher zu begünstigen.
Wie kann das Modell in einem Verkaufsgespräch genutzt werden?
Durch gezielte Codierung, emotionale Ansprache und die Nutzung des Primacy-Recency-Effekts können Verkäufer sicherstellen, dass wichtige Produktvorteile beim Kunden im Gedächtnis bleiben.
Was sind negative Einflussfaktoren auf die Gedächtnisleistung?
Dazu gehören fehlerhafte Speicherung (z.B. durch Ablenkung) oder ein fehlerhafter Abruf von Informationen, was zu falschen Erinnerungen führen kann.
- Arbeit zitieren
- Friedemann B. Götz (Autor:in), 2015, Das Mehrspeichermodell nach Atkinson und Shiffrin. Struktur, Prozesse und Einflussfaktoren sowie deren Anwendung auf ein Verkaufsgespräch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315704