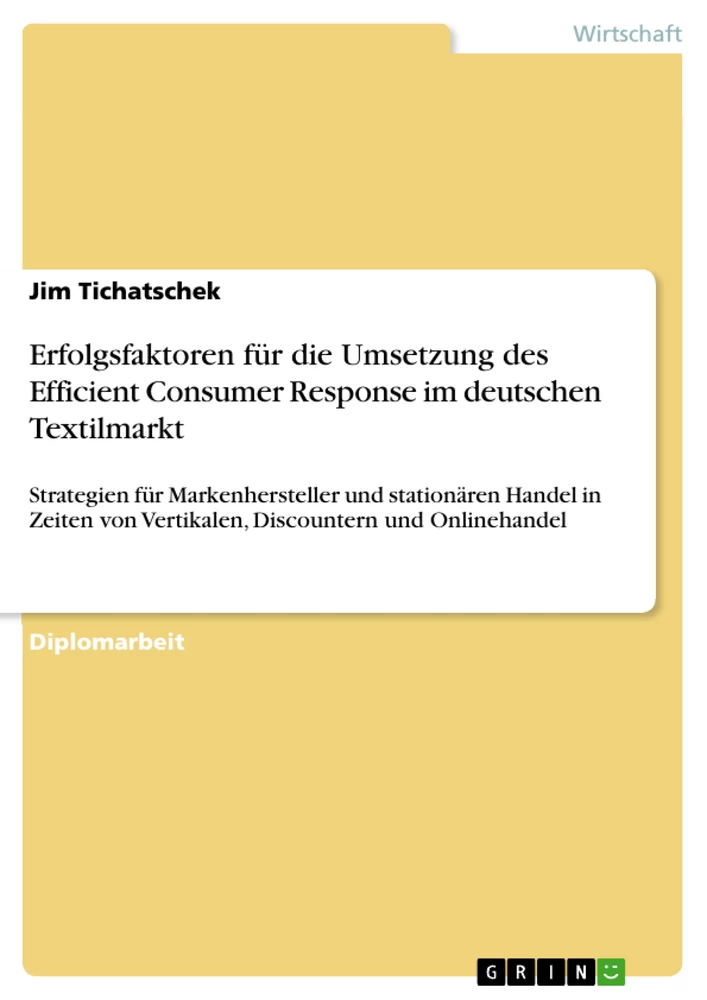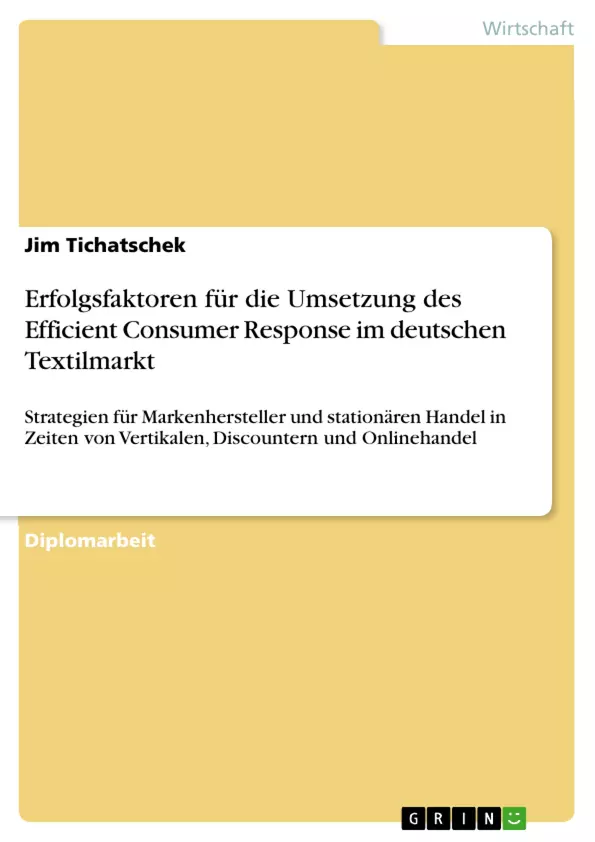Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Efficient Consumer Response Konzeptes (ECR) auf den deutschen Bekleidungseinzelhandel. Wie wichtig ein kooperatives Gesamtkonzept von Händler und Lieferant ist, machten Thomas Fahnert, Projektleiter ECR bei Galeria Kaufhof, und Claus Czisla, Global Logistics Manager bei Esprit, bereits 2006 in einem Artikel in der Branchenzeitung TextilWirtschaft deutlich.
Die treibende Kraft im Bekleidungseinzelhandel sei die Geschwindigkeit. Mehr Zeit für den Kunden könne der Handel nur gewinnen, wenn der Lieferant die Ware verkaufsfertig (floor ready) auf die Fläche liefert. Der Preis muss also vorausgezeichnet, die Warensicherung angebracht und die Ware aufgebügelt sein, bevor sie die Eingangsrampe des Stores erreicht. „Ohne die Integration von Prozessen und Standards sowie den Einsatz von EDI ist das nicht machbar“, sagte Czisla. In Zukunft werde auch RFID eine größere Rolle bei Esprit und Galeria Kaufhof spielen.
Die enge Verzahnung der unternehmensübergreifenden Prozesse habe bereits erste zählbare Effekte erzielt: Der Lagerumschlag sei in den Shop-in-Shops seit 2003 von 6,8 auf 8,0 erhöht worden. Cross-Docking-Prozesse hätten eine Einsparung bei den Logistikkosten von 30 % eingebracht. Zudem sei die Distributionszeit vom Warenverteilzentrum hin zur Filiale halbiert worden – von durchschnittlich 6,4 auf 3,2 Tage. Für Fahnert und Czisla ist die Kooperation mit starken Partnern die Antwort auf vertikal integrierte Unternehmen wie ZARA und H&M.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Das textile Wertschöpfungssystem als Instrument der strategischen Analyse
- 2.1 Die modifizierte Wertschöpfungskette der Bekleidungshersteller
- 2.2 Die umsatzstärksten Betriebsformen im Bekleidungseinzelhandel in Deutschland
- 2.2.1 Bekleidungshäuser und Bekleidungsfilialisten
- 2.2.2 Warenhäuser
- 2.2.3 Vertikale Textil- und Bekleidungsfilialisten
- 2.2.4 (Textil-) Discounter
- 2.2.5 Interaktive Unternehmen
- 2.3 Verteilung der Betriebsformen im deutschen Bekleidungseinzelhandel
- 2.3.1 Inhabergeführte Boutiquen
- 2.3.2 Sporthandel, sonstige
- 2.4 Abnehmergerichtete Wettbewerbsstrategien im Bekleidungsmarkt
- 2.4.1 Innovationsorientierung
- 2.4.2 Qualitätsorientierung
- 2.4.3 Markierungsorientierung
- 2.4.4 Programmbreitenorientierung
- 2.4.5 Kostenorientierung
- 2.4.6 Der Outpacing-Ansatz
- 3 Herausforderungen und Wettbewerbsstrategien im absatzmittlergerichteten Marketing
- 3.1 Veränderungen im Nachfrageverhalten
- 3.1.1 Konzentrationsprozess im Einzelhandel
- 3.1.2 Überangebotssituation und Preiserosion im Bekleidungsmarkt
- 3.1.3 Emanzipation des Einzelhandels und eigenständiges Handelsmarketing
- 3.2 Zielkonflikte zwischen Hersteller und Händler
- 3.3 Wettbewerbsstrategien im absatzmittlergerichteten Marketing
- 4 Klassifizierung der Flächensteuerungskonzepte im deutschen Bekleidungseinzelhandel aus Sicht eines Bekleidungsherstellers
- 4.1 Vertikal gesicherte Absatzkanäle
- 4.1.1 Vertraglich integrierte Absatzkanäle
- 4.1.2 Kooperative Vertriebsallianzen
- 4.1.3 Traditioneller Handelsbestand
- 4.1.4 Konflikte der Flächensteuerungskonzepte und Lösungsmaßnahmen
- 4.2 Zwischenfazit
- 5 Efficient Consumer Response
- 5.1 Entstehung, Entwicklung und Ziele des ECR-Konzeptes
- 5.2 Kooperationsfeld Logistik-Supply Chain Management
- 5.2.1 Efficient Replenishment
- 5.2.2 Computer Assisted Ordering
- 5.2.3 Nachfragesynchrone Produktion
- 5.2.4 Vendor Managed Inventory
- 5.3 Efficient Administration
- 5.3.1 Effiziente Konditionssysteme
- 5.3.2 Kooperationsvereinbarungen
- 5.4 Enabling Technologies
- 5.4.1 Identifikationssysteme und Scannertechnologie
- 5.4.2 Datenaustauschsystem EANCOM
- 5.4.3 Data Warehouse
- 5.5 Efficient Operating Standards
- 5.6 Category Management
- 5.6.1 Efficient Store Assortment
- 5.6.2 Efficient Promotion
- 5.6.3 Efficient Product Introduction
- 5.7 Zwischenfazit
- 6 ECR in der Praxis
- 6.1 Ausgangssituation
- 6.2 Prozessmodell für die Transformation des Flächensteuerungskonzeptes
- 6.3 Ergebnisse des Projektes
- 6.4 Erweiterungsmöglichkeiten des Prozessmodells
- 7 Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des ECR-Konzepts im deutschen Bekleidungseinzelhandel
- 7.1 Primärfaktoren für den Erfolg von ECR
- 7.2 Sekundärfaktoren für den Erfolg von ECR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Diplomarbeit untersucht die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des Efficient Consumer Response (ECR) Konzepts im deutschen Textilmarkt. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Anwendung von ECR im Kontext der komplexen Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie.
- Die Untersuchung der Herausforderungen und Chancen der Anwendung von ECR im deutschen Textilmarkt
- Die Analyse der Erfolgsfaktoren für die Implementierung von ECR
- Die Entwicklung eines Prozessmodells für die Transformation von Flächensteuerungskonzepten im Rahmen von ECR
- Die Identifizierung von Primär- und Sekundärfaktoren, die den Erfolg von ECR beeinflussen
- Die Diskussion von Implikationen für die Zukunft des deutschen Textilmarktes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema der Diplomarbeit vor und erläutert die Ausgangssituation und Problemstellung. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel.
Kapitel 2 beleuchtet das textile Wertschöpfungssystem als Instrument der strategischen Analyse. Es analysiert die Wertschöpfungskette der Bekleidungshersteller und untersucht die wichtigsten Betriebsformen im deutschen Bekleidungseinzelhandel. Darüber hinaus werden abnehmergerichtete Wettbewerbsstrategien im Bekleidungsmarkt betrachtet.
Kapitel 3 befasst sich mit Herausforderungen und Wettbewerbsstrategien im absatzmittlergerichteten Marketing. Es analysiert Veränderungen im Nachfrageverhalten, Zielkonflikte zwischen Hersteller und Händler sowie Wettbewerbsstrategien im absatzmittlergerichteten Marketing.
Kapitel 4 klassifiziert die Flächensteuerungskonzepte im deutschen Bekleidungseinzelhandel aus der Sicht eines Bekleidungsherstellers. Es untersucht vertikal gesicherte Absatzkanäle und analysiert Konflikte der Flächensteuerungskonzepte sowie Lösungsmaßnahmen.
Kapitel 5 erläutert das Efficient Consumer Response (ECR) Konzept. Es beschreibt die Entstehung, Entwicklung und Ziele von ECR und betrachtet die verschiedenen Bereiche des Konzepts, wie z.B. Logistik-Supply Chain Management, Efficient Administration, Enabling Technologies, Efficient Operating Standards und Category Management.
Kapitel 6 befasst sich mit der Anwendung von ECR in der Praxis. Es analysiert die Ausgangssituation, stellt ein Prozessmodell für die Transformation des Flächensteuerungskonzeptes vor und diskutiert die Ergebnisse des Projektes. Darüber hinaus werden Erweiterungsmöglichkeiten des Prozessmodells betrachtet.
Kapitel 7 identifiziert die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des ECR-Konzepts im deutschen Bekleidungseinzelhandel. Es unterteilt die Erfolgsfaktoren in Primär- und Sekundärfaktoren und analysiert deren Einfluss auf den Erfolg von ECR.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des Efficient Consumer Response (ECR) Konzepts im deutschen Textilmarkt. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Textile Wertschöpfungskette, Bekleidungseinzelhandel, Flächensteuerungskonzepte, Wettbewerbsstrategien, Supply Chain Management, Logistik, Category Management, Kooperation, Prozessmodell, Primär- und Sekundärfaktoren, Erfolgsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Efficient Consumer Response“ (ECR) im Textilmarkt?
ECR ist ein Kooperationskonzept zwischen Herstellern und Händlern, das darauf abzielt, die Lieferkette effizienter zu gestalten und schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Warum ist Geschwindigkeit im Bekleidungseinzelhandel so wichtig?
Um mit vertikal integrierten Unternehmen wie H&M oder ZARA zu konkurrieren, müssen Prozesse optimiert werden, damit Ware „floor ready“ (verkaufsfertig) geliefert wird.
Welche Rolle spielt RFID und EDI bei ECR?
Elektronischer Datenaustausch (EDI) und Identifikationstechnologien wie RFID sind essenzielle „Enabling Technologies“, um Bestände in Echtzeit zu verfolgen und die Logistik zu beschleunigen.
Was sind die Primärfaktoren für den Erfolg von ECR?
Die Arbeit identifiziert entscheidende Faktoren wie vertrauensvolle Kooperation, Standardisierung der Daten und eine integrierte Supply Chain als Basis für den Erfolg.
Wie kann ECR die Logistikkosten senken?
Durch Ansätze wie Cross-Docking und Vendor Managed Inventory (VMI) können Lagerumschläge erhöht und Transportzeiten sowie -kosten signifikant reduziert werden.
- Quote paper
- Jim Tichatschek (Author), 2014, Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des Efficient Consumer Response im deutschen Textilmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315767