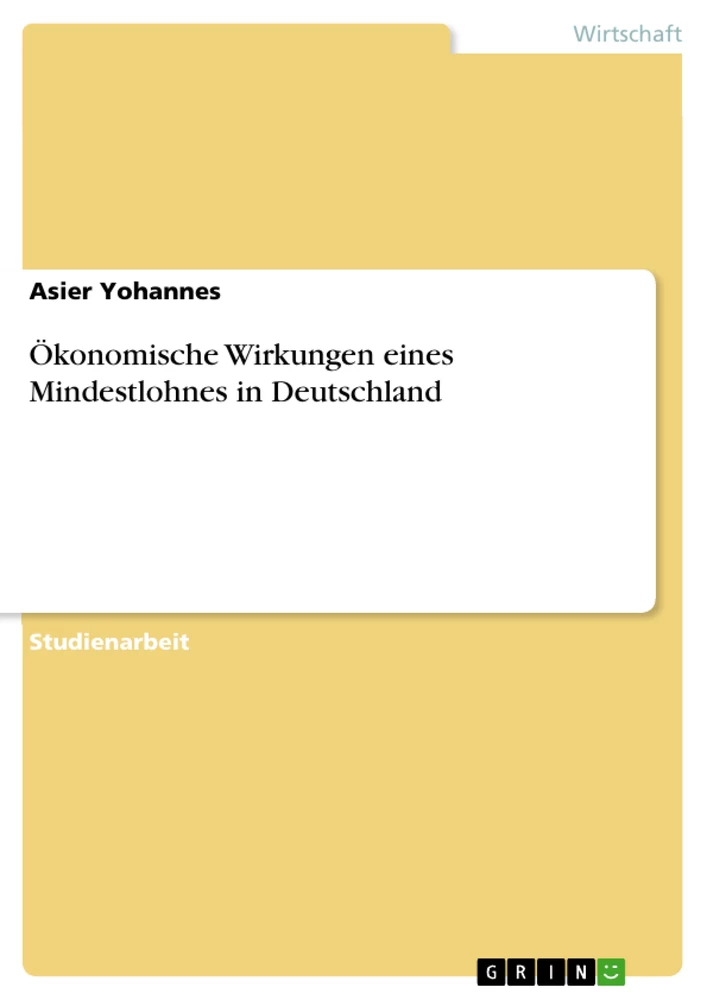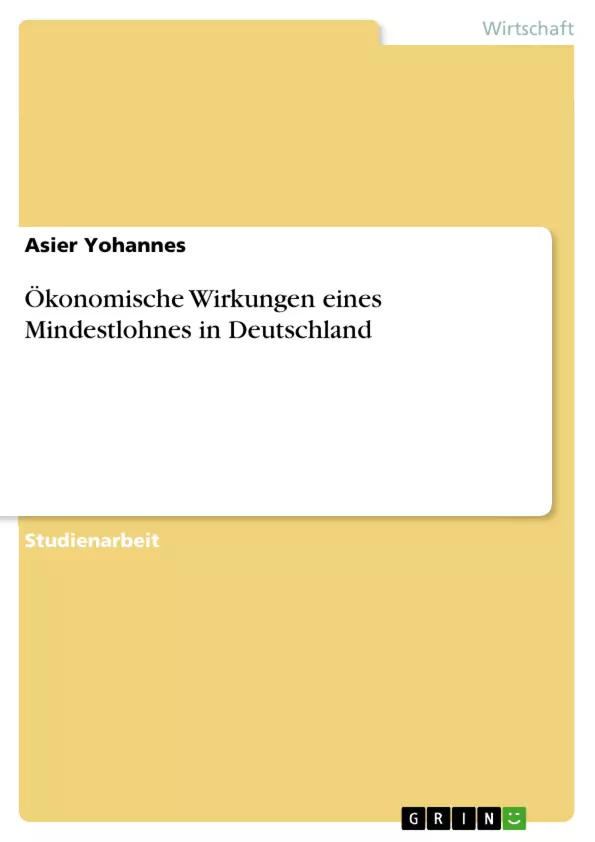In der wissenschaftlichen Diskussion um den Mindestlohn geht es seit Jahrzehnten um die Fragen, inwiefern der Mindestlohn hilft, das Ziel der finanziellen Absicherung zu erreichen und ob, beziehungsweise inwieweit, er dabei das sekundäre Ziel, die Beschäftigungsquote, gefährdet. Diese Thematik soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.
Mit der Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohnes von 8,50 Euro in Deutschland am ersten Januar 2015 wurde ein großes, mit zahlreichen sozialen und politischen Risiken verbundenes Experiment gestartet. Bislang gab es in Deutschland keine einheitliche gesetzliche Regelung für einen branchenübergreifenden Mindestlohn. Verbindliche Mindestlöhne galten bis dato nur für einzelne Branchen.
Gemäß dem am 27. November 2013 unterzeichneten Koalitionsvertrag zwischen CSU und SPD sind die mit dem Mindestlohn geplagten Ziele im Vertrag klar definiert. Einerseits wird erwartet, dass vollzeitbeschäftigte Personen ein Arbeitseinkommen haben sollen, das die Existenz absichert, andererseits wird auch hervorgehoben, dass eine hohe Beschäftigung durch diese politische Neuregelung langfristig nicht gefährdet werden soll.
Mindestlohnregelungen sind eine nicht unumstrittene politische Praxis. Während Befürworter argumentieren, dass entsprechende Regelungen helfen würden, Ausbeutung am Arbeitsmarkt zu verhindern und den Lebensstandard der Arbeitnehmer mit Niedrigeinkommen zu heben, kritisieren die Gegner, dass gering qualifizierten Arbeitnehmern der Jobverlust drohe.
Im ersten Teil dieser Seminararbeit werden zwei unterschiedliche theoretische Erklärungsmodelle herangezogen, um die unterschiedlichen empirischen Ergebnisse aus diversen Studien zur Wirkung eines Mindestlohnes theoretisch zu untermauern. Im zweiten Teil werden Erfahrungen mit Mindestlohnmodellen aus anderen Ländern Europas herangezogen, um die möglichen Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt abschätzen zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Modelle
- Neoklassische Theorie
- Kaufkrafttheorie
- Internationale Entwicklung von Mindestlöhnen
- Mindestlöhne in Europa: Empirische Daten und Erfahrungswerte
- Mindestlohneffekte am Beispiel von Frankreich
- Mindestlohneffekte am Beispiel von England
- Erwartete Auswirkungen eines Mindestlohnes in Deutschland
- Die Formen des Mindestlohnes
- Der rechtliche Rahmen des Mindestlohnes
- Erwartete Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland und analysiert dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der möglichen positiven und negativen Effekte des Mindestlohnes auf die Beschäftigung und die Einkommensentwicklung.
- Theoretische Modelle des Mindestlohns
- Internationale Erfahrungen mit Mindestlohnregelungen
- Erwartete Auswirkungen eines Mindestlohnes in Deutschland
- Potentielle Folgen für Beschäftigung und Einkommensentwicklung
- Politische und gesellschaftliche Debatte um den Mindestlohn
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Mindestlohn in Deutschland ein. Es beschreibt die politische und gesellschaftliche Debatte um den Mindestlohn und die damit verbundenen Ziele und Risiken.
- Theoretische Modelle: Dieses Kapitel präsentiert zwei theoretische Modelle, die zur Erklärung der Auswirkungen eines Mindestlohnes auf den Arbeitsmarkt herangezogen werden können. Die Neoklassische Theorie argumentiert für einen negativen Zusammenhang zwischen Mindestlohn und Beschäftigung, während die Kaufkrafttheorie eine positive Wirkung auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigung postuliert.
- Internationale Entwicklung von Mindestlöhnen: In diesem Kapitel werden internationale Erfahrungen mit Mindestlöhnen in Europa, insbesondere in Frankreich und Großbritannien, vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse der empirischen Daten und Erfahrungswerte sowie der möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Einkommensentwicklung, Neoklassische Theorie, Kaufkrafttheorie, empirische Daten, internationale Erfahrungen, Frankreich, England, Deutschland.
- Quote paper
- Asier Yohannes (Author), 2016, Ökonomische Wirkungen eines Mindestlohnes in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315832