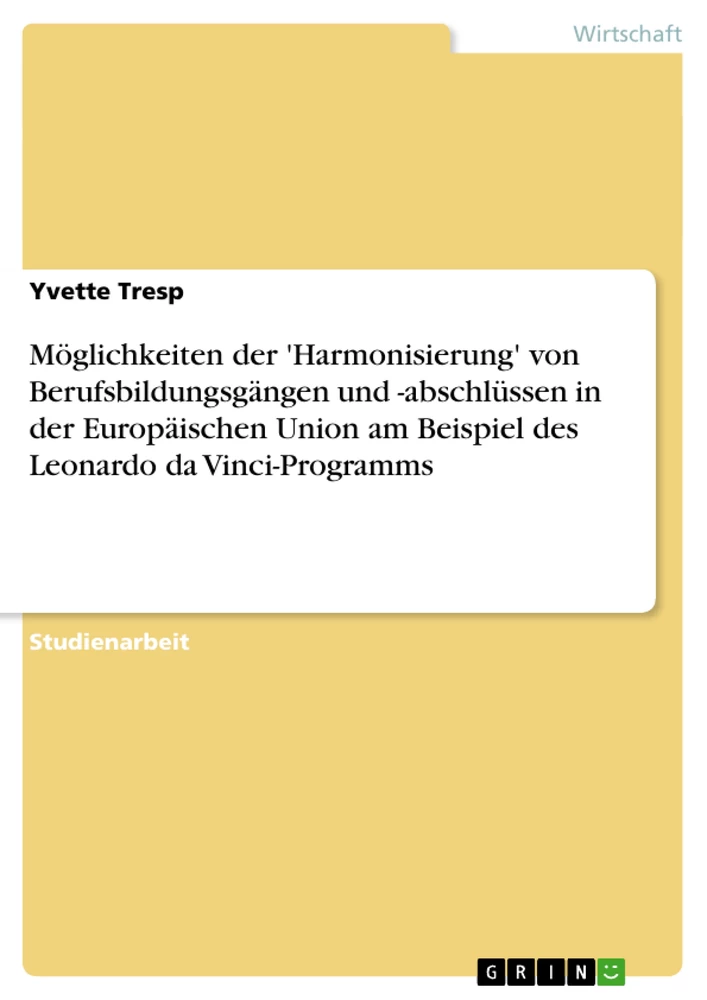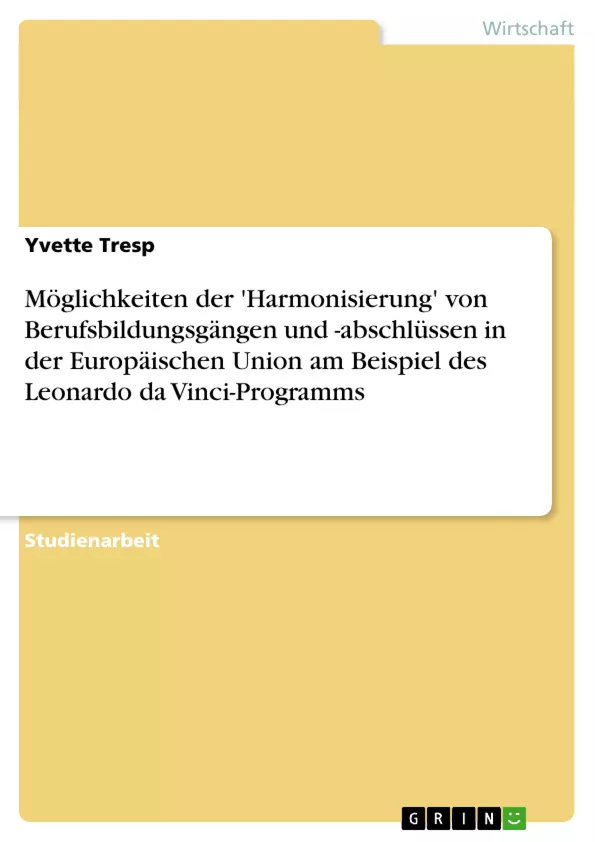Die Europäische Union steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Zunächst ist schon in der Charta der Grundrechte, insbesondere im Artikel 14 , festgelegt, dass jede Person das Recht auf Bildung, sowie auf Zugang zu beruflicher Aus- und Weiterbildung hat. Zudem haben die EU-Bürger das Recht auf Freizügigkeit (Artikel 15 der Charta ) auf dem europäischen Arbeitsmarkt, das heißt, die Menschen dürfen an jedem Ort im Gebiet der EU Wohnsitz nehmen und dort unter denselben Voraussetzungen wie Einheimische beruflich tätig werden. Die Bürger können dies derzeit jedoch nur begrenzt nutzen, da die nationalen beruflichen Qualifikationen bei ausländischen Unternehmen meist noch nicht anerkannt werden. Die europaweite rechtliche Anerkennung von Abschlüssen beschränkt sich bisher auf Berufe, die eine Zugangsvoraussetzung haben (z.B. bei Medizinern und Juristen). Ausgenommen sind aber beispielsweise alle Abschlüsse des Dualen Systems aus Deutschland. In diesem Fall wurden bisher nur bilaterale Abkommen mit Frankreich und Österreich geschlossen. Das und die enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen machen eine europaweite „Harmonisierung“ der Berufsbildungsgänge, d.h. eine europäische Dimension zu Bildung & Ausbildung, unumgänglich. Im Zuge der Entwicklung zu einer wissensbasierten Wirtschaft und nachhaltigem Wirtschaftswachstum ist vor allem auch die Personalentwicklung betroffen.
Die Globalisierung und das Zusammenwachsen Europas stellen neue Anforderungen, Möglichkeiten und Erfordernisse an die berufliche Aus- und Weiterbildung. Denn unter Globalisierung versteht man nicht nur international ausgerichtete Märkte und Arbeitsplätze, sowie Medien- und Fremdsprachenkompetenz, sondern auch zukünftiges grenzüberschreitendes Lernen und Arbeiten. Die Entscheidung zur verstärkten europäischen Kooperation in der Berufsbildung und die Forcierung gemeinsamer Bildungsziele hat auch in der deutschen Berufsbildungspolitik ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die politische Richtung wird zudem durch intensivere Zusammenarbeit in der Berufsbildungsforschung und die Kooperation mit europäischen Berufsbildungsinstitutionen bestimmt. Aus diesem Grund hat auch der Aus- und Weiterbildungsstandort Deutschland und das deutsche Berufsbildungssystem im internationalen Wettbewerb an Bedeutung gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Rechtliche Grundlage
- 2.1 Zielsetzung des Rates von Lissabon, März 2000
- 2.2 Zielsetzung des Rates von Stockholm, März 2001
- 2.3 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates, 10. Juli 2001
- 2.4 Tagung des Europäischen Rates in Barcelona, März 2002
- 2.5 Tagung des Rates „Bildung/Jugend“, 30. Mai 2002
- 2.6 Erklärung von Kopenhagen, 30. November 2002
- 3. Das Leonardo da Vinci-Programm
- 3.1 Erste Phase von Leonardo da Vinci
- 3.2 Zweite Phase von Leonardo da Vinci
- 3.3 Zentrale Ziele von Leonardo da Vinci
- 3.4 Förderungsmaßnahmen
- 3.4.1 Verfahrenseinteilung
- 3.4.2 Erläuterung der Maßnahmen
- 3.4.2.1 Mobilität
- 3.4.2.2 Pilotprojekte
- 3.4.2.3 Sprachenkompetenz
- 3.4.2.4 Transnationale Netze
- 3.4.2.5 Vergleichsmaterialien
- 3.4.2.6 Thematische Aktionen
- 3.4.2.7 Gemeinsame Aktionen
- 3.5 Förderungsvoraussetzungen
- 3.5.1 Transnationalität
- 3.5.2 Eigenfinanzierung
- 3.5.3 Akteursvielfalt
- 3.6 Beurteilung des Leonardo da Vinci-Programms
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Leonardo da Vinci-Programm, ein Aktionsprogramm der Europäischen Union zur Umsetzung der Berufsbildungspolitik. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Programms und untersucht seine Rolle bei der Harmonisierung von Berufsbildungsgängen und -abschlüssen innerhalb der EU. Darüber hinaus werden die Förderungsmaßnahmen, -voraussetzungen und die Beurteilung des Programms erörtert.
- Rechtliche Grundlagen des Leonardo da Vinci-Programms
- Die Ziele des Programms zur Harmonisierung der Berufsbildung in der EU
- Förderungsmaßnahmen und -voraussetzungen des Leonardo da Vinci-Programms
- Bedeutung des Programms für die Berufsbildungslandschaft in Europa
- Potenzial und Herausforderungen des Leonardo da Vinci-Programms
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Europäischen Union im Bereich der Berufsbildung und zeigt die Notwendigkeit einer europäischen Dimension in Bildung und Ausbildung auf. Die Bedeutung der Harmonisierung von Berufsbildungsgängen und -abschlüssen im Hinblick auf die Globalisierung und die Entwicklung zu einer wissensbasierten Wirtschaft wird betont.
- Kapitel 2: Rechtliche Grundlage
Kapitel 2 analysiert die rechtlichen Grundlagen des Leonardo da Vinci-Programms. Es werden die wichtigsten Beschlüsse und Erklärungen des Europäischen Rates sowie des Europäischen Parlaments und des Rates im Bereich der Berufsbildungspolitik dargestellt, die den Rahmen für das Leonardo da Vinci-Programm geschaffen haben.
- Kapitel 3: Das Leonardo da Vinci-Programm
Kapitel 3 stellt das Leonardo da Vinci-Programm in den Mittelpunkt. Die Entstehung und Entwicklung des Programms, seine zentralen Ziele sowie die wichtigsten Förderungsmaßnahmen werden erörtert. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Förderungsmaßnahmen, ihren Verfahren und den damit verbundenen Voraussetzungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Leonardo da Vinci-Programm, Berufsbildung, Harmonisierung, Europäische Union, Rechtliche Grundlage, Förderungsmaßnahmen, Transnationalität, Mobilität, Sprachenkompetenz, Berufsabschlüsse, Anerkennung, Qualität, europäische Kooperation.
Häufig gestellte Fragen zum Leonardo da Vinci-Programm
Was ist das Leonardo da Vinci-Programm?
Es ist ein Aktionsprogramm der EU zur Umsetzung der Berufsbildungspolitik, das die Zusammenarbeit und Mobilität in der Ausbildung fördert.
Was bedeutet „Harmonisierung“ von Berufsabschlüssen?
Damit ist die europaweite Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen gemeint, um die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu stärken.
Welche Maßnahmen werden durch das Programm gefördert?
Gefördert werden unter anderem Mobilitätsprojekte, Pilotprojekte zur Innovation, Sprachenkompetenz und transnationale Netze.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Förderung erfüllt sein?
Zentrale Kriterien sind die Transnationalität (Zusammenarbeit mehrerer EU-Länder), Eigenfinanzierung und eine Vielfalt der beteiligten Akteure.
Welche Rolle spielt der Rat von Lissabon (2000) für das Programm?
In Lissabon wurde das Ziel gesetzt, die EU zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen, was die Berufsbildung ins Zentrum rückte.
- Arbeit zitieren
- Yvette Tresp (Autor:in), 2004, Möglichkeiten der 'Harmonisierung' von Berufsbildungsgängen und -abschlüssen in der Europäischen Union am Beispiel des Leonardo da Vinci-Programms, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31583